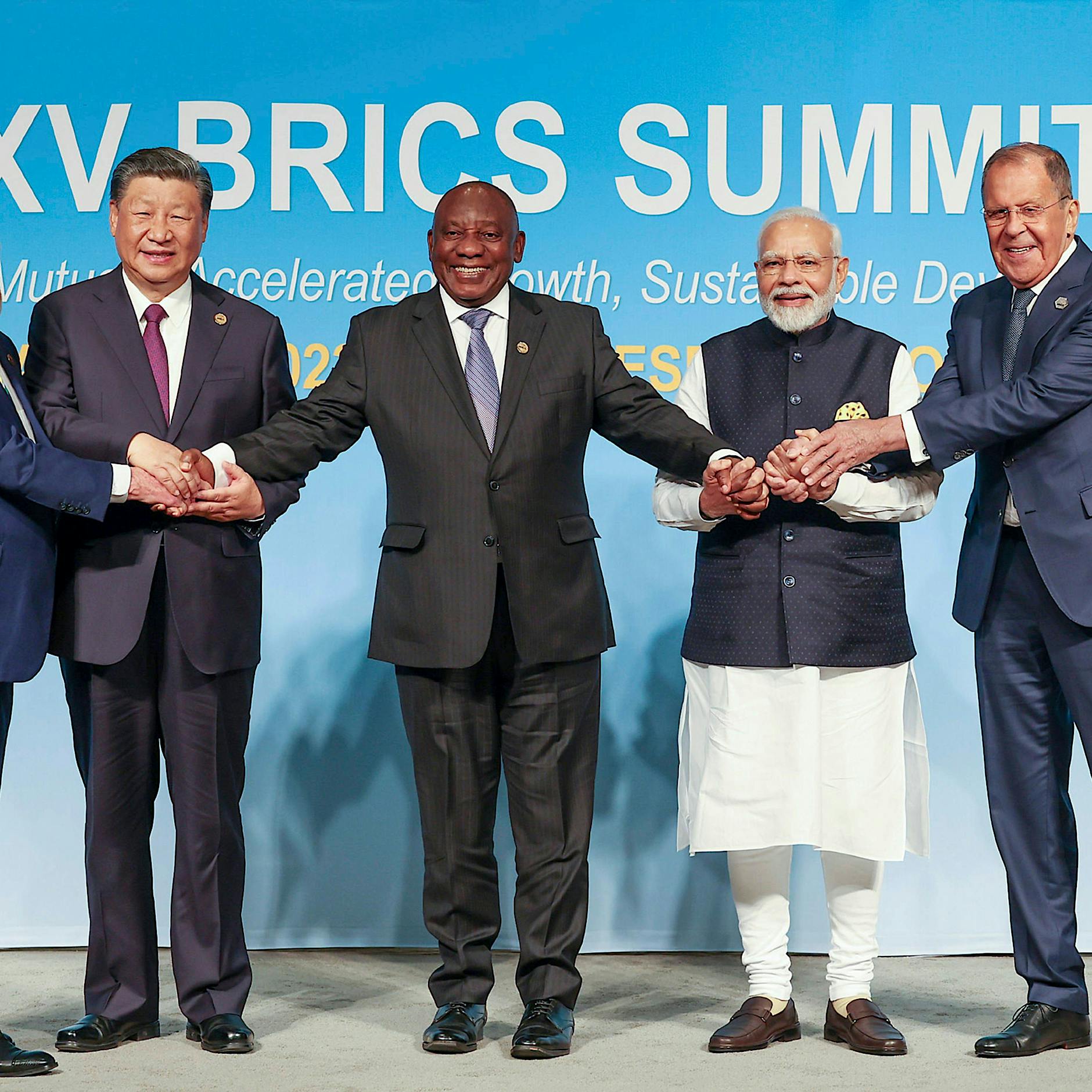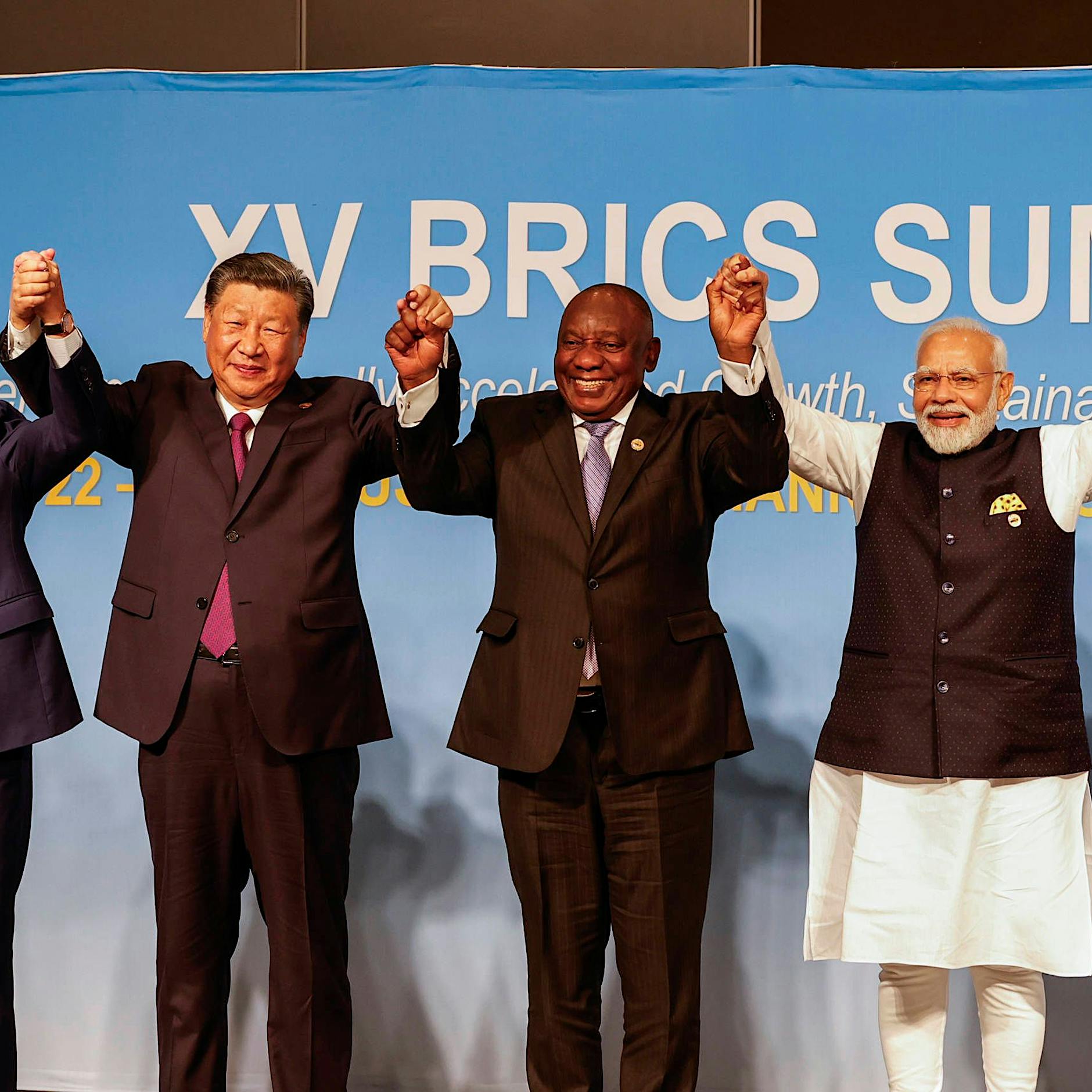Die EU versucht sich in der Offensive. Bis 2030 will sie sich bei der Versorgung mit sogenannten kritischen Rohstoffen breiter aufstellen. Das ist Ziel einer Verordnung, auf die sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedsländer sowie des Europaparlaments am Montagabend geeinigt haben.
Zu den „kritischen Rohstoffen“ gehören beispielsweise Lithium und Silizium, aber auch Seltene Erden. Derzeit ist die EU dabei noch stark von China abhängig. Um das zu ändern, will Brüssel einerseits die Veredelung, Verarbeitung sowie das Recycling solcher Stoffe in der EU selbst fördern. Andererseits sollen strategische Partnerschaften mit Drittstaaten ausgebaut werden, um so sicherzustellen, dass kein Land mehr als 65 Prozent des Jahresverbrauchs der Union deckt.
Deutsche Wirtschaft: Mercosur wäre ein großer Erfolg
Ein wichtiger Baustein für eine derartige Rohstoffstrategie wäre der seit Jahrzehnten geplante Freihandelsvertrag mit der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sagte der Berliner Zeitung, das EU-Mercosur-Handelsabkommen könne „dazu beitragen, die Rohstoffknappheit in Europa zu mildern und die Lieferketten deutscher Unternehmen zu diversifizieren“. Er fordert: „Die Bundesregierung sollte sich hierfür nachdrücklich einsetzen. Dies wäre ein großer Erfolg und ein notwendiger Lichtblick im stark belasteten außenwirtschaftlichen Umfeld.“
Erst vor zwei Wochen waren die Verhandlungen für ein Handelsabkommen der EU mit Australien überraschend gescheitert. Nun geht in der deutschen Wirtschaft die Angst davor um, dass auch das EU-Mercosur-Abkommen bald endgültig Geschichte sein könnte. So erklärt auch DIHK-Außenwirtschaftschef Treier im Gespräch mit der Berliner Zeitung, er hege „große Hoffnungen, dass die EU und die Länder des Mercosur sich rasch auf den Abschluss des wichtigen Handelsabkommens einigen können“. Dieses wäre „ein Paukenschlag für unsere exportierende Wirtschaft und ihre internationalen Handelsbeziehungen“.
Und die Zeit drängt. Denn nur noch bis zum 6. Dezember hätten Brüssel und der südamerikanische Staatenbund noch, um die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abzuschließen, erklärte Paraguays Präsident Sebastián Peña Ende September. Wenn bis dahin kein Kompromiss gefunden sei, werde er die Gespräche endgültig abbrechen. Am 6. Dezember beginnt der turnusmäßige Vorsitz Paraguays beim Mercosur. Dem „Gemeinsamen Markt des Südens“ gehören außerdem die südamerikanischen Schwergewichte Brasilien und Argentinien, Uruguay sowie das derzeit suspendierte Venezuela an. Gerade hat Brasilien den Vorsitz inne.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen waren bereits 1999 begonnen worden. Abgeschlossen wurden sie nach mehreren Unterbrechungen genau 20 Jahre später, im Juni 2019. Ratifiziert von den einzelnen EU- und Mercosur-Mitgliedstaaten ist das Abkommen indes bis heute nicht. Es sieht eine Freihandelszone mit fast 780 Millionen Menschen vor. Die Mercosur-Staaten könnten laut der Einigung 93 Prozent ihrer Ausfuhren in die EU zollfrei abwickeln, besonders attraktiv sind Produkte wie Zucker, Rindfleisch, Geflügel oder Ethanol. Die Zölle auf 91 Prozent aller Exporte aus der EU in die Länder des Mercosur würden abgeschafft, darunter Autos, Maschinen und Chemikalien.
China hat die EU im Handel mit Südamerika abgehängt
Besonders reizvoll für die deutsche Exportwirtschaft, so DIHK-Außenwirtschaftschef Treier im Gespräch, „wäre ein wechselseitig verbesserter Zugang insbesondere zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automobil- und Ernährungsindustrie“. Derzeit seien noch rund 85 Prozent der europäischen Ausfuhren in die Mercosur-Länder mit Zöllen belastet, „was für die Unternehmen Kosten in Höhe von jährlich vier Milliarden Euro bedeutet“. Das Handelsabkommen verspreche daher „gegenüber wichtigen internationalen Mitbewerbern, wie zum Beispiel China“, die Chance auf einen „handelspolitischen Vorsprung“.
Seit dem Beginn der EU-Verhandlungen mit Mercosur konnte China die EU bezüglich des Handels mit dem südamerikanischen Block überholen. Wie das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Anfang August mitteilte, ist die Volksrepublik mittlerweile der größte Handelspartner des Mercosur. Hinzu kommen in den letzten Jahren deutlich anwachsende Direktinvestitionen aus China und Kredite für Infrastrukturprojekte.
Deutschland droht bei der Rohstoffversorgung ins Hintertreffen zu geraten. Erst am vergangenen Dienstag hatten die beiden Rohstoff-Experten Jakob Kullik von der Technischen Universität Chemnitz und Jens Gutzmer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie der Bundesregierung bezüglich ihrer Rohstoffpolitik ein „Scheitern“ diagnostiziert. Die „ursprüngliche Überlegung“, deutschen Unternehmen zu einem „privilegierten Zugang zu Rohstoffen aus strategisch wichtigen Lagerstätten“ zu verhelfen, sei nicht aufgegangen, schrieben sie in einem Gastkommentar im Handelsblatt.
Dafür, dass die „geo- und sicherheitspolitische Rohstoffpolitik“ gelinge, müssten neue Zuständigkeiten her, so ein „Sonderbeauftragter“ des Bundeswirtschaftsministeriums, „der für die Resilienz der Rohstoffversorgung der deutschen Industrie aus dem Ausland zuständig ist“. Dieser müsse zudem eng mit den großen deutschen Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten. Auf EU-Ebene werde außerdem eine „EU-Rohstoffagentur“ benötigt, „die langfristig vielversprechende Rohstoffprojekte identifiziert und sich mit Kompetenz und Finanzmitteln an deren Entwicklung beteiligt“.
Strafzölle auf EU-Produkte? Südamerika behält sich Gegenmaßnahmen vor
Bewegung in die festgefahrenen Gespräche über das EU-Mercosur-Abkommen brachte Spanien, das seit dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Anfang November bekräftigten der spanische Premier Pedro Sánchez sowie der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einem Telefonat ihre Absicht, die Verhandlungen über das Abkommen bald abschließen zu wollen. Sánchez erklärte im Anschluss, der Prozess müsse „beschleunigt“ werden und auf einer „Beziehung des gegenseitigen Vertrauens“ beruhen.
Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtete, habe der brasilianische Präsident bei dem Telefonat seine Kritik am EU-Zusatzkatalog zum Schutz der Umwelt erneuert. Brüssel hatte Mercosur im März einen Entwurf für eine rechtsverbindliche Zusatzerklärung vorgelegt. Mit dieser sollen die Südamerikaner insbesondere zum Schutz des Regenwaldes verpflichtet werden – eine Konsequenz daraus, dass während der Amtszeit von Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro der Raubbau am Amazonas-Regenwald stark gestiegen war. Nutznießerin war zu großen Teilen die industrialisierte Landwirtschaft. Eine Ausweitung der Agrarexporte in die EU in Folge des Handelsabkommens hätte wohl zu noch mehr Abholzung geführt.
Doch Lula läutete eine 180-Grad-Wende ein. Laut am Sonntag veröffentlichten Zahlen fiel die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien zwischen August 2022 und Juli 2023 um 22,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 2018. Dass die EU dennoch an der Zusatzvereinbarung festhält, sorgt für Unmut, gerade in Brasilien. So beschwerte sich Umweltministerin Marina Silva am Mittwoch im Gespräch mit der Deutschen Welle, Brüssel behandle Lula „als wäre er Bolsonaro“.
Anfang September präsentierte die Mercosur-Wirtschaftsorganisation einen Gegenentwurf zu den von der EU geforderten Zusatzvereinbarungen. In diesem heißt es, man sei „bereit, ein gemeinsames Instrument für Handel und nachhaltige Entwicklung auszuhandeln, das die innerstaatliche Gesetzgebung der Vertragsparteien und die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten berücksichtigt“. Allerdings dürfe ein solches „keine Sanktionen (oder auch nur Andeutungen von Sanktionen) enthalten“. „Maßnahmen zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung“ dürften nicht „als ungerechtfertigte oder unnötige Handelshemmnisse eingesetzt werden“. Für den Fall, dass bestimmte Produkte aus den Mercosur-Staaten nicht in die EU eingeführt werden dürfen, solle ein „Mechanismus zur Wiederherstellung des Gleichgewichts“ aktiviert werden können – eine geschönte Umschreibung für Strafzölle auf die Einfuhr von Produkten aus der EU.
Bundesregierung will Mercosur-Abkommen baldmöglichst abschließen
Schließlich befürchten südamerikanische Politiker hinter den EU-Zusatzvereinbarungen protektionistische Motivationen. Besonders Irland, Frankreich und Österreich, und damit Länder, in denen der Agrarsektor traditionell stark ist, gelten seit Jahren als Kritiker des Freihandelsabkommens. Sie fürchten eine Überschwemmung des europäischen Marktes durch günstige landwirtschaftliche Produkte aus den Mercosur-Staaten. Bereits der kürzlich begrabene Freihandelsvertrag zwischen Australien und der EU scheiterte an der Frage nach dem Zugang australischer Agrarprodukte für den europäischen Markt.
Um es so weit nicht kommen zu lassen, plädierte bereits im Juli Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), für mehr Kompromissbereitschaft der EU in den Verhandlungen der Zusatzvereinbarung zum Mercosur-Abkommen. In einer Mitteilung anlässlich des Gipfeltreffens von EU und Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (CELAC) in Brüssel warnte er vor den „fatalen Folgen für die EU-Handelspolitik“ im Falle eines Scheiterns des Abkommens. Die Interessen der Mercosur-Staaten, die sich „ihrer neuen geopolitischen Rolle bewusst“ seien, müssten „stärker berücksichtigt werden“.