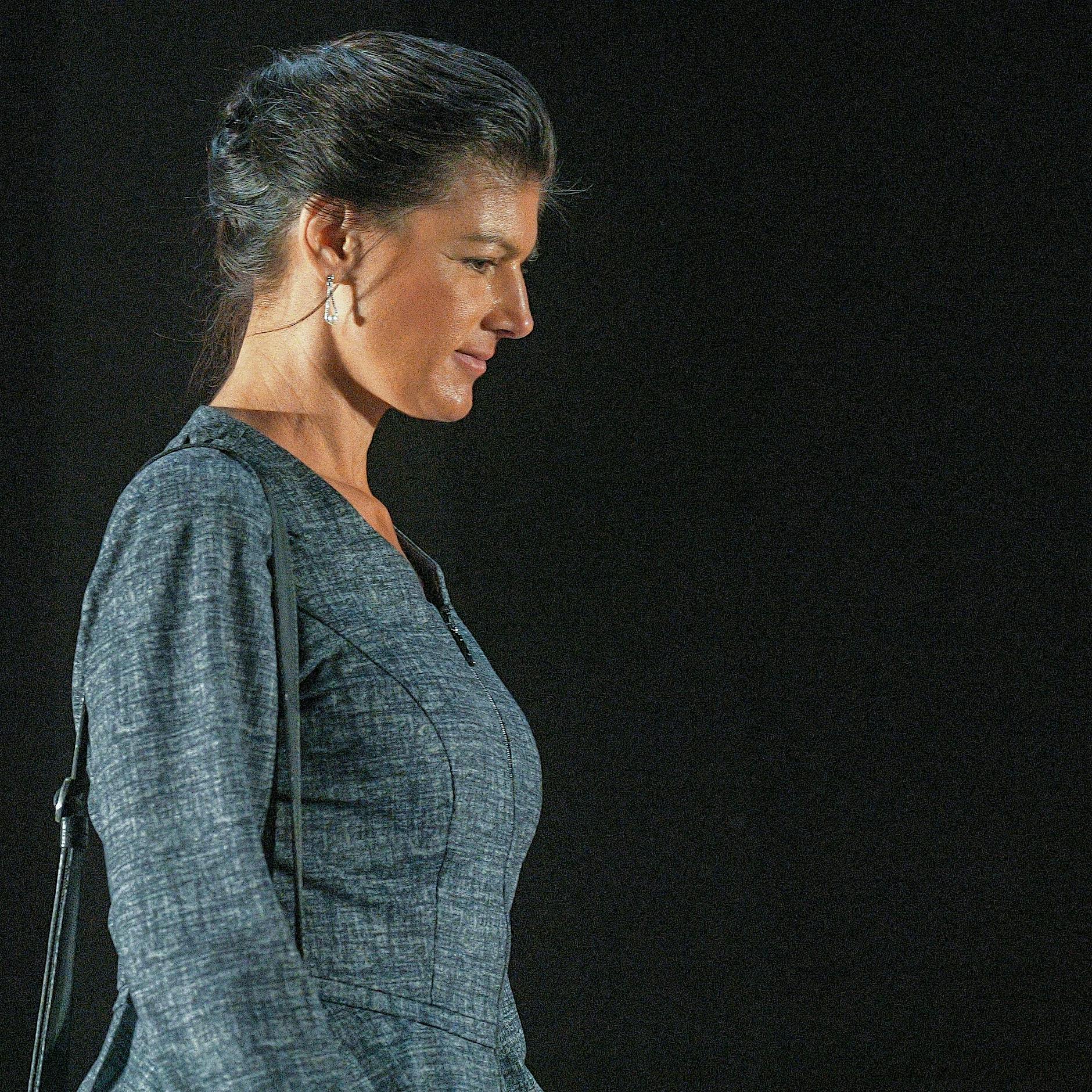Es ist viel von deutscher Verantwortung die Rede dieser Tage und davon, ob aus der deutschen Vergangenheit Lehren folgen, die man als Handlungsanweisung für politisches Handeln verwenden kann. Deutschland ist verantwortlich für zwei Weltkriege. Sei es da nicht nachvollziehbar, fragte das ZDF vor kurzem den amerikanischen Historiker Timothy Snyder, dass Deutschland zögere, mit Waffenlieferungen in den Krieg Russlands gegen die Ukraine einzugreifen. Für einen Moment wurde das „Nie wieder“, auf das sich Bundespräsident Steinmeier so gerne in seinen Reden berief, zu einer Instruktion für Außenpolitik: „Nie wieder“ schien zu suggerieren, nie wieder in einem Konflikt Partei gegen Russland zu ergreifen.
Snyder antwortete: „Die gesamte Vergangenheitsbewältigung wird im Jahr 2022 wahrscheinlich die wichtigste Prüfung für Deutschland seit 1945. Haben die Deutschen sie jemals ernst gemeint oder nicht? Wenn sich Deutschland jetzt von schnellem, entschiedenem Handeln abwendet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass mit dieser Erinnerungskultur schon lange etwas nicht mehr stimmt.“
Snyder ist nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, die Geschichte gebe uns Menschen Lehren mit auf den Weg, die wir befolgen müssten, um sicher zu sein, „das Richtige“ zu tun. Ein großer Teil nicht nur der deutschen Geschichtspädagogik fußt auf der Annahme, wir könnten, ja müssten aus der Geschichte lernen, die Geschichte sei eine Art moralischer Imperativ, der die Grundsätze für politisches Handeln im Jetzt liefere.
„Aus der Geschichte lernen“ Schüler im Geschichtsunterricht, Erwachsene in Seminaren zur Vergangenheitsbewältigung. Ein großer Teil der Produktion der Bundeszentrale für politische Bildung beruht auf der Überzeugung, man könne aus der Geschichte nicht nur irgendetwas, sondern etwas ganz Bestimmtes lernen. So wie Timothy Snyder, für den aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung über das Dritte Reich klar folgt, dass Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Unterstützung und Bewaffnung der Ukraine übernehmen muss.
Die Vergangenheit als Lehrmeister der Politik
Damit an dieser Stelle kein falscher Eindruck entsteht: Ich bin, was die politischen Konsequenzen angeht, die Snyder zieht, ganz auf seiner Seite. Russland führt diesen Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Demokratie, gegen „farbige“ Revolutionen, dagegen, dass Massenproteste wie in Serbien 2000, in Georgien 2003, 2004 und 2014 in der Ukraine, 2005 in Kirgisien, 2020 in Belarus vielleicht eines Tages auf Russland überspringen und ein kleptokratisches Oligarchensystem und eine rückwärtsgewandte Diktatur beseitigen könnten, die versucht, die Demokratie im Ausland zu diskreditieren und zu unterminieren.
Deutschland ist eine stabile Demokratie. Genau deshalb ist es der Feind dieses Russlands, nicht weil es Panzer an die Ukraine liefert. Deutschland ist das mächtigste Land in der EU und eines der wichtigsten Nato-Mitgliedsländer – deshalb sollte es in diesem Krieg keine Sonderrolle wählen. Je mehr Russland durch diesen Krieg geschwächt wird, desto sicherer wird Deutschland sein. Aber das folgt aus einer Analyse der russischen Politik und des bisherigen Kriegsverlaufs. Es ist keine Lehre, die man aus der jüngeren deutschen Geschichte ziehen kann.
Aus vielen Ereignissen können wir nichts lernen
Es ist mehr als zweifelhaft, ob man aus der Geschichte überhaupt lernen kann. Man muss kein Anhänger von Karl Marx’ Behauptung sein, Geschichte wiederhole sich nur als Farce, um zu bezweifeln, dass sich aus der Vergangenheit nützliche Lehren für die Zukunft ziehen lassen.
Die meisten Lehren, die Historiker mit pädagogischen Ambitionen und Politiker in ihren Sonntagsreden gerne ziehen, beziehen ihre Überzeugungskraft aus der Tatsache, dass man, wie der Volksmund sagt, „hinterher immer schlauer ist.“ Ein typisches Beispiel für solche ahistorischen Argumentationen sind die auch dieser Tage immer wieder bemühten Vergleiche mit 1938: Heute wissen wir, dass Neville Chamberlains Überzeugung, er habe mit dem Münchener Abkommen den Frieden in Europa gesichert, falsch war.
Wir wissen es, denn danach besetzte Hitler nicht nur das Sudetenland, sondern verwandelte Böhmen und Mähren in ein Protektorat und die Slowakei in einen Vasallenstaat. Und wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Chamberlain das auch hätte wissen müssen. Folgt daraus, dass man Diktatoren nie nachgeben darf, weil sie sich ohnehin nicht an Absprachen halten, dass jede Form von „Appeasement“ falsch wäre und man Diktatoren, selbst wenn sie atomar bewaffnet sind, den Krieg erklären sollte?
Das würde allen jahrzehntelang funktionierenden Abkommen zwischen den USA und der UdSSR über Rüstungskontrolle, Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen (die in den letzten Jahrzehnten abgewickelt wurden) widersprechen. Wollen wir mit den Taliban über humanitäre Maßnahmen gegen Hunger und Massenemigration verhandeln, oder sollten wir sie sofort wieder mit Krieg überziehen, da „Appeasement“ ja, wie 1938 gezeigt hat, immer falsch sein muss?
Können wir aus Chamberlains Scheitern lernen, dass wir mit dem venezolanischen Diktator Nicolas Maduro besser Krieg führen, als mit ihm über Öllieferungen zu verhandeln, die russische Lieferungen ersetzen können? Waren alle Vereinbarungen, die die USA mit dem kleinen, kommunistischen Kuba nach der fehlgeschlagenen Invasion in der Schweinebucht ausgehandelt haben, eine Neuauflage von „München 1938“, weil die USA nicht sofort erneut versucht haben, Kuba zu besetzen? Diese Fragen sind rhetorisch. Aus dieser Geschichte können wir nichts lernen.
Aber noch problematischer ist die Annahme, wir könnten aus der Geschichte nicht nur irgendwelche abstrakten, nicht genau fassbaren Lehren ziehen, sondern ganz bestimmte Dinge lernen – und zwar diese, und keine anderen. Die Behauptung klingt sehr überzeugend, aus der deutschen Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit folge unabdinglich, das demokratische Deutschland müsse sich einem aggressiven, undemokratischen Russland entgegenstellen, das manche heute geradezu als Reinkarnation des Dritten Reiches ansehen.
Der moralische Impetus hinter dieser Aufforderung erschwert eine argumentative Auseinandersetzung; wer ihm widerspricht, begibt sich fast unweigerlich in eine unmoralische Ecke. Deshalb sei hier auf einige Beispiele aus der jüngeren deutschen Geschichte verwiesen, die zeigen, wie problematisch eine solche Argumentation ist.
Wiederbewaffnung, Pazifismus, Jugoslawienkrieg
Wenige Jahre nach der Errichtung zweier deutscher Republiken und der Wiedererlangung der inneren Souveränität der Bundesrepublik standen die Gründung der Nato und die westdeutsche Wiederbewaffnung zur Debatte. Massendemonstrationen und eine heftige innenpolitische Debatte folgten. Für die Befürworter der Wiederbewaffnung hieß die Lehre aus der Geschichte, Deutschland müsse sich der Bedrohung durch die totalitäre Sowjetunion und den Warschauer Pakt stellen und gerade, weil es eine verbrecherische Diktatur gewesen war, nun die Demokratie verteidigen.
Die Gegner der Wiederbewaffnung interpretierten den „Nie wieder“-Grundkonsens der Nachkriegszeit etwas anders: Deutschland habe durch die Verbrechen des Dritten Reiches das Recht verwirkt, sich zu verteidigen, „nie wieder Krieg“ hieß für sie nicht, durch Aufrüstung einen drohenden Krieg vermeiden, sondern „nie wieder eine Armee aufstellen“. Beide Positionen waren moralisch vertretbar, beide konnten sich darauf berufen, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.
Der Streit, ob Pazifismus die richtige Schlussfolgerung aus der Nazizeit oder – mit Blick auf die Nato-Mitgliedschaft der meisten westlichen europäischen Demokratien – ein gefährlicher „deutscher Sonderweg“ war, durchzog die ganze Nachkriegszeit bis zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik.
Dann kam der Krieg in Jugoslawien, und die Bundesrepublik stand vor der Frage, ob Heraushalten eine bessere Option war als Eingreifen. Und wieder bot die Geschichte keine klare Handlungsanweisung: 1940 hatten die Truppen des Dritten Reiches Jugoslawien zerschlagen, einen faschistischen kroatischen Staat gegründet, der an Bosniern, Juden und Serben Völkermord beging, und Serbien besetzt. Verbot das „Nie wieder“ eine deutsche Beteiligung an der Bombardierung Serbiens durch die Nato?
Die damalige Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer zog den entgegengesetzten Schluss: Fischer begründete die deutsche Beteiligung an der Intervention mit der Notwendigkeit, im Kosovo einen Völkermord zu verhindern – ein leicht erkennbarer Verweis auf den Holocaust.
Heute wissen wir, dass er damit faktisch falsch lag: Es gab Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo, wegen Völkermords wurde nie jemand auch nur angeklagt, geschweige denn verurteilt. Trotzdem: Fischer das vorzuwerfen, ist ähnlich ahistorisch wie der Vorwurf an Chamberlain, er hätte Hitlers Pläne vorausahnen und ihm entgegentreten müssen. Denn dass es im Kosovo keinen Völkermord geben würde, konnte Fischer damals noch nicht wissen.
Der entscheidende Punkt ist: Damals konnte man in gutem Glauben und den besten Absichten zwei entgegengesetzte moralische Schlussfolgerungen aus der Aufarbeitung des Dritten Reiches ziehen: nämlich Jugoslawien zu bombardieren und Jugoslawien nicht zu bombardieren. Heute ist es nicht anders: Wenn man Putins Russland mit der UdSSR verwechselt, kann man aus der Aufarbeitung der Verbrechen des Dritten Reiches den Schluss ziehen, Deutschland dürfe sich in einem Krieg „nie wieder“ gegen Russland stellen.
Das gleiche Argument funktionierte allerdings auch gegenüber der Ukraine, die ja innerhalb der UdSSR seit der Gründung der UNO formell eine souveräne Sowjetrepublik mit eigenem Sitz in der UNO war (ähnlich wie Belarus): Weil Hitlers Armeen auch die Ukraine angegriffen, aufgeteilt und mit einem Vernichtungskrieg überzogen haben, ergibt sich daraus, dass Deutschland heute moralisch verpflichtet ist, die Souveränität der Ukraine gegen Russland zu verteidigen. Und noch ein dritter Schluss ist möglich, ein ähnlicher wie 1999 in Bezug auf Jugoslawien: Dass Deutschland die Pflicht habe, sich herauszuhalten, weil Hitler vor 81 Jahren sowohl die Ukraine als auch Russland überfiel.
Mit anderen Worten: Der Lehrmeister Geschichte versagt hier vollkommen. Wer Geschichte als moralischen Leitfaden für politisches Handeln benutzen möchte, steht vor dem Dilemma, dass er damit sowohl die Ukraine als auch Russland und gleichzeitig keine der beiden Kriegsparteien unterstützen darf.
Geschichte als Selbstbedienungsladen
Wir können weder allgemein aus der Geschichte lernen, noch können wir etwas ganz Bestimmtes aus ihr lernen. Historiker, die gerne Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung nehmen wollen, werden es dennoch behaupten, denn es verleiht ihnen eine gewisse Deutungshoheit. Journalisten werden sie fragen, wie sie heutige politische Entscheidungen oder ihr Ausbleiben „aus historischer Perspektive“ beurteilen, vielleicht wird der eine oder andere Politiker sich bei ihnen Rat holen.
Der Rat, den so ein Politiker bekommt, wird immer ahistorisch sein. Angela Merkel können wir noch fragen, ob sie anders gehandelt hätte, hätte sie gewusst, dass Putins Russland am 24. Februar 2022 eine Invasion in der Ukraine beginnen würde. Wir bekommen nur keine Antwort. Chamberlain dagegen können wir nicht mehr fragen, ob er anders gehandelt hätte, hätte er gewusst, was nach München geschehen würde. Und ob er anders gehandelt hätte, hätte er gewusst, wie der Krieg, den er verhindern wollte, ausgehen würde. Wir müssen ihn anhand der Fakten beurteilen, die er selbst zur Verfügung hatte damals, und anhand der Bedingungen, die er zum Regieren vorfand.
Manche Historiker tun das, aber meist entstehen daraus keine Bestseller. Denn die Öffentlichkeit möchte aus der Geschichte lernen, sie verlangt danach, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Der Einwand, das sei unmöglich, ist schwer auszuhalten. Er würde bedeuten, dass sich die Menschheit womöglich gar nicht weiterentwickelt. Technologisch vielleicht, aber nicht sozial, politisch, kulturell. Stolpern wir womöglich ahnungslos und bildungsresistent durch die Evolution?
Die Frage ist schwer zu beantworten, aber sie zeigt des Pudels Kern: Wir lernen nicht aus der Geschichte, die Geschichte erteilt uns keine Lektionen, sondern wir bedienen uns aus der Geschichte wie in einem Selbstbedienungsladen. Wir sortieren aus, was unser derzeitiges Handeln und die Politik, die unserer Ansicht nach unsere Regierungen machen sollten, legitimiert.
Olaf Scholz beruft sich häufig darauf, er wolle einen „deutschen Sonderweg“ vermeiden. Die USA, Slowenien, Polen, Tschechien und Frankreich liefern schwere Waffen. Ist es ein Sonderweg, wenn Deutschland das auch tut, oder ist es einer, wenn Deutschland das bleiben lässt?
Die SPD-geführte Ostpolitik war weitgehend im deutschen Interesse; sie entspannte die Beziehungen zur DDR, der CSSR, zu Polen und der UdSSR, sie brachte Erleichterungen für durch die Mauer getrennte Familien. Sie beruhte auf einer Annäherung der Eliten und der apolitischen Bürger und vernachlässigte die Interessen der Oppositionellen und Dissidenten in den Warschauer-Pakt-Staaten.
Sie wird nicht dadurch falsch, dass Russland 2014 in die Ukraine einmarschierte und vorher die Halbinsel Krim annektierte. Richtig wird sie dadurch allerdings auch nicht. Und trotzdem bedienen sich beide – diejenigen, die jetzt ihre damalige Politik und ihre politischen Biographien verteidigen und diejenigen, die sie attackieren – eifrig aus dem Fundus historischer Versatzstücke, Zitate und Reden, die in ganz anderen Zusammenhängen entstanden sind.
Geschichte im Dienst der Tagespolitik
Das ist im Grunde nichts Neues, alle Gesellschaften tun das. Als in Ostmitteleuropa die EU-Beitritte näher rückten, zogen Historiker, Journalisten, Sachbuchautoren und Politiker los und gruben all jene Ereignisse, Denker, Staatsmänner (und manchmal auch -frauen) hervor, durch deren Exponieren man nachweisen konnte, dass Polen, Litauen, Kroatien, Tschechien „schon immer zu Europa“ gehört hatten, für europäische Integration gewesen waren und dass die nationale Geschichte geradezu zwangsläufig auf diesen Moment zulief. Was zu dieser pro-europäischen Meistererzählung nicht passte, wurde unter den Teppich gekehrt.
In Deutschland handelten solche Meistererzählungen meist davon, wie die deutsche Geschichte in der Westintegration (oder in der DDR im Sozialismus) kulminierte. Und in den letzten Jahren konzentrierte sie sich in Russland ganz auf das, was man heranziehen kann, um Russland als Imperium darzustellen.
Woran man erkennen kann, dass die Geschichte sowohl von Diktaturen als auch Demokratien wie ein Selbstbedienungsladen behandelt wird. Der Unterschied beruht nur darin, dass sich in einer Demokratie jeder daraus bedienen kann, während in Diktaturen die Regierung das Monopol darauf hat. Und es zeigt noch etwas anderes, nämlich dass die Art und Weise, wie eine Regierung mit der Vergangenheit ihres Landes umgeht, in erster Linie etwas über ihre Ziele und Werte aussagt, aber nichts darüber, wie diese Vergangenheit war.
Geschichte, wie sie nicht war
In der Regel ist das Bild, das sich aus den Arbeiten von Historikern ergibt, viel zu facettenreich, vieldeutig und moralisch unscharf, als dass es sich für eine politisch verwertbare Meistererzählung eignen würde. In diesen Meistererzählungen treten oft ganze Völker als Helden oder Bösewichter auf, und ihren Anführern wird vorgeworfen, ihre Entscheidungen nicht nach unseren zeitgenössischen Wertvorstellungen getroffen zu haben.
Empörte Demonstranten schleifen Standbilder bekannter Kolonialpolitiker und Militärs, weil diese in einer Zeit, in der fast die ganze Welt kolonialistisch und imperialistisch war, Kolonialisten und Imperialisten waren. Sachbuchautoren fragen sich, warum sich in einer Zeit grassierenden Antisemitismus so wenige Menschen für verfolgte Juden eingesetzt haben und warum in einer Diktatur, die jede Eigeninitiative mit Terror erstickte, so wenige Leute Zivilcourage zeigten.
Oft genug machen Historiker dieses Spiel mit. Wer versucht, die Vergangenheit unter Bezugnahme auf den damaligen Kontext und aufgrund der damals (und nicht heute) dominierenden Wertevorstellungen zu erklären, gerät schnell in den Verdacht, er wolle vergangene Untaten entschuldigen. Wer über das Fachpublikum hinaus gelesen werden will, tut gut daran, Werturteile zu fällen, die die Wertewelt des Publikums widerspiegeln – und nicht die vergangener Protagonisten. Und schließlich dient ein großer Teil der heutigen Geschichtsforschung auch zur Legitimierung der herrschenden politischen und sozialen Ordnung und ihrer Wertehierarchie.
Das war schon immer so, es war nur nicht immer so pluralistisch wie heute, weil die jeweilige Wertehierarchie früher meist verbindlicher war, als sie es heute ist. Das Paradox unserer liberaldemokratischen, pluralistischen Gesellschaften beruht gerade darin, dass selbst noch das In-Frage-Stellen dieser Wertehierarchie dazu beiträgt, sie zu legitimieren: Wer sie in Frage stellt, zeigt ja gerade, dass Dissens möglich ist und Pluralismus lebt.
Das genau ist eines der stärksten Argumente gegen die Annahme, aus der Geschichte ließen sich bestimmte Lehren für politische Entscheidungen im Hier und Jetzt ziehen: Denn wenn das möglich wäre, wie könnte man dann von diesen Lehren abweichende politische Entscheidungen noch rechtfertigen?
Das ist der Moment, an dem die Behauptung, aus der Geschichte könne man ganz konkrete Lehren für politisches Handeln im Hier und Jetzt ziehen, eine gegen Meinungsvielfalt und Debatte gerichtete Spitze bekommt, die es Historikern ermöglicht festzulegen, wer in der öffentlichen Debatte recht hat und wer nicht.
Deutschland sollte die Ukraine militärisch stärker unterstützen, weil die Sicherheit und Freiheit Deutschlands jetzt nicht mehr am Hindukusch, sondern im Donbass, in Odessa und Mariupol verteidigt werden, ohne dass deutsche Soldaten dafür selbst kämpfen müssten. Aber diese Forderung ergibt sich aus einer Analyse der aktuellen sicherheitspolitischen Lage, sie ist keine Lehre aus der Vergangenheit oder der deutschen Vergangenheitsbewältigung.
Mit Blick auf Timothy Snyder heißt das: Man kann auch auf einer falschen Grundlage zu richtigen Schlussfolgerungen kommen. Aber das macht die Grundlage deshalb nicht nachträglich richtig.
Klaus Bachmann ist Professor für Sozialwissenschaften an der SWPS Universität Warschau.