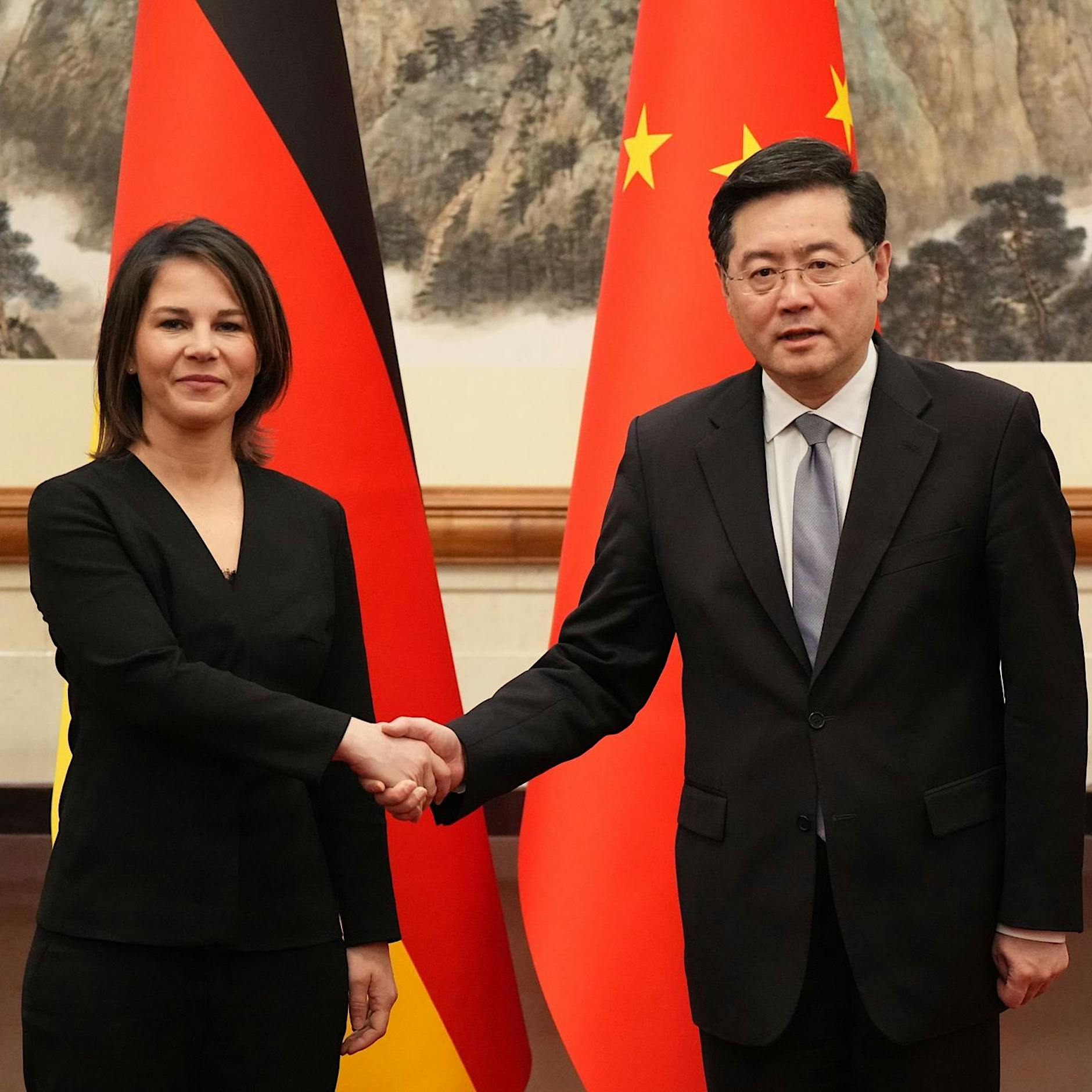Für die usbekisch-deutsche Beziehung ist es ein Meilenstein: Am Dienstag trifft der usbekische Staatspräsident Shavkat Mirziyoyev auf Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Präsident Mirziyoyev, der seit 2016 im Amt ist und sein Land seither modernisiert, will in Deutschland für eine vertiefte Zusammenarbeit werben.
Erst trifft er Bundeskanzler Olaf Scholz, später Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Usbeke hat einiges auf der Habenseite vorzuweisen. Denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine buhlt die ganze Welt um die Rohstoffe und die geopolitischen Einflusszonen in den zentralasiatischen Ländern. Die EU tut sich noch schwer damit, ihre Chancen wirklich zu ergreifen.
Mirziyoyev könnt bis 2040 Usbekistans Präsident sein
In den nächsten Tagen hätte die deutsche Bundesregierung die Gelegenheit dazu, die Usbeken näher an Europa heranzuziehen und Einflusssphären auszubauen. Auch Verbesserungen in der Demokratisierung des Landes könnten damit angestoßen werden. Ein Berater von Shavkat Mirziyoyev teilte vor dem Deutschland-Besuch des Präsidenten der Presse folgende Einschätzung mit: „Wir trauen den Deutschen vielleicht mehr zu, als die Deutschen sich selbst zutrauen.“
Ein Satz, der die Deutschen dazu auffordert, die ausgestreckte Hand auch anzunehmen. Der Moment wäre historisch. Schließlich kommt Shavkat Mirziyoyev zu einem Zeitpunkt nach Deutschland, der für Usbekistan wie eine Zäsur wirkt. Eigentlich müsste Mirziyoyevs Amtszeit 2026 enden. Doch ein kürzlich durchgeführtes Referendum für eine Verfassungsreform könnte seine Regentschaft um Jahrzehnte verlängern. Die Reform setzt sich zugleich zum Ziel, die Gesetze des Landes zu modernisieren, eine Trennung zwischen legislativer und exekutiver Gewalt zu vollstrecken und die Grundrechte der Bevölkerung zu stärken. Präsidenten sollen pro Kadenz sieben Jahre im Amt bleiben dürfen – für maximal zwei Legislaturperioden. Mirziyoyev dürfte bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2026 erneut antreten und wie jeder andere Kandidat bei einer Wiederwahl zwei Legislaturperioden im Amt bleiben dürfen. Käme es so, wäre er bis 2040 usbekischer Präsident. In dem Referendum stimmten nach offiziellen Angaben mehr als 90 Prozent der Wahlbeteiligten der Verfassungsreform zu. Damit wird Bundeskanzler Olaf Scholz auf einen selbstbewussten Präsidenten treffen, der Usbekistan lange prägen dürfte.
Auch wenn Mirziyoyevs Präsidentschaft und sein Referendum in Deutschland Kritik hervorrufen, kann niemand bestreiten, dass es ihm gelungen ist, sein Land im Eiltempo in die Zukunft zu führen: Regimekritiker wurden aus der Haft entlassen, Onlinemedien wurden liberalisiert, die Meinungsfreiheit ausgeweitet, die Freiheiten der Geheimpolizei eingeschränkt. Mirziyoyev sorgt für eine wirtschaftliche Öffnung und für einen rasanten Boom im Tourismus. Nun ist die Frage, wie Deutschland auf diese Reformen weiter reagiert. Sicher, es gibt noch viel zu tun. Die Meinungs- und Pressefreiheit in Usbekistan ist trotz der positiven Entwicklungen nicht auf europäischem Niveau. Um aber solche Defizite auszuräumen, braucht es Gespräche auf Augenhöhe. Der Westen muss erst einmal Mut zu einer Partnerschaft beweisen und die verblüffend positiven Prozesse in Usbekistan anerkennen. Etwa 30 Prozent beträgt das Handelsvolumen in Usbekistan mit der EU. Deutschland ist dabei der wichtigste Partner.
Wird Deutschland den usbekischen Kurs unterstützen?
Diese Entwicklung ist sowohl für die usbekische als auch für die deutsche Seite von enormer Bedeutung. Immerhin wächst die usbekische Bevölkerung rasant. Das Durchschnittsalter der 36 Millionen Usbeken liegt bei etwa 27 Jahren. So jung ist kaum eine Bevölkerung in Europa. Diese jungen Menschen suchen nach Arbeit, in der EU, aber auch in Deutschland. Von einer Zusammenarbeit würden also beide Seiten profitieren. Momentan ist der Westen noch skeptisch, ob Usbekistan den Liberalisierungsprozess weiter vorantreiben will. Die Verfassungsreform wird auch als Konsolidierung der persönlichen Macht von Mirziyoyev gewertet. Dessen Unterstützer weisen darauf hin, dass der Wille zur Demokratisierung mehr als ernst gemeint sei. Mit der Verfassungsreform wolle sich das Land zu Werten der Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit bekennen.
So beschreibt es Akramjon Nematov, Leiter einer Delegation von Experten usbekischer Denkfabriken. „Mirziyoyev kommt mit der Botschaft, dass wir es ernst meinen, wenn wir sagen, dass wir einen gerechten, humanen, säkularen Rechtsstaat aufbauen“, sagt er. Usbekistan ist im zentralasiatischen Vergleich ein Musterschüler. Das sagt auch die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer Analyse. Usbekistan setze wichtige Signale für eine politische Liberalisierung, auch wenn das Land nach wie vor an einem autoritären Präsidialsystem festhalte. Und dennoch: Die SWP sieht für Deutschland und Europa gute Gründe, den Reformkurs des Landes zu unterstützen. Jetzt ist die Frage, ob Deutschland die Zeichen der Zeit erkennt. Nur wer im Gespräch bleibt, kann Geschichte schreiben. Olaf Scholz hätte jetzt die Chance dazu.