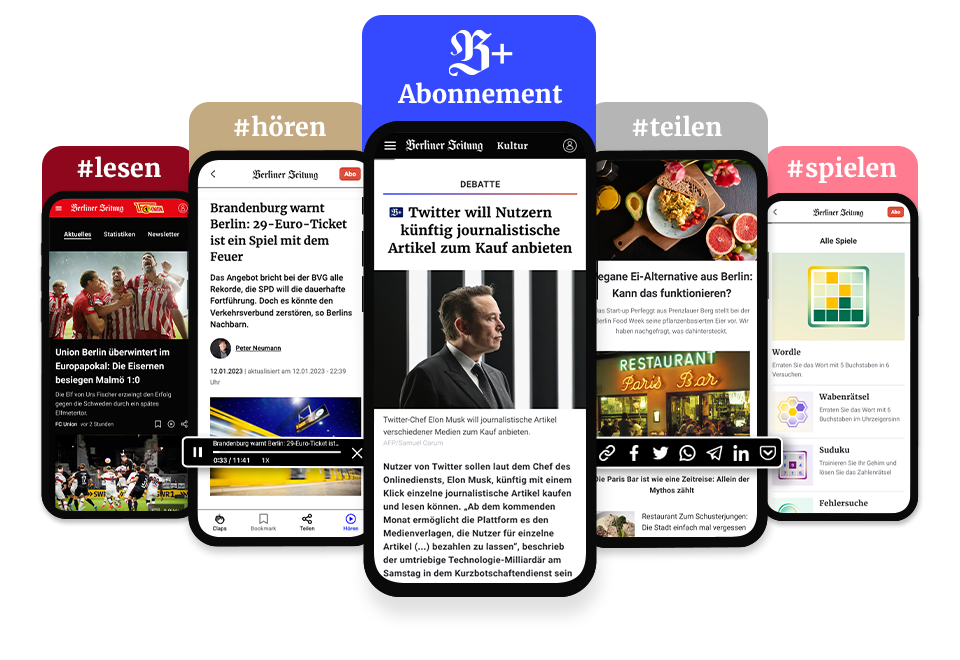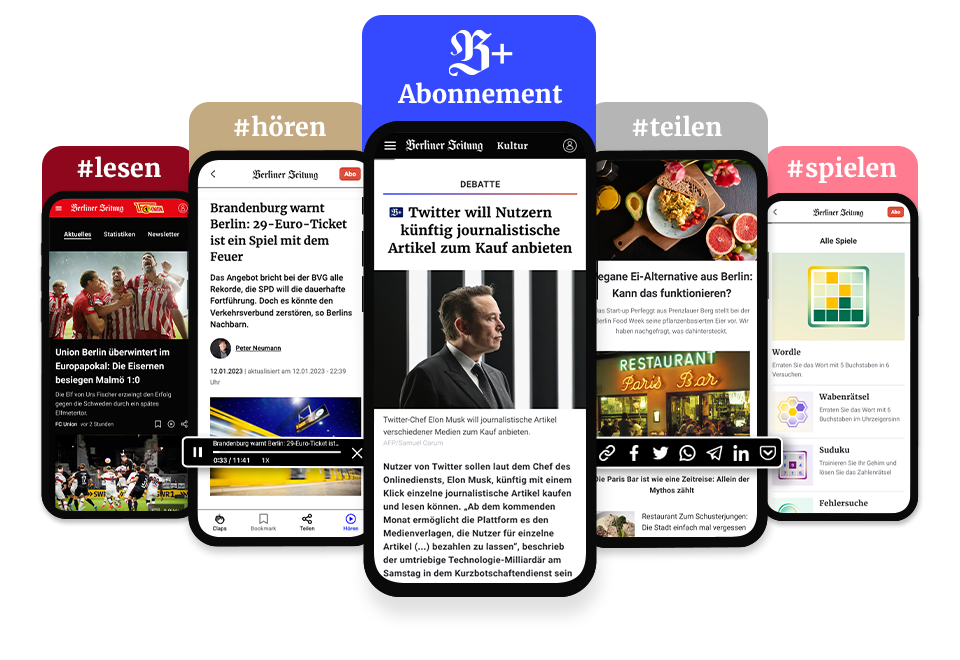
Mit einem Abo weiterlesen
- Zugriff auf alle B+ Inhalte
- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen
- Jederzeit kündbar
Die Bundesregierung fordert Rückführungen, verweigert aber jede Kooperation mit Kabul. Deutschlands Afghanistanpolitik basiert auf Illusionen. Eine Analyse.