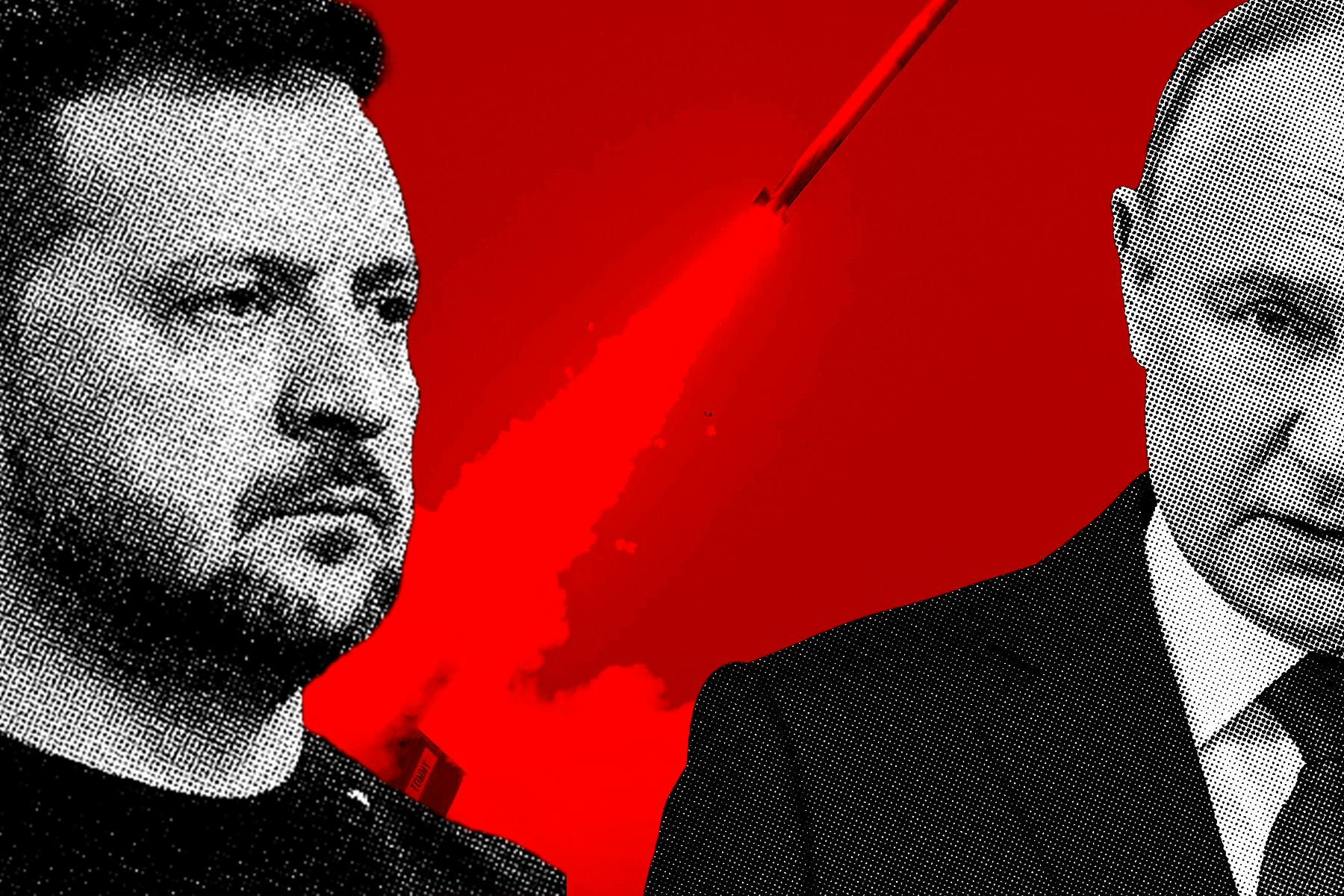Es ist elf Monate her, dass Adam Tooze, der in New York lehrende britische Wirtschaftshistoriker, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 25. März mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Diagnose abgab; sie betraf die Möglichkeit, dass der ukrainische Präsident Selenskyj ein Übereinkommen mit Russlands Putin schließen könne, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. „Jeder Kompromiss wird dreckig sein“, äußerte Tooze, es werde „für keine Seite einen Sieg zu vermelden geben, der das Opfer Zehntausender rechtfertigt. Wenn ein Verhandlungsergebnis in jedem Fall eine moralische Erniedrigung sein wird, ist Weiterkämpfen die gesichtswahrende Option.“
Auch, wenn die Opfer, über deren Zahl beide Kriegsparteien ein bezeichnendes Stillschweigen wahren (sie geht weit über Hunderttausend), ohne Aussicht auf ein Ende immer weiter zunehmen? Wenn es zu einem „Deal mit Putin“ käme, so Adam Tooze, wäre das „ein gefundenes Fressen“ für die ukrainische Opposition. Sie werde Selenskyj „kaputtmachen“, und das könne „durchaus im Wortsinne passieren“. „Beim Vertrag von Versailles, bei der Trennung Irlands, in Israel bei den Oslo-Verträgen: Politiker, die Verantwortung übernehmen und ein Abkommen mit dem Gegner eingehen, befestigen eine Zielscheibe auf ihrer Brust.“
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Das gilt heute wie im März 2023. Der ukrainische Staatschef, kein gelernter Politiker, sondern ein begabter Schauspieler, den ein demokratischer Akt an die Spitze des Staates berief, würde sich in Lebensgefahr begeben, wenn er politische Folgerungen aus dem Scheitern der ukrainischen Offensive des Vorjahrs zöge. Selenskyjs fortgesetzter Versuch, sich seines Oberkommandierenden Saluschnyj zu entledigen, galt einem Mann, der die militärische Situation realistisch einschätzt und, um dem Gehör zu verschaffen, keinen andern Weg fand als ein Interview mit der britischen Zeitung Economist. Dass an der Front eine Pattsituation eingetreten sei und die Armee dringend neue Soldaten brauche, war im November der Befund dessen, der es am besten wissen musste.
Der General wehrte sich gegen seine Entlassung, und eine Zeitlang war keiner der für seine Nachfolge infrage kommenden Kommandeure bereit, das Amt zu übernehmen; ein anderer Widerstand gegen seine Absetzung kam aus Washington. Ist nun die Absetzung Saluschnyjs vollzogen, so öffnen sich Perspektiven einer politischen Alternative; früher oder später könnte der Volksgeneral, wie dieser in der Ukraine genannt wird, als Nachfolger Selenskyjs die Geschicke des Landes in die Hand nehmen und hätte im Präsidentenamt durch seine militärischen Erfolge in der ersten Phase des Krieges einen entscheidenden Autoritätsvorsprung, um Verhandlungen mit der russischen Seite einzuleiten. Wie dringlich sie sind, gibt die Personalsituation der Armee zu erkennen.
„Je verzweifelter die militärische Lage der Ukraine wird“, resümierte Sonja Zekri am 3. Februar 2024 in der Süddeutschen Zeitung, „desto härter mobilisiert auch der Staat.“ Eine halbe Million neue Soldaten forderte die militärische Führung im Dezember, um die Männer an der Front endlich zu entlasten, um die Front überhaupt zu halten. Ein neues Gesetz wollte auch Kranke und Strafgefangene einberufen; dass auch Sechzigjährige einrücken sollen, ruft in Deutschland Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs wach.

Aggressive Opposition in der Ukraine
Wer das politische Lager ist, dessen Aggressivität ein Präsident im Fall ernsthafter Waffenstillstandsverhandlungen zu fürchten hätte, ist unschwer auszumachen: es sind radikalnationalistische Formationen, die man unter dem Namen des „rechten Sektors“ (Prawyj Sektor) und der Banderisten kennt, die sich nach jenem profaschistischen ukrainischen Politiker Stepan Bandera nennen, der in der postsowjetischen Ukraine in hohem Ansehen steht; einen Abgesandten dieser Richtung hatte Deutschland einige Monate lang als provokativen Diplomaten zu ertragen. Dass die außerhalb der ukrainischen Armee operierenden Freiwilligenverbände großen Anteil daran hatten, dass an der Grenzlinie zu den 2014 von Russland eingenommenen Gebieten Donezk und Luhansk nach den Minsker Abkommen keine Waffenruhe eintrat, ist unbestritten; weniger bekannt ist, mit wie massivem Protest diese innere Front den Präsidenten Selenskyj in Kiew empfing, nachdem dieser im Dezember 2019 in Paris mit Macron, Merkel und Putin konferiert hatte und zu positiven Ergebnissen gekommen war: Waffenruhe, Gefangenaustausch, Pufferzone.
Wie eng es um Selenskyjs politischen Spielraum steht, zeigte sich auch daran, dass das Erscheinen des Brexit-Premiers Johnson Anfang April 2023 in Kiew, mit umfassenden Hilfsangeboten auch der USA, die ukrainische Führung dazu bewog, Verhandlungen mit der russischen Seite abzubrechen, die hoffnungsvoll begonnen hatten. Selenskyj schien damals bereit, auf den Nato-Beitritt seines Landes zu verzichten, den die Ukraine nach dem Staatsstreich von 2014 als unverrückbare Absicht in ihre Verfassung geschrieben hatte.
Wie geht es weiter mit diesem Krieg, dessen Frontverlauf nun schon ein Jahr lang auf einer Länge von tausend Kilometern unter hohen gegenseitigen Opfern stagniert und der, je länger er dauert, wachsende Eskalationsgefahren mit sich bringt? Die Ukraine selbst und ganz Europa sind durch die Fortsetzung einer immer neue Blutopfer fordernden Lage bedroht; die USA, die schon durch ihre geografische Lage sichergestellte Weltmacht, wären es selbst dann nicht, wenn ein in die Enge getriebenes Russland, in dem einflussreiche Kommentatoren dazu raten, das Erstschlagsverbot der russischen Nukleardoktrin aufzugeben, zu der Ultima Ratio taktischer Atomwaffen griffe.
Auch die Nato-Staaten England und Frankreich sind durch atomare Bewaffnung geschützt – es ist Deutschland, das, wie schon in Zeiten des Kalten Krieges, mehr als andere gefährdet ist. Angesichts der enormen Hilfsleistungen, die es auf allen Gebieten für die überfallene Ukraine erbringt, sollte es sich als besonders verpflichtet erkennen, Wege zu einem Waffenstillstand zu erkunden. Tut die Bundesregierung dies im Stillen? Können wir die eigenartige Tatsache, dass in dem öffentlichen Gespräch des Regierungschefs mit einer politisch wachen Autorin nur mit einem Nebensatz von dem Krieg die Rede war, der auf Europa lastet, dahingehend deuten? Oder war diese Tonlosigkeit nur ein Indiz von Rat- und Tatlosigkeit?
Wenn sich, wofür vieles spricht, der ukrainische Präsident in der Abhängigkeit ultranationalistischer Kräfte befindet, so sollten die mit der Ukraine solidarischen Mächte alles daran setzen, nicht ihrerseits und mittelbar in eine solche Gefangenschaft zu geraten. Der Widerstand, den die US-Administration der Absetzung Saluschnyjs entgegensetzte, war ein Zeichen dafür, dass man in Washington diese Gefahr erkannt hat; auch die deutsche Regierung sollte ihrer inne sein. Denn die unbegrenzte Fortsetzung eines festgefahrenen Krieges unter Aufbietung immer stärkerer Reserven, von denen die russischen von der Beschaffenheit beider Länder her sehr viel größer als die ukrainischen sind, kann nicht im deutschen Interesse liegen.
So groß die Genugtuung war, mit der die deutsche Bevölkerung den Widerstand aufnahm, mit dem die Ukraine Putins auf die Eroberung des ganzen Landes zielende Pläne zunichtemachte: Deutschland als ein Land, das der Ukraine allseitige Hilfe gewährt (dass die unbegrenzte Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge die Wohnungsnot einheimischer Erwerbstätiger wie Arbeitsloser vielerorts dramatisch zuspitzt, wird wenig reflektiert), ist nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, Wege zu einem Stillstand offensichtlich aussichtsloser, aber eben darum eskalationsgefährdeter Kämpfe zu bahnen.

Der lange Weg zur Schlussakte von Helsinki
Für die Erkundung von Wegen zur Beilegung bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen Positionen von deutlicher Unversöhnlichkeit hält die neuere europäische Geschichte einige markante Erfahrungen bereit, jeweils mit schmerzhaften Gebietsverlusten verbundene Beispiele für den Umgang mit Antagonismen, deren Anlässe mit dem Ende der militärischen Konfrontation nicht verschwanden, aber eingefroren, stillgestellt oder befriedet werden konnten.
Das erste Beispiel liefert der sowjetisch-finnische Winterkrieg von 1939/40. Das finnische Volk, vier Millionen Einwohner auf einer Fläche, größer als das heutige Deutschland, hatte sich als Bestandteil des alten russischen Reiches ein hohes Maß an politischer und kultureller Eigenständigkeit sichern können, was es nicht davor bewahrte, nach Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit beim Ende des Zarenreichs eine Explosion seiner inneren Klassengegensätze zu erleben. Ein opferreicher Bürgerkrieg zwischen Weißen und Roten, nationalistischem Bürgertum und emanzipatorischem Proletariat endete mit dem Sieg der Weißen, die fortan die auf tausend Grenzkilometern benachbarte Sowjetrepublik mit territorialen Forderungen irritierten. Die Sorge, im Kriegsfall an dieser Grenze ungeschützt dazustehen, war gegenseitig und wurde 1933 durch einen Nichtangriffspakt beigelegt, den die Sowjetunion aufkündigte, nachdem Hitlers Pakt mit Stalin ihr nicht nur das Baltikum, sondern auch Finnland als Einflussgebiet freigegeben hatte.
Im November 1939 drangen sowjetische Truppen in Finnland in der Erwartung ein, das Land mit seiner Hauptstadt binnen kurzem einnehmen zu können; sie scheiterten an einem militärischen Widerstand, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Schlecht bewaffnet, ungenügend ausgerüstet und mit viel zu wenig Soldaten hielt die unter dem Druck drohender Unterwerfung zusammenstehende finnische Nation dem Angriff eines in jeder Hinsicht überlegenen Gegners stand. In Carl Gustaf Mannerheim, dem finnischen Oberkommandierenden, einem der nationalen Rechten angehörender Mann, besaß sie einen Führer von ebenso großer Weitsicht wie Autorität, der erkannte, dass der Sieg über den Angreifer, der aus seinen strategischen Fehlern gelernt hatte und neue Truppen unter neuen Kommandeuren ins Feld führte, nicht von Dauer sein konnte.
Vor die Alternative gestellt, den ganzen Staat dem übermächtigen Angreifer preiszugeben oder einige strategisch wichtige Gebiete im Vorfeld Leningrads an die Sowjetunion abzutreten, wählte er das letztere. Nach wochenlangen Verhandlungen beendete im März 1940 ein Friedensvertrag die Kampfhandlungen; zuvor hatte Stalins Sowjetunion die von ihr im Osten Finnlands etablierte kommunistische Regierung fallengelassen; sie beschränkte sich darauf, die gewonnenen ostfinnischen Gebiete in eine eigene kleine Sowjetrepublik zu verwandeln.
Die Analogien zu der derzeitigen ukrainisch-russischen Situation springen ins Auge, aber die Geschichte muss noch ein Stück weiterverfolgt werden. Denn das von Mannerheim dominierte Finnland kassierte den Friedensvertrag mit der Sowjetunion nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und nahm die abgetretenen Gebiete samt einigen anderen, schon früher beanspruchten wieder ein, bis zum September 1944, als die finnische Regierung sich angesichts der sich abzeichnenden deutschen Niederlage zu neuen Verhandlungen mit der Sowjetunion entschloss; sie führten zu einem Vertrag, der mit der zusätzlichen Abtretung finnischer Grenzgebiete den alten Friedensvertrag wieder in Kraft setzte.
Die kurzfristige Folge war die Vertreibung deutscher Truppen aus Finnland, die langfristige Folge war die Stabilisierung Finnlands als eines militärisch neutralen, bürgerlich-demokratischen Staates, der dann über viele Jahrzehnte hinweg eine politische Brückenfunktion zwischen den Europa zerreißenden Militärblöcken wahrnahm. Nicht zufällig war Helsinki der Ort, an dem die den Kalten Krieg eindämmende Schlussakte von Helsinki 1975 unterzeichnet wurde.
Der Fall des Eisernen Vorhangs
Das zweite Beispiel für das vertraglich befestigte Stillstellen eines Antagonismus, bei dem sich in der Mitte Europas zwei Weltmächte konfrontativ gegenüberstanden, bietet Deutschland selbst, das, bei schwerwiegenden Gebietsverlusten, nach dem 2. Weltkrieg erst vier-, dann zweigeteilt worden war, in eine große amerikanisch und eine kleine sowjetisch dominierte Republik, die von ihren Vormächten dazu verurteilt waren, keine erfolgversprechende politische Annäherung zu unternehmen.
Als Walter Ulbricht bei Leonid Breschnew 1971 in den Verdacht geriet, eine solche Annäherung zu begünstigen, wurde er durch eine von dem Sowjetführer bestellte Verschwörung innerhalb seiner eigenen Partei abgesetzt und durch einen Nachfolger ersetzt, der einem ähnlichen Schicksal zu entgehen wusste; vergeblich denunzierte ihn in den achtziger Jahren eine Fronde innerhalb des Politbüros bei der Sowjetführung wegen seiner Nachgiebigkeit gegenüber der deutschen Westrepublik.
Das Ende vom Lied: Die beiden Staaten, in inniger Feindschaft einander verbunden, verfielen durch sowjetisch-amerikanischen Ratschluss einer gemeinsamen, obschon asymmetrischen Auflösung, die den Namen einer Wiedervereinigung annahm und mit der späten Notifikation schwerwiegender Gebietsverluste verbunden war. Dass die wirtschaftlichen, kulturellen und vor allem menschlichen Kontakte zwischen beiden Landesteilen trotz zeitweise drastischer Behinderungen erhalten geblieben waren, gehörte zu den entscheidenden Voraussetzungen einer solchen Lösung. Anders wirksam war dabei das Festhalten der beiden beteiligten Weltmächte an den Abmachungen, die sie 1945 getroffen hatten, um zu verhindern, dass sie sich in Europa kriegsträchtig ins Gehege kämen.
Friedfertig, aber unbefriedet - der Fall Zypern
Das dritte Beispiel ragt in die Gegenwart hinein, hier hat der Antagonismus nicht zu einem Friedensschluss geführt. Stattdessen: ein jahrzehntelanger Waffenstillstand zwischen zwei Nationalitäten, die sich inzwischen friedfertig, aber immer noch unbefriedet gegenüberstehen: Griechen und Türken auf der Mittelmeerinsel Zypern, die, überwiegend griechisch besiedelt, aber mit türkischen Enklaven in vielen Teilen der Insel, 1960 ihre Unabhängigkeit von der seit 1878 bestehenden britischen Herrschaft erlangte. Bestrebungen zur „Enosis“, der Vereinigung mit Griechenland, und der Widerstand der türkischen Bevölkerung dagegen waren bei der Staatsgründung von einer Verfassung aufgefangen worden, die den Vertretern beider Nationalitäten Vetorechte in der von dem Griechen Makarios geleiteten Regierung einräumten.
Drei Jahre später zerbrach das Modell, und 1974 unterstützte die inzwischen in Athen regierende Militärjunta den Versuch radikaler griechisch-zyprischer Gruppen, durch den Sturz der Regierung Makarios die Vereinigung mit Griechenland zu erzwingen. Die türkische Reaktion ließ nicht auf sich warten: In zwei Wellen besetzte die türkische Armee den nördlichen, etwa ein Drittel des Gesamtgebiets umfassenden Teil der Insel und rief dort 1983 die Türkische Republik Nordzypern aus, die bis heute allein durch die Türkei anerkannt wird.
Die Besetzung des Nordens war von der Vertreibung der griechischen Einwohner begleitet gewesen, mit entsprechenden Reaktionen auf der griechischen Seite; die Mitwirkung der UN führte zur militärischen Sicherung der Grenze in Gestalt einer 180 km langen Pufferzone, Grüne Linie genannt, die mit wenigen Durchgängen nach wie vor auch die Hauptstadt Nikosia durchschneidet. Ein sorgfältig ausgehandelter Vertrag, der auf die Wiederherstellung eines paritätisch-einheitlichen Staates zielte, scheiterte 2004 bei einer Volksabstimmung am Widerstand der griechischen Bevölkerung; es blieb bei einer Situation, die in mancher Hinsicht der des geteilten Deutschlands bis zum Jahr 1990 gleicht.
Vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen
Kann man den türkisch eingenommenen Nordteil Zyperns oder die an die Sowjetunion abgetretenen Teile Finnlands mit dem russisch eingenommenen der Ukraine vergleichen? Vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen; es hält dazu an, Parallelen ebenso wie Unterschiede wahrzunehmen und aus beidem Schlüsse zu ziehen, die auf die Behebbarkeit scheinbar unüberwindbarer Konflikte zielen. Voraussetzung dafür ist das Schweigen der Waffen. Darauf hinzuwirken, ist das Gebot der Stunde.
Dass ein solcher Schritt der Absicherung durch mittelbar beteiligte Großmächte wie die USA, die EU und China bedarf, liegt auf der Hand. Die Richtung, die ein Waffenstillstand vorbereiten könnte, hat der hundertjährige Kissinger im April 2023 gewiesen: Teilung des sprachlich gespaltenen Landes in einen kleinen russisch dominierten Ost- und einen großen, an die Nato anzubindenden Westteil.
Andrij Jermak, der Chef der ukrainischen Präsidialkanzlei, hat laut Sonja Zekri (SZ vom 8. 9. 2023) ähnliche Vorstellungen geäußert, auch mit Bezug auf das deutsche Teilungsschicksal. Johannes Varwick, Politologe an der Hallenser Universität, stellte eine solche Lösung infrage: Garantien für die Ukraine, schrieb er am 16. Mai 2023 in der FAZ, dürften „nicht als Nato-Beitritt durch die Hintertür interpretierbar sein, wenn sie für Russland akzeptabel sein sollen“.
Das war vor der ukrainischen Offensive gesagt; es ist durch deren Scheitern nicht entkräftet. Wird der amerikanische Präsident im Vorfeld des bevorstehenden Wahlkampfs sich zu einem nicht bloß propagandistischen Friedensplan für die Ukraine verstehen? Die deutsche Regierung sollte ihn darin bestärken. Besser noch: Sie sollte einer Situation, in der beide Seiten, die ukrainische und die russische, immer noch die Durchsetzung ihrer Maximalforderungen verkünden und ein in den Bundestag gewählter Bundeswehroberst der Reserve davon träumt, dass die Ukrainer mit deutschen Waffen russisches Territorium angreifen, rationale Überlegungen zu einem Waffenstillstand vorlegen.