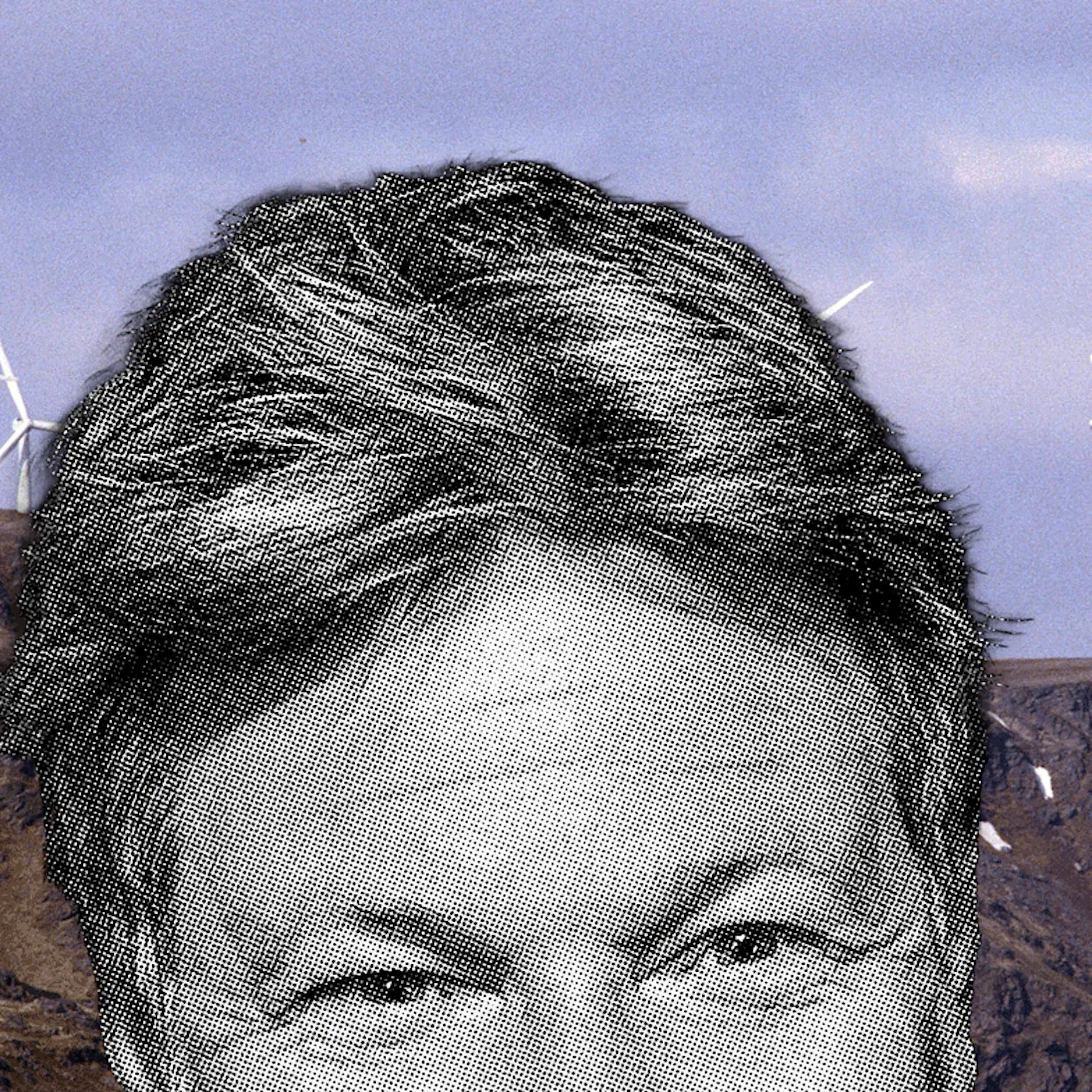Wird Habecks Wärmewende die Stromnetze überlasten? 77 Fragen hat die FDP dem Wirtschaftsminister zu seinem umstrittenen Heiz-Gesetz gestellt, darunter zu den Auswirkungen der vielen Wärmepumpen auf die Stromnetze. Denn bis 2030 sollten aus knapp über einer Million Geräte im Moment sechs Millionen werden.
Insbesondere an sehr kalten Tagen seien die Geräte „ein Doppelschlag für das Stromnetz“, warnte vorher der Chef der Stadtwerke München, Florian Bieberbach. „Wenn weiter sehr viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln“, mahnte seinerseits der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, im Januar.
Habecks Wirtschaftsministerium: Anteil von Wärmepumpen am Stromverbrauch bis 2030 nicht mal bei fünf Prozent
Nun ist Habeck auf das Thema eingegangen. Solche Warnungen sind aus Sicht des Wirtschafts- sowie des Bauministeriums von Klara Geywitz (SPD) unbegründet, zitiert das Handelsblatt aus den Antworten der Ministerien auf den FDP-Fragenkatalog. „Der zusätzliche Stromverbrauch von Wärmepumpen ist aufgrund der hohen Effizienz von Wärmepumpen, die insbesondere Umgebungswärme aus der Luft, dem Erdreich oder Wasser nutzen, gering.“ Die fünf Millionen neuen Wärmepumpen, die bis 2030 entstehen sollten, würden zudem nach der Berechnung der Ministerien weniger als 30 Terawattstunden (TWh) Strom benötigen: Das entspreche nicht mal fünf Prozent des Stromverbrauchs im Jahr 2030, heißt es.
Wie lässt sich das einordnen? Der Stromverbrauch, oder die Nutzlast, hat 2022 insgesamt 484,2 Terawattstunden betragen. Bis 2030 muss dieser laut der letzten Prognose der Bundesregierung auf 750 Terawattstunden steigen. Das ist ein Plus von über 37 Prozent. Man könnte die Habeck-Einschätzung wohl unwidersprochen hinnehmen und sich entspannt zurücklehnen, aber es gibt einen weiteren Haken: Nach dem Energiewirtschaftsgesetz könnte der Stromverbrauch verbrauchernaher Geräte gedrosselt werden. Wärmepumpen sollten zudem nur dann gefördert werden, wenn sie über eine Schnittstelle verfügen, womit sie ferngesteuert vom Stromnetz teils abgekoppelt werden können. Die Bauingeneurin Lamia Messari-Becker hat es in einem am Montag erscheinenden Interview mit der Berliner Zeitung bemängelt.
Ihr Vorwurf: Die Wärmewende wird von Habeck zu sehr auf Strom fokussiert und zu wenig diversifiziert gestaltet, es folgt die selbstverursachte Verknappung. Wozu diese Schnittstelle bei Wärmepumpen also, wenn angeblich keine Überlastung der Netze droht?
Habecks Wärmewende und Netze: „Beträchtlich höhere Bezugsleistungen in der Niederspannung“, aber…
Wir haben beim Wirtschaftsministerium direkt nachgefragt, warum es die Befürchtungen von so vielen Fachleuten, aber auch Normalverbrauchern so entschlossen ablehnt. Es stellt sich schnell heraus: Das Wirtschaftsministerium setzt auf den nötigen Ausbau der Verteilnetze genauso wie auf die Erhöhung der Stromproduktion in Deutschland. „Der absehbare Hochlauf insbesondere von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen erfordert gut gerüstete Stromverteilernetze. Ein zeitnaher und vorausschauender Ausbau der Verteilernetze ist daher unerlässlich“, antwortet ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. Man solle die Mahnung des Bundesnetzagentur-Chefs Müller im Januar zudem als eine Aufforderung an die Verteilnetzbetreiber verstehen, den nötigen Ausbau der Netze voranzutreiben.
Die Bundesnetzagentur berichtet aktuell über den Umbau des Stromsystems bis 2031. Ein Kohleausstieg bis 2030 wird angenommen, wie die Ampel schon in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen hatte. Zugleich gibt die Bundesnetzagentur an, private Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen würden teilweise in den jeweiligen lokalen Netzen „beträchtlich höhere Bezugsleistungen in der Niederspannung“ bedeuten. Zudem sei mit einer deutlich höheren gleichzeitigen Netznutzung zu rechnen. Das wäre ein Szenario für die Zukunft, wenn man die Netze nicht ausbauen würde. Das Gegenteil sei aber der Plan.
Netze zu schwach? „Das Thema wird so verkauft, als stünden wir vor einem Zusammenbruch“
Warum soll aber der Stromverbrauch der Wärmepumpen gedrosselt werden? Die Schlussfolgerung, die Geräte wären damit vom Stromnetz abgekoppelt, bewertet der Ministeriumssprecher als missverständlich. Niemand werde im wahrsten Sinne des Wortes abgekoppelt, erklärt der Sprecher. Nur wenn der Verbraucher vorher zustimme, könne er eine niedrigere Leistung aus den Stromleitungen bekommen. Die Privathaushalte werde die Regelung zudem nicht betreffen; die Ladesäulen wären eher dran. Und trotzdem werde das Thema jetzt so verkauft, als stünden wir vor einem Zusammenbruch, kritisiert der Mann. Jegliche Mahnungen seien lediglich dafür da, um Druck zu machen.
Lokale Netzbetreiber gehen derzeit von mehr als einer Verdoppelung des Stromverbrauchs in Deutschland bis 2045 wegen der Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors aus. Dieser steigende Verbrauch sei in den aktuellen Ausbauplanungen im Rahmen des Netzentwicklungsplans 2037/45 für das Übertragungsnetz berücksichtigt, teilt ein Sprecher des Berliner Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz Transmission auf Anfrage mit. Auch das Berliner Stromnetz werde künftig „sehr klug planen, investieren und rechtzeitig bauen müssen“, um den Anspruch der Kunden auf einen Netzanschluss zu erfüllen, sagte der Geschäftsführer Erik Landeck zuletzt auf dem Jahrespressegespräch. Der Eindruck wird gefördert, alles laufe nach Plan.
Netzausbau in Deutschland: Fehlende Anschlüsse und weggeschmissener Strom
Laut dem Ausbauszenario des Netzentwicklungsplans Strom 2013 müssen die Übertragungsnetzbetreiber zur erfolgreichen Integration erneuerbarer Energien bis 2032 neue Stromleitungen mit einer Länge von rund 145.0000 Kilometer verlegen. Die Bundesländer schätzen den nötigen Ausbau ihrerseits schon auf knapp 280.000 Kilometer ein. Die Klimaziele der Bundesregierung haben sich seither nur verschärft, und der prognostizierte Stromverbrauch ist deutlich gestiegen. Wie schnell müssen die Bauarbeiter den Ausbau anpacken?