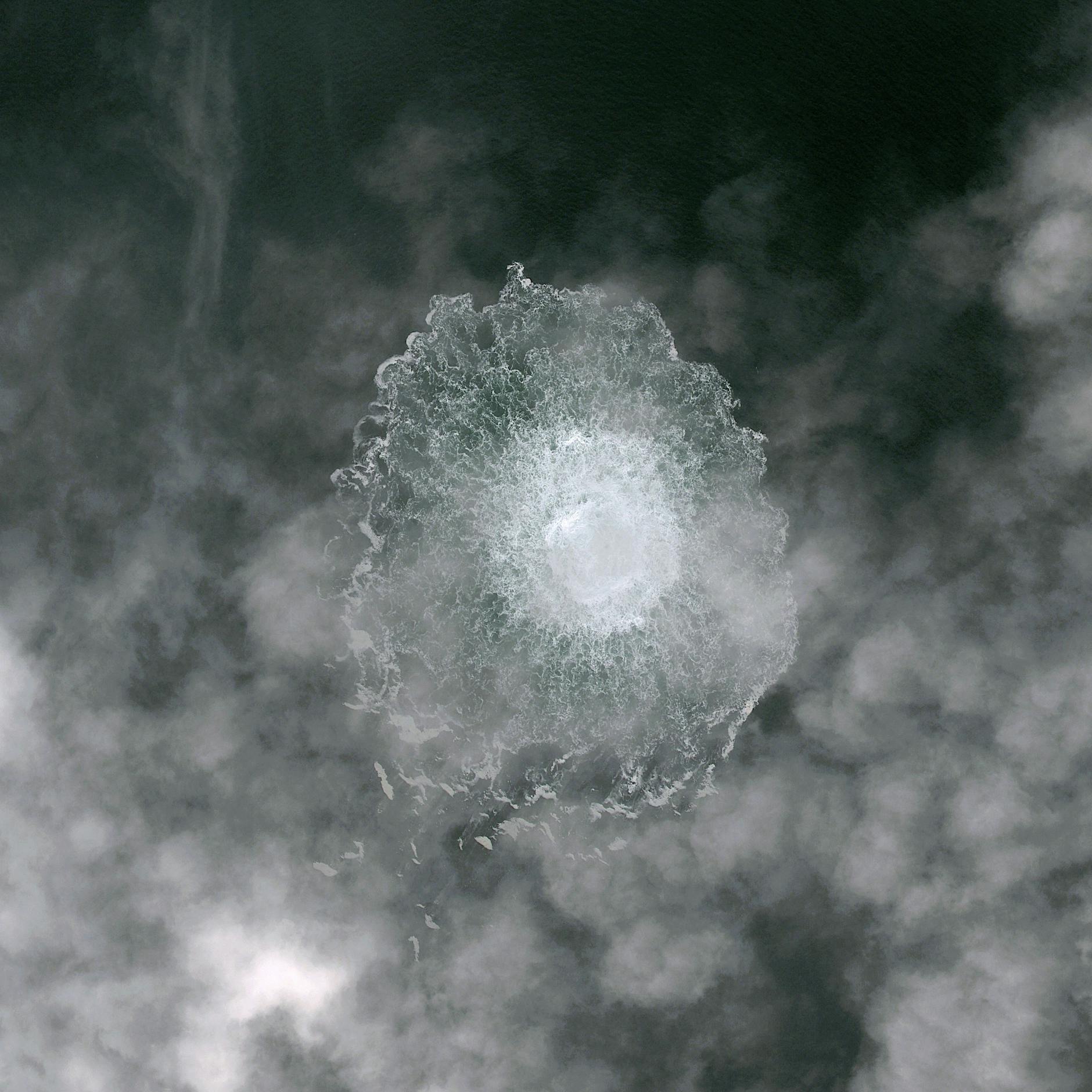Wenn ich Historiker wäre, dann würde ich tun, was Historiker höchst selten tun: Ich würde fragen, welche Parolen im Lauf der Geschichte immer wieder und oft über längere Zeiträume die politischen Auseinandersetzungen bestimmt und eine Rolle für die Wahlchancen gespielt haben. In Deutschland prägten Bundesrepublik und DDR jeweils eigene Parolen – ein gemeinsamer Kanon existiert nicht.
Ich bin im Westen aufgewachsen. Deshalb erinnere ich mich an die dortige Entwicklung und berichte von den Parolen, die nach meiner Erinnerung bei uns im Westen eine bemerkenswerte Rolle gespielt haben. Diese haben übrigens auch für die Menschen in der DDR ihre oft kritische Wirkung entfaltet.
„Wohlstand für alle“
Es gab für den innenpolitischen Teil des Geschehens, also für das wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Leben und Treiben, und für den außen- und sicherheitspolitischen Teil immer wieder verschiedene Losungen.
„Wohlstand für alle“ war zum Beispiel eine der gängigen und wirksamen Parolen für die Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Ein 1957 erschienenes Buch des damaligen Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard hatte den Titel „Wohlstand für alle“.
Auch die ebenfalls im Bundestagswahlkampf 1957 verwendete Parole „Keine Experimente“ hatte eine gravierende Bedeutung. Es war eine Art Stoppschild für durchaus notwendige Reformen in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Dass die Union 1957 die absolute Mehrheit der Sitze im Deutschen Bundestag erreichte, zeigt zumindest, dass die beiden erwähnten politischen Botschaften eine gewisse Wirkung entfaltet hatten.
Für den außen- und sicherheitspolitischen Teil will ich auflisten, was nach meiner Erinnerung im Ablauf des Geschehens eine große propagandistische und zugleich die Politik prägende Rolle spielte.

Zuvor arbeitete er als Wahlkampfstratege der SPD, später als Bundestagsabgeordneter.
Heute ist er als Publizist tätig und Herausgeber der Internetplattform „NachDenkSeiten“.
„Nie wieder Krieg“: Das galt in der Zeit unmittelbar nach 1945 und war in vieler Munde. Mit der Umsetzung dieser Parole hätten wir übrigens bis heute leben können.
Unmittelbar nach dem Ende der Naziherrschaft war in Kreisen, die mit der NSDAP verbandelt waren, die Parole „Nie wieder Parteien“ zu hören. Das war für eine kurze Zeitspanne so etwas wie die kostengünstige Entschuldigung für den Beitritt zur NSDAP.
Der Strudel des Ost-West-Konfliktes
Gleich zu Beginn der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts geriet die Auseinandersetzung zwischen den Parteien in der Bundesrepublik in den Strudel des Ost-West-Konfliktes: „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“. Das war des damaligen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Adenauer bemerkenswerter Spruch in der Auseinandersetzung mit der SPD.
Der Begriff Marxismus bezog sich nämlich unterschwellig auf die Sozialdemokraten, obwohl sie auch damals schon weit weg waren von einer Anlehnung an Marx, Engels und Lenin. Konrad Adenauer ließ seinen Spruch in Kombination mit der Abbildung eines bedrohlich dreinschauenden Sowjetsoldaten an die Litfaßsäulen kleben. Er hat mit dieser Parole die sogenannte Wiederbewaffnung West-Deutschlands begleitet und betrieben.
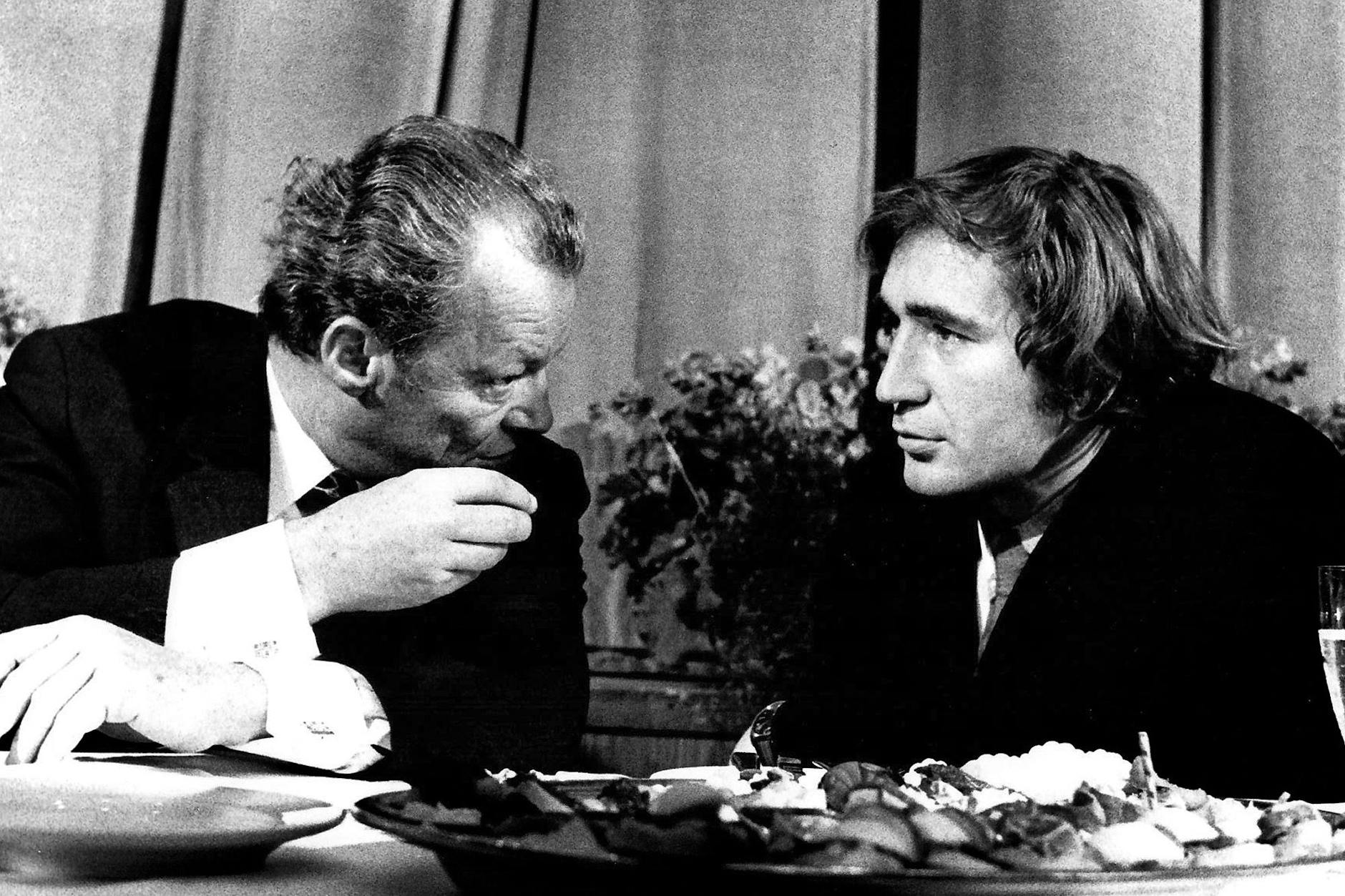
Sie war Teil der massiven Propaganda von CDU und CSU, die – ergänzt um das schon erwähnte „Keine Experimente“ – diesen Parteien dann 1957 die absolute Mehrheit der Sitze und der Zweitstimmen im Deutschen Bundestag bescherte. Diese Art von Propaganda hat auch wesentlich dazu beigetragen, Europa in zwei Blöcke zu teilen, verbunden mit einer tiefen Feindschaft gegenüber der Sowjetunion und den anderen Staaten Ost- und Mitteleuropas.
Ende der Fünfzigerjahre gab es in der Sache und emotional keine tragfähige Brücke mehr zwischen West und Ost. Die Trennung eskalierte mit dem Mauerbau im August 1961. Aber schon Ende der Fünfzigerjahre hatte der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, einen Kreis von Menschen um sich geschart, in dem über den Abbau der Spannungen und der Trennung nachgedacht wurde.
Diese Information habe ich von Horst Grabert, der zu diesem Kreis gehörte und später Chef des Bundeskanzleramtes und damit auch mein Chef wurde, als ich nach der Bundestagswahl 1972 Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt wurde.
Die neuen Überlegungen zu einer Verbesserung der Beziehungen zwischen West und Ost, mit denen Ende der Fünfzigerjahre begonnen worden war, wurden dann 1963 öffentlich. Sowohl der Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt als auch sein Pressesprecher Egon Bahr waren im Sommer 1963 als Redner zu einer einschlägigen Tagung der Evangelischen Akademie im bayerischen Tutzing eingeladen.
Sie haben dort mit einer neuen Parole, nämlich „Wandel durch Annäherung“, einen neuen Akzent gesetzt. Sie stellten den „Wandel“ im Ostblock in Aussicht, wenn der Westen die scharfe Abgrenzung beendet und auch mit den osteuropäischen und mitteleuropäischen Völkern ins Gespräch kommt.
1963: „Wandel durch Annäherung“
Diese Formulierung ist bemerkenswert: Um den Abbau der Konfrontation, um ein besseres Verhältnis mit den Völkern des Ostblocks zu propagieren, reichte nicht das Versprechen, friedlich zusammenzuleben und mehr Sicherheit zu gewinnen. Nein, dieser doch alleine schon bemerkenswerte Fortschritt wurde ergänzt um die Hoffnung auf Veränderungen der Verhältnisse in der DDR und in anderen Staaten des Ostblocks.
Als Willy Brandt und Egon Bahr am 15. Juli 1963 die Hoffnung auf „Wandel durch Annäherung“ in Tutzing verkündeten, hatten sie kein Amt in der deutschen Bundespolitik. Willy Brandt war Berliner Bürgermeister, Egon Bahr sein Pressesprecher. Davon unberührt entfaltete diese Formel ihre eigene große Wirkung.
Mit einer eigenen Erfahrung möchte ich das begründen: Fünf Jahre später, im August 1968, war ich gerade Redenschreiber des damaligen Bundeswirtschaftsministers Professor Dr. Karl Schiller geworden. Am 21. August war ich zur Besprechung eines Redeentwurfs bei Schillers Parlamentarischen Staatssekretär Klaus-Dieter Arndt.
Arndt war jenseits seiner Funktion als Staatssekretär für den Ausbau des innerdeutschen Handels zuständig, also ein in der neuen Ostpolitik engagierter Politiker. Während der Besprechung brachte seine Sekretärin einen sogenannten Ticker, also eine aktuelle dpa-Meldung.
Klaus-Dieter Arndt las mir vor, was dpa berichtete: Streitkräfte des Warschauer Paktes seien in Prag gelandet, um den sogenannten Prager Frühling um den Reformkommunisten Dubcek zu beenden. Seine Reaktion war bemerkenswert: Wir machen weiter. Für ihn wie auch für die anderen Sozialdemokraten in der damaligen Großen Koalition war auch dieser harte Schlag kein Grund dafür, die begonnene Politik der Verständigung zwischen West und Ost aufzugeben.
Das Volk der „guten Nachbarn“
Diese Besonnenheit hat sich ausgezahlt. Die Versöhnungspolitik, oder wie man die neue Außenpolitik auch nannte: die Entspannungspolitik, die Friedenspolitik Willy Brandts bekam bei den Wahlen 1969 eine Mehrheit. Willy Brandt wurde zum Bundeskanzler einer kleinen Koalition, der sozialliberalen Koalition mit Walter Scheel als Vizekanzler und Außenminister. In seiner ersten Regierungserklärung erklärte der neugewählte Bundeskanzler am 28. Oktober 1969: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein – im Inneren und nach außen.“
Damals also, zur Einführung der Entspannungspolitik und zur Beendigung des Kalten Krieges Ende der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts, wurde die Zielsetzung „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ formuliert, postuliert von einem Sozialdemokraten, von Willy Brandt.
Und heute nun die „wegweisende“ Formulierung des Bundesverteidigungsministers, Boris Pistorius (SPD), ebenfalls von der SPD. Er erklärte am 29. Oktober 2023: „Wir müssen kriegstüchtig werden – wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.“ Zudem forderte Pistorius einen „Mentalitätswechsel“ der Deutschen in Sicherheitsfragen.
„Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte“, sagte Pistorius in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Diese Formulierung wurde dann auch noch begründet – sie diene der Abschreckung Russlands und Putins, sie solle dazu dienen, Russland davon abzuhalten, über die Ukraine hinaus weiter nach Westen vorzustoßen.
Pistorius bekräftigte dann am 5. Juni 2024 bei einer Regierungsbefragung: „Wir dürfen nicht glauben, dass Putin an den Grenzen der Ukraine, wenn er so weit kommt, haltmachen wird ... Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt.“
Diese Begründungen für die neue Parole missachten ein wichtiges Charakteristikum der früheren Entspannungspolitik. Ein wichtiges Element dieser Politik war das, was mit „vertrauensbildenden Maßnahmen“ umschrieben worden war. Vertrauen zu bilden war ein zentrales Anliegen. Vertrauensbildend ist das, was zurzeit geschieht, überhaupt nicht.

Das fängt schon bei der immer wiederkehrenden Personalisierung an. Putin wird zum Leibhaftigen hochstilisiert. Es geht weiter mit der Einführung von Sanktionen gegen Russland, mit dem Beschluss eines sogenannten Sondervermögens von 100 Milliarden für die Aufrüstung und der wiederkehrenden und unbelegten Behauptung, Russland plane den militärischen Vorstoß über die Ukraine hinaus nach Westen.
Zwischen der von Willy Brandt formulierten und vom nachfolgenden sozialdemokratischen Bundeskanzler Helmut Schmidt fortgeführten Entspannungspolitik und dem Bekenntnis „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ und der Parole und Forderung des gegenwärtigen sozialdemokratischen Verteidigungsminister Pistorius klaffen Welten. „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ und „Wir wollen kriegstüchtig werden“, das ist wie Feuer und Wasser.
Die SPD ist nicht mehr wiederzuerkennen
Dass diese beiden Parolen im Abstand von einem halben Jahrhundert von Vertretern derselben Partei kommen, lässt tief blicken. Hinter dieser Veränderung der sicherheitspolitischen Parolen steckt im konkreten Fall die totale Veränderung der ältesten Partei Deutschlands. Sie ist nicht mehr wiederzuerkennen.
Dass diese Partei in den Hochzeiten der Entspannungspolitik 45,8 Prozent der Zweitstimmen holte (1972), heute bei Umfragen zwischen 14 und 15 Prozent schwankt und bei der letzten Bundestagswahl im Februar 2023 nur 16,4 Prozent der Zweitstimmen erhielt, ist nicht verwunderlich. Pistorius ist zwar angeblich populär, aber wahrscheinlich mehr bei den Wählern der Union als bei potentiellen Wählern der SPD. Auch eine sehr alte und über Jahrzehnte hinweg wichtige Partei kann ruiniert werden.