Seit den 1990ern besuchten Hans Modrow und ich mitunter Egon Bahr im Willy-Brandt-Haus. Im Unterschied zu Modrow verfügte Bahrs Büro über ein Vorzimmer. Die Sekretärin steckte gelegentlich den Kopf durch die Tür, nickte kurz und beendete damit die Unterredung.
Die letzte im Frühsommer 2015. Natürlich ahnte niemand, dass es die letzte sein würde. Das Treffen endete mit Bahrs Aufforderung zu gehen, weil jetzt die Koreaner kämen. Ich fragte zurück: Welche? Bahr darauf: beide. Aha, hier sprachen also die Abgesandten aus dem Süden und aus dem Norden des geteilten Landes über eine Annäherung.
Auch Hans Modrow, der vorletzte Ministerpräsident der DDR und spätere Abgeordnete des Bundestags und Europaparlaments, sollte schon bald von Regierungsstellen in Seoul und Pjöngjang eingeladen werden, um dort über das Ende der deutschen Zweistaatlichkeit zu referieren, insbesondere über die Fehler, an denen wir Deutschen noch immer schwer trugen. Die Koreaner wollten diese Fehler im Falle einer Wiedervereinigung nicht wiederholen. Der Verständigungsprozess kam irgendwann zum Erliegen, was nicht ursächlich dem Ableben Bahrs (August 2015) und Modrows (Februar 2023) geschuldet war. Nicht nur in Südkorea gab es einen Gezeitenwechsel.
Egon Bahr und ich hatten dieselbe Schule in Torgau besucht. Zu seiner Zeit, in den 1930er-Jahren, war das Gymnasium nach dem preußischen Offizier August von Mackensen benannt, der dort im 19. Jahrhundert einst Schüler gewesen war. Zu meiner Zeit, in den 1960er-Jahren, trug die Erweiterte Oberschule den Namen des Leipziger Kommunisten Ernst Schneller. Die Büste von Mackensen fanden wir bei einem FDJ-Subbotnik (freiwilliger Arbeitseinsatz) unter einer Brombeerhecke auf dem Schulgelände.
Bahr hatte die Schule in den späten Dreißigerjahren verlassen, weil sein Vater der Forderung der Nazis nicht nachkam, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen. Die Familie Bahr floh in die Anonymität der Großstadt. Und wem begegnete Bahr in Berlin im Juni 1939 Unter den Linden, wohin er mit seiner Schulklasse abkommandiert worden war, um die aus Spanien zurückgekehrte „Legion Condor“ zu begrüßen? August von Mackensen – dieser schritt, umringt von allen Nazigrößen, aus der Neuen Wache auf ihn zu. Das alles prägte und formte Bahrs Weltsicht.

Antifaschistischer Geist und Streit am „Elbe Day“
Später gehörte er dem Förderverein der Torgauer Schule an und war dadurch bestens über die Geschehnisse vor Ort informiert. Auch über Querelen. Sie gab es vornehmlich immer im April, wenn der Begegnung von Russen und Amerikanern am Ufer der Elbe 1945 gedacht wurde, dem „Elbe Day“.
An den antifaschistischen Geist jenes ersten Zusammentreffens der Verbündeten erinnerte ein historisches Denkmal auf der einen Seite. (Inzwischen gibt es auch ein Fahnenmonument auf der anderen Seite des Flusses.) Es wehte dort gleichberechtigt die US-Flagge neben dem russischen und dem deutschen Banner. Nach 2014 ersetzte man Russischrot durch Europablau. Und seit 2022 weht überhaupt keine Fahne mehr.
Verdrängt und vergessen, dass einst die Alliierten in einer Antihitlerkoalition den Kontinent gemeinsam vom Faschismus befreit hatten. Selbst mitten im Kalten Krieg hatten beide Seiten den „Geist von Torgau“ beschworen: Im Juli 1975, dreißig Jahre nach der geschichtsträchtigen Begegnung an der Elbe, koppelten im Kosmos über Torgau ein Sojus- und ein Apollo-Raumschiff an.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Egon Bahr liebte solche symbolischen Gesten, er war Journalist. Der gebürtige Ostdeutsche wollte nicht nur die ideologisch begründete und wirtschaftlich befestigte Teilung des Landes, sondern auch die des Kontinents überwinden. Was ihm auch gelang. Zwar nicht so, wie er (und viele andere) es sich gewünscht und gedacht hatten, also keine kritiklose Übernahme des einen Systems durch das andere.
Bahr schrieb am 3. Februar 2005 in einem Brief an den Schauspieler Lutz Riemann: „Willy Brandt hat gesagt: Je älter er werde, umso linker werde er. Mir geht es nicht anders.“ Und ironisch-sarkastisch fügte Egon Bahr hinzu: „Der Sozialismus hatte wenigstens einen ernsthaften Herausforderer, den Kapitalismus.“ Und fügte hinzu: „Für den Kapitalismus sehe ich keinen solchen ernsthaften Herausforderer. Ohne die Kraft, sich selbst zu reformieren, gehen wir wundervollen Zeiten entgegen.“
Der Geschichtsrevisionismus macht auch vor Willy Brandt nicht halt
Die „wundervollen Zeiten“ sind nun angebrochen. Es findet ein ideologisches Rollback auf breiter Front statt, in dem alles untergepflügt wird, was bis dato als gesicherte, irreversible Erkenntnis galt. Der Geschichtsrevisionismus macht vor nichts halt, auch nicht vor Willy Brandt. Er hat schließlich mit dem Kanalarbeiter Bahr im „back channel“ die Ostverträge vorbereitet.

Als ahnte Bahr, was da an Unverschämtheiten über ihn und andere Entspannungspolitiker hereinbrechen würde, warnte er am 3. Dezember 2013 Gymnasiasten in Heidelberg vor propagandistischen Nebelschwaden: „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“
Der nationale Ost-West-Konflikt, dessen Existenz lange bestritten wurde, hat nun die Publizistik erreicht (Oschmann, Hoyer, Meinhardt, Meyen usw.). Er war immer da – nur wird er jetzt lauter und vernehmlicher artikuliert. Auch in den Medien, die Meinungen machen. Die öffentliche Auseinandersetzung wird konfrontativ ausgetragen. Die einen wählen AfD, die anderen diffamieren die „Russlandversteher“, die verstorbenen wie die lebenden. Menschen, die noch bei Sinnen sind, sehen sich gezwungen, Personen und Vorgänge zu verteidigen, die unter normalen Umständen von ihnen nicht verteidigt werden würden. Wie schon einmal in der Vergangenheit.
Gerhart Eisler – vom Komitee gegen unamerikanische Aktivitäten durch die Mangel gedreht und 1947 wegen „Missachtung des amerikanischen Kongresses“ zu vier Jahren Haft verurteilt – wurde der Vorwurf gemacht, er habe zu Stalin gehalten. Darauf entgegnete er: Ja, hätte ich denn zu Hitler halten sollen?
Als unsereinem nach 1990 die Westdeutschen erklärten, was wir alles falsch gemacht hätten, verteidigten wir alles an dieser DDR – sogar das, was wir bis 1989 selbst scharf kritisiert hatten. Als Egon Krenz nach vier Jahren aus dem Knast kam, kleidete er diesen Reflex in einen pointierten Satz „Lieber ein Betonkopf als ein Weichei“. Ich könnte auch Modrow zitieren, der sich am 15. Januar 1990 beim Sturm auf die Stasi-Zentrale dem Mob entgegenstellte, als dieser Türen eintrat und Mobiliar aus dem Fenster warf: „Was können die Stühle dafür, welche Ärsche auf ihnen saßen?“ Die Doppeldeutigkeit nahm ihm mancher übel, aber letztlich war auch dieser Appell an den Verstand nichts anderes als eine klare Parteinahme für Vernunft und Logik.
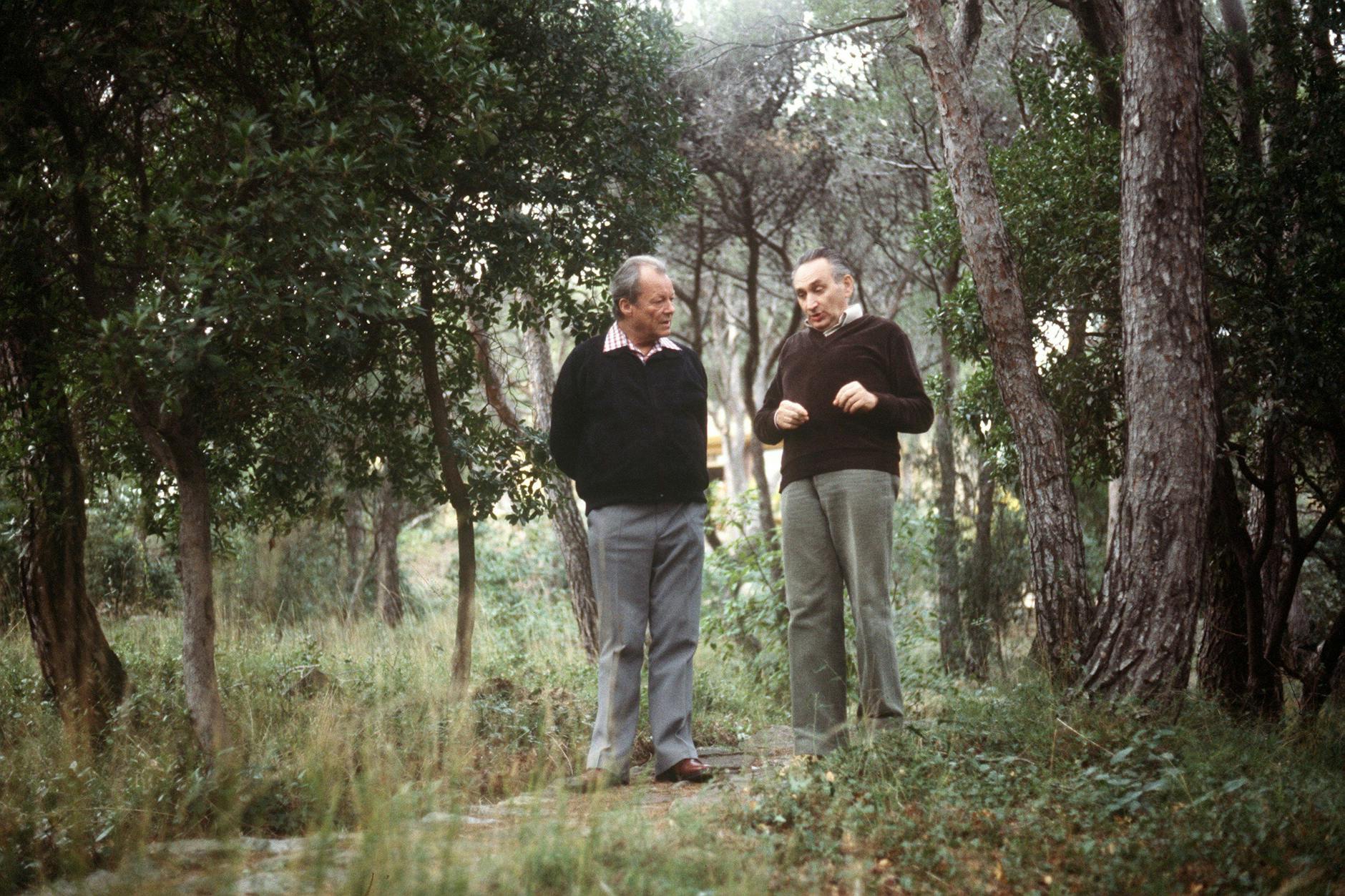
Friedenspolitiker verteidigen, ohne sie zu idealisieren
Nach diesem Prinzip müssen wir auch Politiker verteidigen, die durchaus Kritik verdienten – unter Vizekanzler Willy Brandt wurden 1968 die Notstandsgesetze und unter Kanzler Brandt 1972 der Radikalenerlass durchgesetzt. Aber eben dieser Mann reduzierte mit seiner neuen Ostpolitik die Kriegsgefahr erheblich. Das war wichtiger: Frieden ist tatsächlich nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.
Unter Brandt und Bahr wäre es beispielsweise ausgeschlossen gewesen, dass fünftausend deutsche Soldaten an der russischen Grenze aufmarschierten. Auch nach der Invasion der Russen in Afghanistan. Altkanzler Helmut Schmidt, der den Nato-Doppelbeschluss damals durchsetzte, nannte laut Bild vom 16. Mai 2014 bereits die Forderung nach Sanktionen gegen Russland „dummes Zeug“.
Es gab Hunderte Gründe, Schmidt zu kritisieren – nicht aber in der einen zentralen Frage: in der von Krieg und Frieden. Keine Nachsicht, dass er als Wehrmacht-Leutnant an der Blockade Leningrads beteiligt war. Der fielen über eine Million Russen zum Opfer, er bekam das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Das bleibt. Wenngleich nachrangig. Denn Schmidt besaß mehr Charakter als alle professionellen Geschichtsrevisionisten heute, denen die Zeitungsspalten, Talkshows und Podcasts gehören.
Die die deutschen Verbrechen verharmlosen und bagatellisieren, wie ein Botschafter a. D. es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tat. „Unzweifelhaft war die Belagerung Leningrads ein Akt barbarischer Kriegsführung unter Nazi-Regie“, so schrieb er in einem Leserbrief. „Er galt [aber] ‚nur‘ der Erreichung eines limitierten Kriegszieles.“ Das stand wirklich in der FAZ am 15. April 2024.
Helmut Schmidt hätte eine derartige Relativierung und quasi Legitimierung eines Massenmordes nicht hingenommen. Mehr noch. „Wenn ich ein sowjetischer Marschall wäre oder ein Oberst, würde ich die Ausdehnung der Nato-Grenzen, erst von der Elbe bis an die Oder und dann über die Weichsel hinaus bis an die polnische Ostgrenze, für eine Provokation und eine Bedrohung des heiligen Russland halten. Und dagegen würde ich mich wehren. Und wenn ich mich heute dagegen nicht wehren kann, werde ich mir vornehmen, diese morgen zu Fall zu bringen“, wurde er am 25. Mai 2022 von der Zeit zitiert, die er einst herausgab. Und Egon Bahr nannte mit der gleichen Überzeugung die Nato-Osterweiterung einen „Jahrhundertfehler“.

Die Autoren der Ostverträge waren weder Irrende noch Getäuschte
Die Schule, die ich und Egon Bahr besucht hatten, heißt jetzt, im 21. Jahrhundert, übrigens nach Johann Walter. Der „Urkantor“ der evangelischen Kirche hatte zu Reformationszeiten fast ein halbes Jahrhundert in Torgau komponiert und gedichtet. Von ihm stammt der Kirchenchoral „Eine feste Burg ist unser Gott“. Friedrich Engels, bei Gott kein Kirchgänger, nannte dieses Lied die „Marseillaise der Bauernkriege“. Sie wird aus gutem Grund noch immer gesungen. Und liefert den Beweis, dass die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach nicht irrte, als sie bemerkte: „So manches papierne Denkmal hat mehr Bestand als ein Denkmal aus Erz.“
Das gilt ohne jede Einschränkung auch für die Ostverträge und für alle Papiere, die einst im zähen Ringen ausgearbeitet und nach 1990 leichtfertig zerrissen wurden. Ihre Autoren waren weder Irrende noch Getäuschte, sondern besaßen das, was jenen abgeht, die heute vermeintlich nationale Interessen vertreten: Sachverstand, Augenmaß und Vernunft.






