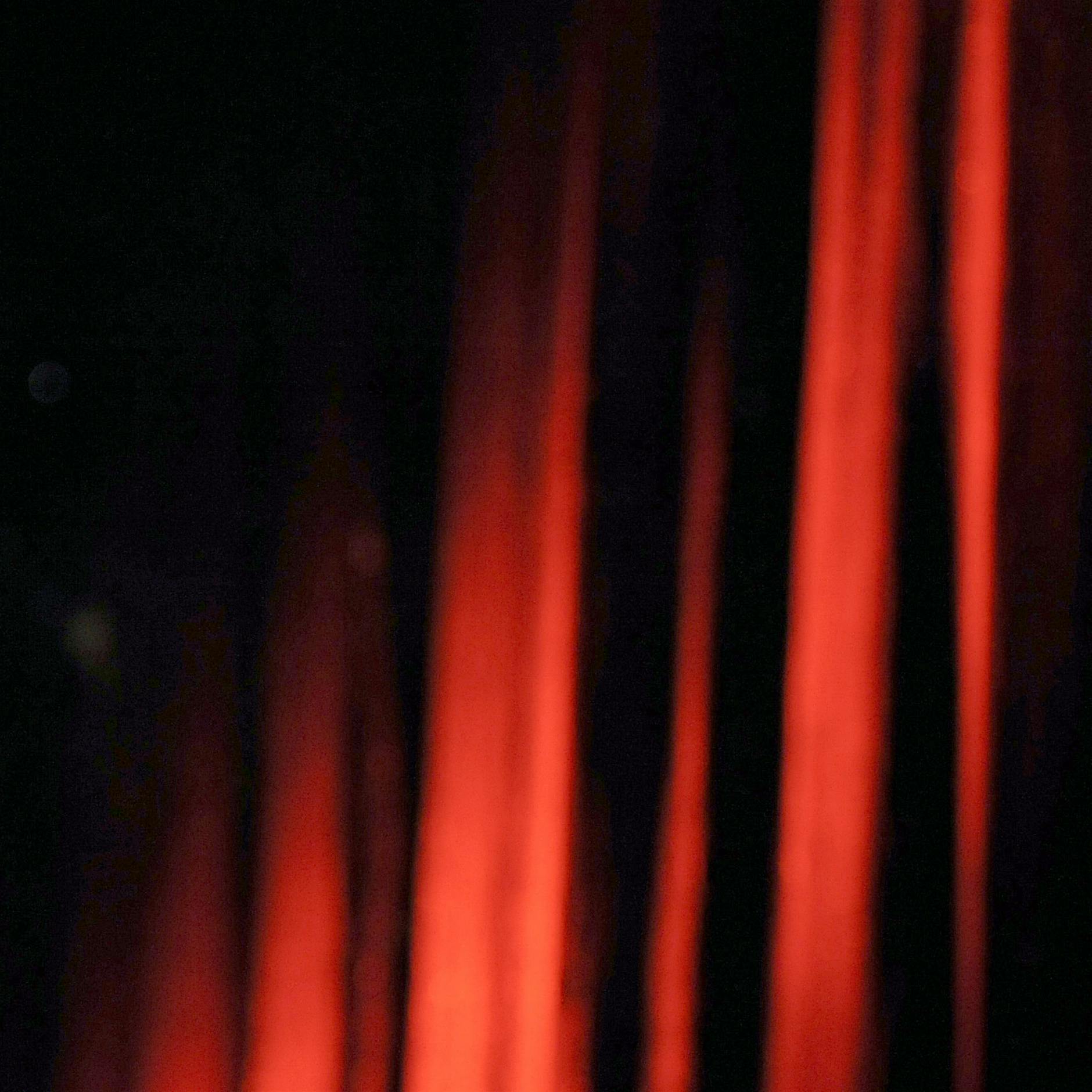Eigentlich sollte das Interview ein Streit über das Verhältnis von Theater und Kritik werden. Ein scheidender Intendant hätte doch mal ein bisschen vom Leder ziehen und den Kulturredakteur für zugefügte Verletzungen und Fehlurteile zusammenfalten können. Andersrum hat sich der Interviewer schon innerlich gegen Widerrede imprägniert, auch wenn ihm klar war, dass weder Khuon noch Seidler das passende Personal für einen Hundekot-Eklat sind, bei dem der Choreograf Marco Goecke eine Tanzkritikerin mit den Hinterlassenschaften seines Dackels Gustav traktierte. Aber dann liefen sich die beiden Ulrichs beim Theatertreffen über den Weg, beschmunzelten einander und verwarfen die alberne Streitgespräch-Idee. Zu reden gibt es natürlich dennoch jede Menge über Theater, Publikum und auch über Kritik. Und mit der Aufgabe der Kommunikation wird man nie fertig. Das ist nur eine Erkenntnis aus dem Vermächtnis eines Theaterintendanten kurz vor dem Ende seiner Laufbahn.
Herr Khuon, bis vor ein paar Tagen dachten alle, dass Sie im Sommer in den Ruhestand treten wollen, stattdessen setzen Sie sich noch einmal in ein Wespennest und übernehmen die Interimsintendanz in Zürich nach dem mehr oder weniger unfreiwilligen Weggang von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg. Oder wie schätzen Sie die Lage am dortigen Schauspiel ein?
Mit so einer Einschätzung wäre ich vorsichtig. Es könnte von Vorteil sein, dass ich von außen komme. Ich habe zwar meine Ahnungen, aber es wäre falsch, wenn ich daraus fertige Meinungen ableite. In den Kantinen und Redaktionen kommt man vielleicht nicht drum herum, seine Verdachtsmomente zu formulieren: Wahrscheinlich waren die zu radikal, nach außen, nach innen, möglicherweise haben sie die Stadt nicht richtig gemeint, sondern sich zu sehr auf das überregionale Feuilleton konzentriert, vielleicht sind sie zu ideologisch herangegangen. Genau solche vorgefertigten und abgeschlossenen Beschreibungen stehen einem im Weg, die verfestigen sich, und dann kriegt man sie nicht mehr los.

1980 holte man ihn als Chefdramaturg ans Theater Konstanz, zu dessen Intendant er 1988 aufstieg. Ab 1993 leitete er als Intendant das Schauspielhaus Hannover, ab 2000 das Hamburger Thalia-Theater und ab 2009 das Deutsche Theater Berlin, dessen Leitung er am 1. Juli beendet. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass er für die Spielzeit 2024/25 als Interimsintendant das Zürcher Schauspiel leitet.
War das bei Ihnen in Berlin auch so?
Ich war, glaube ich, sehr offen, als ich 2009 nach Berlin kam, hatte aber schnell das Gefühl, dass man mir mit einer gewissen Verschlossenheit begegnete. Ob von manchen Gewerken, von Teilen des Ensembles, des Publikums oder von der Presse: Da kommt der Wessi, der in lauter verwöhnten West- und Südstädten gearbeitet hat. Das war auch nicht völlig falsch. Aber man darf das nicht zu persönlich nehmen, dann besteht die Gefahr, dass man zumacht und trotzig wird. Stattdessen kann man versuchen, das produktiv zu machen und zu gucken, wie man davon ausgehend künstlerisch eine neue Dimension erobert, vielleicht gehören solche von außen oktroyierten Orientierungspunkte zu einer Forschungsreise dazu. Das entzieht sich zwar der Kontrolle des Subjekts, aber man kann es mit einbeziehen und zur Grundlage seines Handelns machen.
Es reicht also nicht, einfach nur gute Kunst zu machen?
Wie ich das sehe, haben sie das in Zürich gemacht. Aber mit der Pandemie scheint sich die Lage angespannt zu haben, und da haben sich der Verwaltungsrat und das Team beim Verhandeln der Vertragsverlängerung offenbar nicht getroffen. Wie das genau ablief, das weiß ich nicht; brauch ich auch nicht zu wissen. Die Begleitgeräusche habe ich schon vernommen, die Finanzen vor allem, aber auch die verschiedenen Geschwindigkeiten zum Beispiel in dem Wunsch nach Diversität. Das sind wichtige Bestrebungen und Bewegungen, die aber Geduld brauchen.
Da sind Sie dann der Richtige?
Ich kann nicht leugnen, ein alter, weißer Mann zu sein und über Lebens- und Theatererfahrungen zu verfügen. Ich akzeptiere, dass das durchaus auf Misstrauen und Skepsis trifft. Insofern wird das kein Spaziergang; das Gelände ist zerklüftet. Und es ist nicht so, dass ich wie ein gütiger Patriarch ankomme und sage, ich schenke euch meine Kompetenz, nein, da türmt sich schon wieder eine Eiger-Nordwand vor mir auf, ich spüre schon erste Anflüge von Nervosität und Ängstlichkeit. Aber das gehört wie die Freude und der Spaß dazu, um uns bei so einer Expedition in Gang zu setzen.
Wie viel trägt die Kommunikation zur Etablierung und zur Entwicklung eines Theaters und seines künstlerischen Profils bei?
Kommunikation ist eine endlose Aufgabe, das wird nie zum Selbstläufer. Ich versuche, den Weg möglichst breit zu machen und ihn gemeinsam zu gehen. Das bremst natürlich. Als wir zum Beispiel im Bühnenverein den Verhaltenskodex erarbeitet haben, wurde uns von der Presse vorgeworfen, dass das zu langsam ging. Ein Jahr, um zwei Blatt Papier zu formulieren … Ich glaube aber, dass diese Zeit absolut notwendig war, um eine Diskussion zu führen und einen Konsens zu finden. Damit auch die Menschen mitgehen , die sich nicht gleich anschließen können. Es ist eine Frage der Abwägung: Geduld üben, aber auch den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Und es nicht sich selbst überlassen, sondern mitgestalten und auch mal springen. Ich bin zum Beispiel für Quoten.
Sollte das Theater lauter sein und weiter springen als die Gesellschaft?
Was die Lautstärke angeht, können wir kaum konkurrieren. Es gibt schon genug Aggressionen in den sozialen Medien und in der Gesellschaft, da ist es schon ganz gut, wenn einem nicht auch noch das Theater an die Gurgel springt oder auf den Kopf haut. Andererseits gibt es Theater und auch Stadtgesellschaften, in denen die Konflikte schön überdeckt sind und in denen eine Scheinharmonie herrscht. Da fehlt dann eine laute Stimme, um die Probleme erkennbar zu machen. Im Moment ist draußen alles so beschädigt oder zerstört, da ist es mir ganz recht, dass ich es beim Theater anders empfinde. Untereinander hat sich während der Pandemie eine gute Solidarität entwickelt. Viele nickelige Feindschaften sind weg oder sind in den Hintergrund getreten. Ich finde auch, dass die Theaterkritik momentan nicht zerstörerisch ist, sondern kritisch begleitend.
Sie selbst haben als Theaterkritiker angefangen, warum haben Sie die Seite gewechselt?
Es war nicht mein Ding. Ich habe versucht, meinungsstark zu sein und habe mich in etwas reingesteigert, auch emotional, weil ich dachte, das müsse so sein. Dann kam ich zurück zu dem, was mich mehr prägt, dieses endlose Abwägen. Das ist, was den Redaktionsschluss und den Schwung eines Textes angeht, auch nicht unbedingt hilfreich. Zu urteilen fällt mir schwer. Ich finde es einfacher, etwas zu machen, und dann andere darüber urteilen zu lassen.
Sie müssen auch als Intendant urteilen. Das ist Voraussetzung für die Entscheidung zu einer oder gegen eine Zusammenarbeit. Waren Sie da auch zu urteilsschwach manchmal?
Ich überlege lang, bevor ich jemanden engagiere. Besonders in der Regie. Ich arbeite gern mit Menschen, die ich schon lange kenne: Sebastian Hartmann, Daniela Löffner, Andreas Kriegenburg, Anne Lenk, Armin Petras, Thomas Kühnel, Jürgen Kuttner, Stephan Kimmig und andere. Manche begleite ich von Anfang an zum Beispiel Lilja Rupprecht oder Jette Steckel. Wenn ich mich einmal entschieden habe, gibt es eine gewisse Treue. Das kann man vielleicht auch übertreiben, aber ich stelle die Zusammenarbeit nicht andauernd infrage, sondern bleibe erst einmal bei den Leuten und reiße den bunten Haufen nicht gleich wieder auseinander. Das gilt besonders für die Dramaturgie. Da kann es schon sein, dass ich den einen oder anderen neuesten Wundertäter oder letzten Schrei verpasse. Aber neugierig muss man schon bleiben und bereit, sich aufmischen zu lassen.
Es ist auch eine soziale Frage.
Das kann man nicht trennen. Klar, man pflegt Beziehungen. Es werden immer mehr, und es ist nicht leicht, das zusammen mit der Dramaturgie, in der jeder einen anderen Liebling hat, halbwegs konzentriert zu halten. Ich will keine beliebige Vielfalt, sondern eine, die gewachsen ist. Ich vertraue dann darauf, dass man schon etwas herauslesen kann. Ich habe nicht diese Strenge, mit der andere ihre Spielpläne gestalten und aussortieren, was nicht passt. Wenn sich Ensemble und Regie entfremden, dann ist irgendwann eine Entscheidung gefragt. Der Witz ist aber, dass man manchmal auch Täler gemeinsam durchschreitet, und plötzlich leuchtet es wieder. Gotscheff oder Gosch gingen durch Phasen, in denen sie weniger durchdringen konnten, und da gehöre ich vielleicht zu der Riege, die sagt, dass die Täler zur Expedition dazugehören, dass man da durch muss, um zu neuen Gipfeln zu kommen.
Reißen diese menschlichen Verbindungen ab, wenn Sie in den Ruhestand gehen?
Dieser Gedanke beschäftigt mich viel mehr als der, dass ich auf einmal zu viel Zeit haben könnte. Ich werde mich schon zu beschäftigen wissen, und ich lebe meine persönlichen Beziehungen sehr intensiv. Ja, es gehen auch viele gelebte Beziehungen zu Ende. Unser Gruppenzusammenhang wird auseinanderfliegen, das zerstört vieles von mir. In Zürich werde ich für das eine Jahr keinen solchen Zusammenhang herstellen. Aber ich kann den Schwung mitnehmen für die neue Aufgabe, und mich ablenken von dem Schmerz.

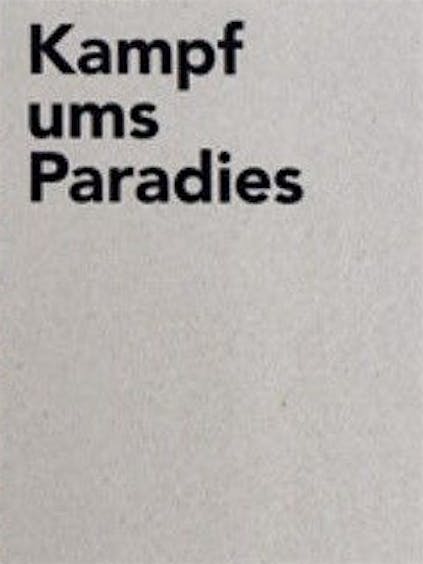
Es ist eine Chronik, eine Dokumentation und persönliche Rückschau auf 14 Spielzeiten und versammelt in zahlreichen persönlichen Beiträgen und Fotos Erinnerungen an 14 intensive Jahre der Kunst, der Zusammenarbeit und des Miteinanders am Deutschen Theater Berlin.
Ist es tapfer, sich von der Trauerarbeit abzulenken?
Vielleicht ist genau das Trauerarbeit. Oder muss man dafür zu Hause sitzen und warten, dass sich der eine oder andere meldet, um mal ein Bier mit seinem Ex-Intendanten zu trinken und gemeinsam zu betrauern, was nicht mehr ist? Die Gruppe, die nicht mehr miteinander arbeitet, wird nicht am Stammtisch weiterleben, vielleicht aber in einzelnen Beziehungen und Begegnungen. Aber was rede ich, ich habe keine Ahnung, in dem Bereich bin ich Anfänger. Die Leute fragen mich ganz vorsichtig, als wäre ich ein Schwerkranker, wie es mir geht. Ich bin vorbereitet vom Kopf her, mir geht es gut. Aber wie es mir dann gehen wird, weiß ich nicht. Das wird eine existenzielle Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Mal sehen. Wir machen jetzt was los in den letzten Wochen, schmeißen unsere Kraft rein, wollen da gut und mit Freude durch. Es wird ganz anders als beim Abschied der Castorf-Volksbühne, die eine Weltuntergangsschlacht unter allseitiger Begeisterung und einseitigem Feindbeschuss gefeiert hat. Wir haben keine Feindschaften. Wir wollten von Anfang an versuchen, ohne Feindbild auszukommen und einen positiven Gruppenzusammenhang aufbauen. Feinde können sehr hilfreich sein, sie nehmen einem die Hälfte ab, was den Zusammenhalt und die Orientierung in der Gruppe angeht. Mein Theaterideal funktioniert ohne Feindbilder.
Wann kam das Angebot aus Zürich?
Das kam per E-Mail im April. Ich habe mich gefragt, wie das wirkt, wenn ich zusage. Ich will nicht so einer sein, der sich an einen Fels klammert, während die Brandung an ihm reißt. Ich kann und will loslassen, auch wenn es mir schwerfällt. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich will nicht rumjammern.