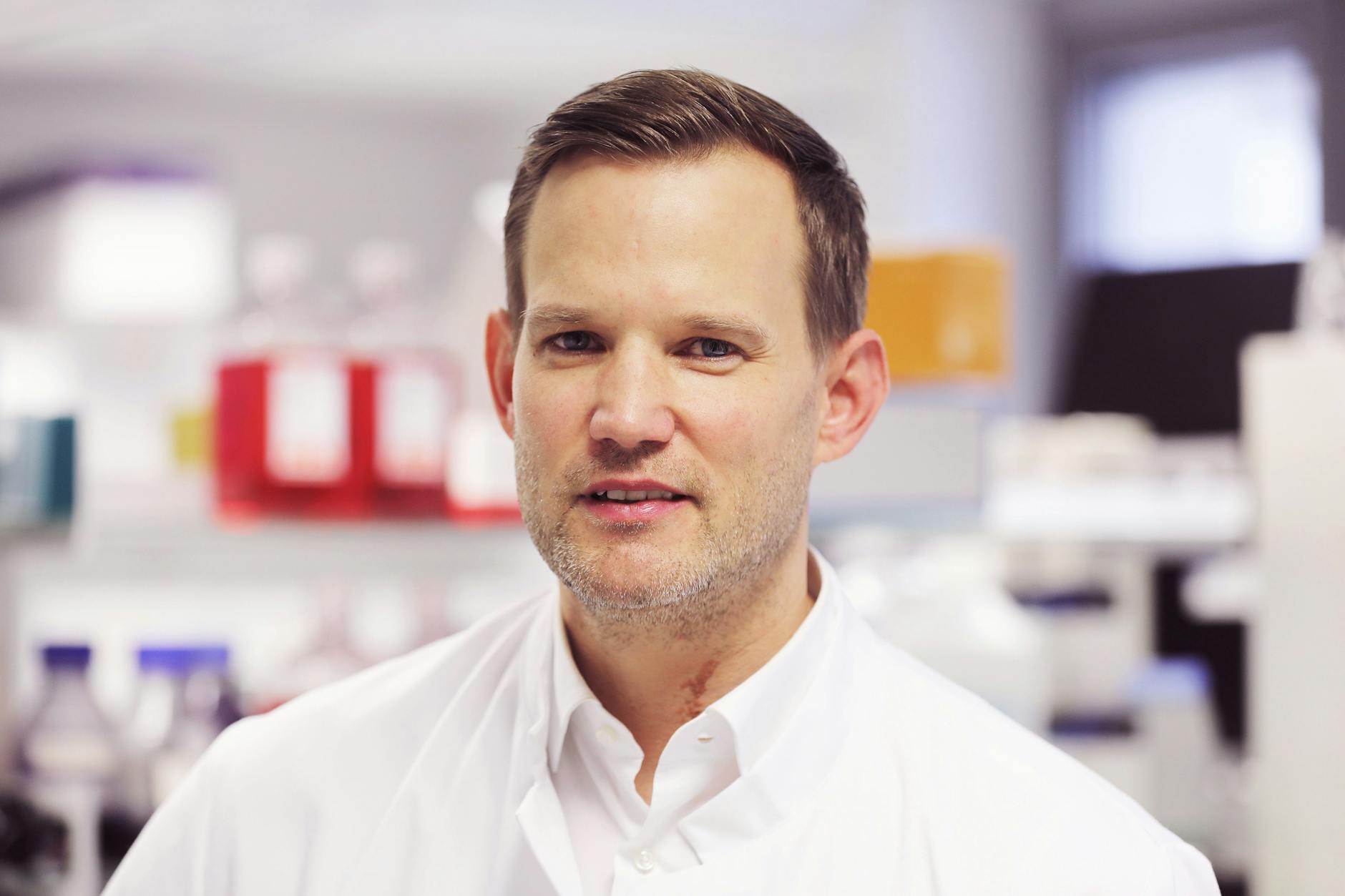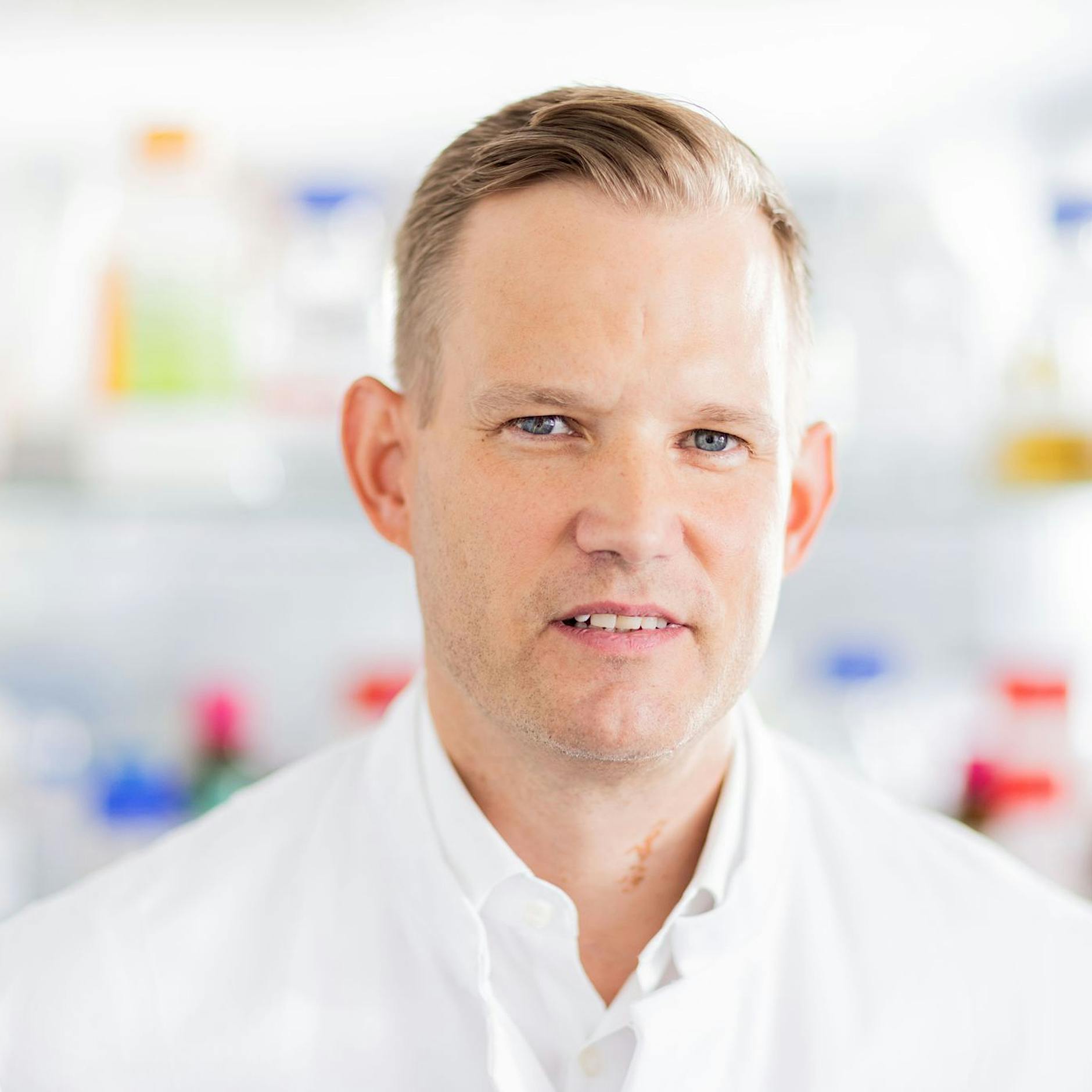Sein Debattenbeitrag in der FAZ zur Reform des Gesundheitswesens wurde teils missverstanden als die Forderung, Ärzte nur noch nach Heilungserfolg zu bezahlen. Was er wirklich meint: den Behandlungserfolg. Denn es würden zu viele Fehlanreize das deutsche Gesundheitssystem und damit Ärzte, Pfleger und Patienten schwer belasten. Die Gründe, so offen darüber zu sprechen, nennt der durch die Pandemie bekannt gewordene Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck im zweiten Teil unseres Interviews.
Herr Streeck, viele Mediziner sind äußerst verhalten in ihrer Kritik am Gesundheitswesen, als Journalist hat man oft den Eindruck, sie würden gerne reden, trauen sich aber nicht. Warum ist das so – Sie etwa kritisieren das System ja auch offen?
Das Gesundheitssystem ist in seiner Gesamtheit sehr komplex und daher ist es schwierig, die Punkte zu definieren, an denen man für eine Veränderung ansetzen sollte. Durch meine tägliche Arbeit in der Klinik und noch verstärkt durch die Corona-Pandemie ist mir aber klar geworden, dass man radikalere Lösungen suchen muss. Ein Beweggrund mag auch ein sehr persönlicher sein, jetzt einen Systemwechsel zu fordern: Mein Vater war topfit, aber im Januar wurde bei ihm Krebs als Zufallsdiagnose festgestellt. Er ist selbst Arzt, meine Mutter ist Ärztin und ich bin Arzt. Trotzdem haben wir uns in diesem System zum Teil verloren gefühlt, wie man von Arzt zu Arzt zu Arzt geschickt wurde, Diagnostiken sich wiederholten und Therapieoptionen diskutiert wurden. Ich fand es zum Teil unmenschlich, würdelos, und vor allem hat man sich dabei allein und verlassen gefühlt. Er ist im April leider verstorben.
Das tut mir leid, herzliches Beileid.
Danke. In dieser Zeit ging es sehr viel darum, was man noch alles machen könne, jeder hat etwas anderes empfohlen, diverse Fachärzte haben uns Hoffnungen gemacht mit Studien, die zu 70 Prozent Heilungserfolge voraussagen. Ich habe diese Studien ja dann gelesen, und als Angehöriger greift man nach jedem Strohhalm.
Ich fand es zum Teil unmenschlich und würdelos.
Ich will hier niemandem einen Vorwurf machen, aber ich frage mich, wie es Angehörigen geht, die nicht wie ich vom Fach sind. Die bestimmtes Hintergrundwissen nicht haben. Wie sollen die denn das Gefühl haben, dass die beste Therapie für sie gefunden wird? Wie sollen die es schaffen, sich vielleicht mit Krankenkassen oder Anträgen in dieser Zeit herumzuschlagen? Diese Erfahrung ist sicher gerade auch eine Motivation für mich, dass ich mich einbringen will und eine Änderung des Gesundheitssystems anstrebe.
Jemanden im Krankheitsprozess zu begleiten, kann außerdem heißen, dass man auf ambulante Pflege zu Hause angewiesen ist. Die ambulante Pflege ist in Deutschland aber schlecht ausgebaut und wird schlecht vergütet. Dabei ist es ein Knochenjob und gibt schwer kranken Patienten nicht nur die benötigte Hilfe, sondern auch ein Stück weit Würde zurück.
Viele wissen gar nicht, dass 85 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Und zwar die allermeisten von ihren Angehörigen – auch wegen dieser schlechten Förderung der ambulanten Pflege. Sie sagen aber trotzdem, nicht nur die Zukunft der ambulanten Pflege liegt zu Hause, sondern auch die der Gesundheitsversorgung?
Einige Studien zeigen, dass rund 20 Prozent der Eingriffe ambulant erfolgen könnten, obwohl sie derzeit stationär erfolgen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ein Krankenhaus hat sehr viel Gutes, aber es hat leider auch einiges Schlechtes. Stress für den Patienten, schlechter Schlaf, Krankenhauskeime, potenziell mehr Komplikationen, schlechtere Ernährung usw. Im Grunde ist alles, was ambulant erfolgen kann, eine Stärkung für den Patienten. Deshalb muss man ambulante Versorgung und ambulante Pflege auch stärker ausbauen. Das entlastet die Krankenhäuser und die Patienten. Es ist daher eine Win-win-Situation, wenn man auf die Gesundheit schaut. Es muss nur von der Struktur und der Vergütung und der Versorgung auch so angelegt sein, dass man ambulant arbeiten kann.
Es sei denn, es handelt sich um Notfallpatienten, oder wer ist noch im Krankenhaus besser aufgehoben?
Natürlich, man muss da sehr differenzieren, um welche Patienten es überhaupt geht. Es gibt viele Erkrankungen, die man nur im Krankenhaus behandeln kann.
Welche sind das?
Das ist eine ganze Reihe: angefangen mit den ganzen Notfällen und Intensiv-Patienten bis zu den schwereren OPs. Das geht los zum Beispiel bei der Entfernung der Prostata beim Prostata-Karzinom über Operationen am offenen Bauch und am Herzen. Also es gibt eine Fülle von Eingriffen und Therapien, die weiterhin stationär in Kliniken erfolgen müssen. Aber bestimmte kleinere chirurgische Eingriffe, diagnostische Abklärung, Chemotherapien und Ähnliches können sehr gut ambulant erfolgen. Ein offenes Geheimnis ist doch, dass wenn man eine schnelle Diagnostik braucht, man den Patienten ein oder zwei Tage stationär aufnimmt, um nicht auf einen Termin warten zu müssen. Das ist im Grunde vollkommen überflüssig. Und auch nicht gut für den Patienten.
Aber es ginge nur anders, wenn die Diagnostik ambulant auch halbwegs zeitnah funktionieren würde.
Ganz genau.
Nun fordern Sie ja einen kompletten Umbau der ambulanten Versorgung. Wie sähe der denn aus?
Der Ansatz ist, dass wir Strukturen, die schon bestehen, wie etwa kleinere Krankenhäuser, zu ambulanten interdisziplinären Diagnostikzentren ausbauen, die vorbereitend sind für therapeutische Planung. Es ist natürlich entscheidend, dass diese Zentren Hand in Hand arbeiten mit anderen Ärzten und wir uns auf die gesamte Versorgung des Patienten fokussieren und nicht auf die jeweiligen Teilbereiche.
Die machen dann quasi die Vorarbeit fürs Krankenhaus?
Das kann die Vorarbeit sein, aber es gibt ja auch jetzt schon medizinische Versorgungszentren, die gemeinsam an einem Fall interdisziplinär arbeiten. Aber auch da muss gelten: Der Versorgungspfad sollte vergütet werden, nicht die einzelne Diagnostik.
Das heißt, das wäre die bessere Alternative zu Lauterbachs Gesundheitskiosken?
Gesundheitskioske sind ja nur ein zusätzlicher vorgeschalteter Anknüpfungspunkt ans Gesundheitssystem. Für Patienten, die sonst nicht zum Arzt gehen würden oder da eine Hürde sehen. Als ich in den USA gelebt habe, bin ich auch einmal mit einer Mandelentzündung zu einem CVS gegangen, um Antibiotika zu bekommen. Ein CVS ist quasi eine Apotheke, häufig mit einem Gesundheitskiosk. Es ersetzt aber nicht das, was wir eigentlich brauchen, sondern schafft eine weitere Struktur, wo gegebenenfalls die Menschen Anknüpfung ans Gesundheitssystem finden, die vielleicht keinen Hausarzt haben. Was wir brauchen, ist aber, dass Menschen besser an die Hand genommen und durch das Gesundheitssystem geleitet werden. Wir brauchen nicht noch eine zusätzliche Stelle, wo noch kleinere ambulante Entscheidungen getroffen werden. Zumindest in den USA sitzen in den Gesundheitskiosken dann sehr gut ausgebildete Krankenpfleger oder Krankenschwestern, die erweiterte Befugnisse haben, wie etwa Antibiotika oder Schmerzmittel zu verschreiben oder eben dann zum Arzt überweisen. Ich habe nichts dagegen, aber das löst nicht das Problem, das wir haben.
Ich habe nichts gegen Gesundheitskioske, aber sie lösen nicht unser Problem.
Wenn wir das also weiterdenken: Es gäbe dann in Zukunft die im Zuge der Krankenhausreform umgebaute Kliniklandschaft, und nach Ihrem Vorschlag gäbe es noch weitere ambulante Gesundheitszentren, die Vorarbeit und Weiterarbeit in der Versorgung leisten könnten – und dann gibt es noch die Hausärzte. Sollte sich bei denen auch etwas ändern?
Wir brauchen eine viel bessere Verknüpfung zwischen Hausärzten und Fachärzten. Denn bei der Übergabe eines Patienten von einem Arzt zum nächsten geht viel zu viel Wissen verloren. Natürlich wird uns da eine digitale Patientenakte helfen, aber auch dort müssen wir incentivieren, dass gemeinsam für und an dem Patienten gearbeitet wird. Oder auch, dass der Hausarzt die Befugnis bekommt, den Patienten durch das Gesundheitssystem hindurchzuleiten. Dass er der Ansprechpartner ist für die verschiedenen Maßnahmen.
Also könnte der Hausarzt im Sinne eines Lotsen fungieren?
Ja. Dazu gehört aber auch, dass er in den späteren Behandlungen viel mehr eingebunden wird und nicht den Staffelstab an einen Facharzt übergibt und dann raus ist aus der Behandlung. Ich würde mir wünschen, dass ein Patient immer einen Ansprechpartner hat. Aber auch das muss sich für den Arzt am Ende lohnen. Ich will gar nicht so tun, als ob es immer nur um Geld geht. Aber ein Arzt hat so wenig Zeit und auch ein Hausarzt hat so wenig Zeit, und wenn er einmal im Quartal sieben Euro dafür bekommt, mit einem Kollegen über seinen Patienten zu konferieren, dann würde der das mit größter Wahrscheinlichkeit sehr gerne tun, aber irgendwann hat er dann keine Zeit mehr für die anderen Patienten.
Ich habe zuletzt mit einem Hausarzt über genau diese Thematik gesprochen. Er brachte auch den Begriff Lotse auf, sagte aber, er sähe sich noch lieber als Lokführer. Der auch eine Verantwortung trägt für den gesamten Prozess, die gesamte Fahrt durch das Gesundheitssystem.
Das würde signalisieren, dass es jemanden gibt, der den Hut aufhat. Wo der Patient sich dann auch aufgehoben fühlt.
Das klappt aber nur, wenn Hausärzte dafür auch Zeit haben und auch die Verantwortung übernehmen wollen.
Und dürfen!
Alle an der Versorgung eines Patienten Beteiligten müssen gemeinsam vergütet werden und sich verantwortlich fühlen.
Was konkret müsste sich dafür jetzt als Erstes ändern?
Das Wichtigste ist, dass man nicht Entscheidungen über den Kopf von Interessengruppen hinweg trifft, sondern dass man wirklich versucht, hier gemeinsam eine Lösung zu finden. Es passiert viel zu häufig, dass jemand in diesem Gesundheitssystem bei einer Änderung nicht berücksichtigt wurde, und bei so einem radikalen Umbau wird das nicht funktionieren. Über den Versorgungspfad haben wir schon im ersten Teil des Interviews gesprochen, da ist entscheidend, dass alle an der Versorgung des Patienten Beteiligten gemeinsam vergütet werden und sich verantwortlich fühlen. Der Angelpunkt ist aber: Wir sehen ja, dass die Bürokratisierung immer mehr Probleme im Gesundheitsberuf macht. Ein Arzt ist kein Verwalter. Auch Krankenschwestern und Pfleger sind keine Bürofachkräfte, dafür haben sie diesen Beruf nicht ergriffen, um Formulare auszufüllen. Und die Regelung von DRGs, Abrechnungssystemen, aber auch viele Verantwortlichkeiten, die am Ende auf den Einzelnen abgeladen werden, der in diesem System arbeitet, das alles ist viel zu viel geworden.
Können Sie ein Beispiel aus dem Klinikalltag nennen?
Ich bin ja nur mit der Diagnostik in den Krankenhausbetrieb eingebunden, aber es geht jedem Instituts- und Klinikleiter so: Die Abteilung braucht Beauftragte für Brandschutz, Arbeitsschutz, Gentechnik, Medizinproduktegesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittel usw. Das sind alles Verwaltungsaufgaben, die zusätzlich neben der Arbeit ausgefüllt werden müssen. Ganz zu schweigen vom Qualitätsmanagement und zusätzlichen Richtlinien. Und das ist nur ein Bestandteil von mehreren, wo wir immer mehr Bürokratie erschaffen.
Was ist also zu tun?
Es ist kein einfacher Prozess, aber machbar: Man wird sich jedes Teilbereichs annehmen müssen und analysieren, wie die Schritte vereinfacht werden können. Ein schönes Beispiel, dass so ein Prozess funktioniert, ist Spanien, wie es die Richtlinien für klinische Studien vereinfacht hat. Deutschland ist in den letzten Jahren in der Anzahl durchgeführter klinischer Studien ins Hintertreffen geraten. Das liegt zum größten Teil an den nationalen Vorgaben und der Bürokratie. Einfach gesagt: Während Deutschland noch prüft, legen andere Länder bereits Ergebnisse vor. Die ethischen Vorgaben sind international, die haben andere Länder auch. Trotzdem sind sie schneller. Ein Land, das erkannt hat, dass man diese bürokratischen Prozesse vereinfachen kann, ist eben Spanien. Dort gibt es seit ein paar Jahren schon eine einheitliche Patientenaufklärung, ein einheitliches Vertragsmuster mit den Pharmakonzernen oder den Sponsoren. Sie haben klare Bewertungsregeln für die Ethikkommissionen, auf deren Grundlage entschieden wird. Dort gilt außerdem: eine Studie – ein Ethikantrag.
Wie ist es bei uns?
Bei uns muss man jeden Vertrag einzeln schließen, jede Universität und jedes Krankenhaus hat da andere Vorstellungen. Man muss jede Ethikkommission bei multizentrischen Studien befrieden. Das können dann schon mal ein gutes Dutzend Ethikkommissionen sein, für ein- und denselben Antrag. Die haben dann schlimmstenfalls jedes Mal unterschiedliche Änderungswünsche. Sodass es am Ende dazu führen kann, dass die Studie gar nicht zustande kommt. Zusätzlich gibt es auch noch europäische Regeln bezüglich der klinischen Studien als auch der Labordiagnostik, die den Prozess vereinfachen sollten, im Grunde aber eine zusätzliche Komplexität und mehr Bürokratie darstellen. Das lähmt.
Wer könnte das in die Hand nehmen, um es zu vereinfachen? Und an welcher Stelle müsste man da ansetzen?
Die Vereinfachung der Bürokratie oder die klinischen Studien?
Beides.
Die Verantwortung dafür trägt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Das muss in diese Strukturen einsteigen und zumindest die Koordination des Bürokratieabbaus im Gesundheitswesen leiten. Zum Beispiel könnte das BMG unter den Krankenversicherungen Standardanträge für bestimmte Genehmigungsverfahren koordinieren. Dazu muss man aber mit allen Beteiligten interagieren. Was bei klinischen Studien geht, geht auch auf dem Level der Entbürokratisierung des Gesundheitswesens.
Das heißt, Sie schlagen vor: Das BMG müsste eine neue Kommission einrichten zur Entbürokratisierung des Gesundheitswesens?
Ja. Ich scheue mich zwar zu sagen, es müsse schon wieder eine neue Kommission geben, aber im Grunde braucht es genau das.
Zum Schluss die Frage, die viele in Social Media umgetrieben hat, weil es offenbar falsch verstanden wurde: Ihnen wurde vorgeworfen, Sie würden Ärzte nur noch nach Heilungserfolg bezahlen lassen wollen, dabei schrieben Sie stattdessen von Behandlungserfolg. Was ist der Unterschied zwischen Behandlungserfolg und Heilung?
Es gibt verschiedene mögliche Erfolgsfaktoren. Allein schon, wie effizient Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden, sodass Behandlungen nicht wiederholt werden. Dass die Kommunikationsstruktur zwischen Hausarzt und Fachärzten funktioniert. Dass man gemeinsam an einem Patienten und dessen Behandlung arbeitet. Dass hier auch eine schonende Perspektive angewandt wird, dass der Patient nicht immer wieder zwischen stationär und ambulant hin- und herpendelt, sondern dass man unnötige Klinikaufenthalte vermeidet. Ich denke, ein Erfolg ist, wenn man aus der Sicht des Patienten schaut und es ist der bestmögliche Weg gewesen, die Behandlung durchzuführen, ohne unnötige Wiederholungen. Dass der Grad der Kooperation zwischen den Ärzten hoch ist, dass man Zeit für ein Arzt-Patienten-Verhältnis hat und dass die medizinischen Entscheidungen transparent gemacht werden. Ich hatte ganz klar gesagt: Es geht um elektive, also um geplante Eingriffe. Für etwas, wo man auf eine Gesundung zugeht, wie ein Hüftersatz oder ein neues Knie oder ein Varizen-Stripping oder Ähnliches. Wo man elektiv versucht, die Lebensqualität wieder zu verbessern oder wiederherzustellen.
Es braucht eine Kommission zur Entbürokratisierung des Gesundheitswesens.
Wie sieht es mit chronischen Krankheiten aus?
Erfolg kann man auch bei chronischen Erkrankungen messen. Wie gut ist zum Beispiel ein Diabetes eingestellt? Wie gut versteht der Patient, wie er mit der Erkrankung umgehen muss? Wie sehr belastet die Erkrankung den Patienten im Alltag? Ein Erfolg ist nicht daran gemessen, dass jemand unbedingt immer gleich gesund wird, denn das wird nicht immer gehen. Ein Erfolg ist, dass jemand die für sich bestmögliche Behandlung am effizientesten und am schnellsten bekommt und dabei eine hohe Patientenzufriedenheit verspürt.
Die Kritik lautete auch teilweise: Dann müssten Ärzte demnächst Bürgergeld beantragen, wenn sie Krebspatienten nicht heilen könnten.
Das ist doch Polemik. (lacht)
Es geht Ihnen also, um es noch mal konkret zu formulieren, nicht darum, dass Ärzte kein Geld bekommen, wenn sie nicht heilen können.
Natürlich nicht, das habe ich auch nie gesagt. Sondern es geht darum, die Effizienz und Versorgungsqualität zu steigern, und das erfolgt dadurch, dass man Erfolg nicht mehr daran misst, dass einzelne Leistungen erbracht werden, sondern dass die gesamtheitliche Behandlung im Zentrum steht. Es schrieb eine Zeitung auch von ergebnisorientierter Medizin, nur sind das gar nicht meine Worte. Im Grunde geht es darum, dass ein Patient auf keinen Fall lukrativer sein darf, weil er kränker ist. Denn aktuell gilt: Je mehr Diagnostik, desto attraktiver ist das für das Gesundheitssystem. Und das müssen wir ändern.