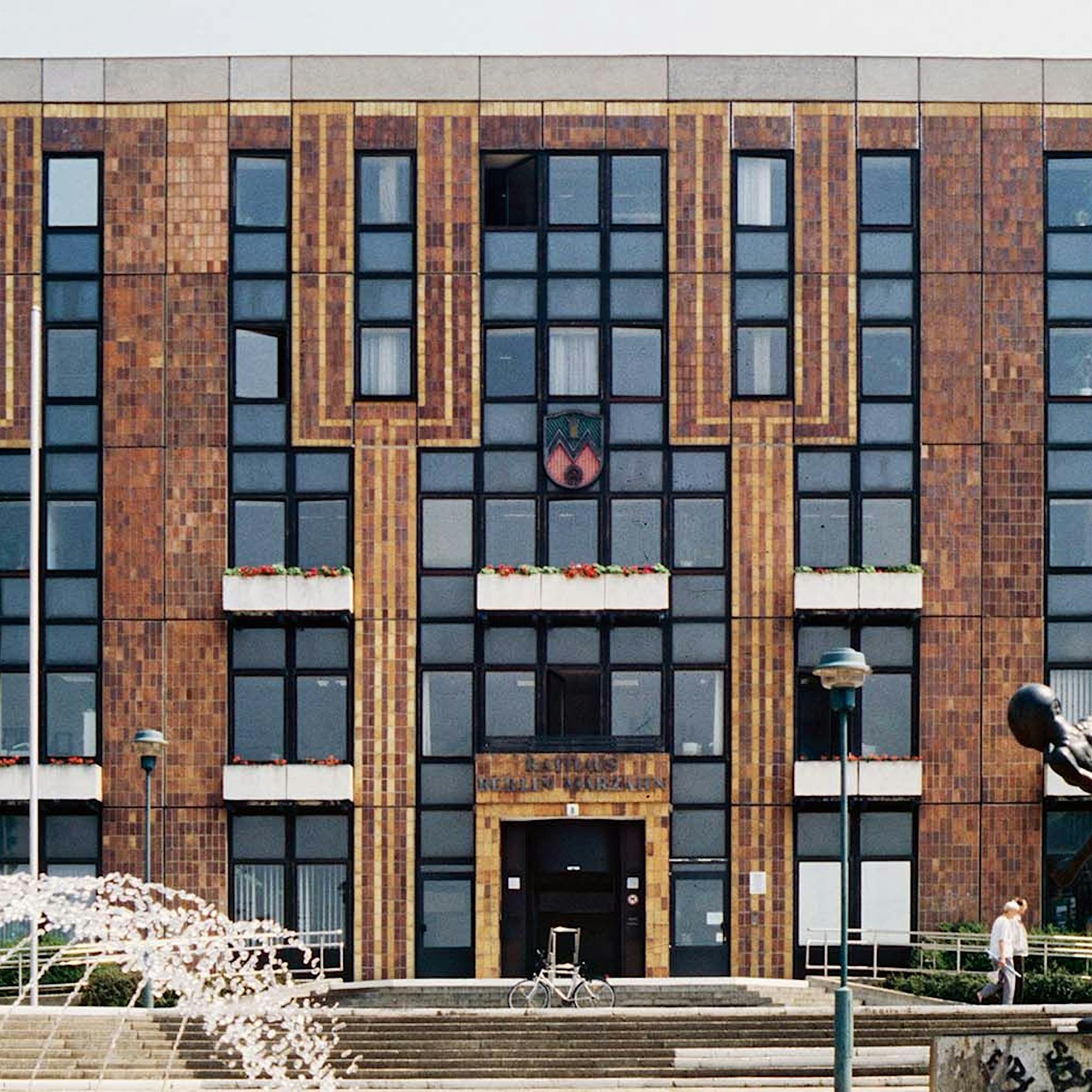Vor ein paar Wochen bin ich im Netz auf eine Dokumentation gestoßen. Sie ist mit „Marzahn, 1991“ überschrieben, ein YouTube-Nutzer, der alte VHS-Kassetten digitalisiert hat, hatte sie vor zwei Jahren hochgeladen. Ursprünglich hieß der Film „Von Gewalt halt ich nicht viel – nur mit Gewalt erreichst Du ne Menge“. Zwei Frauen haben damals, zwei Jahre nach dem Mauerfall, mehrere Jugendliche einen Sommer lang begleitet und sie immer wieder interviewt. Die meisten von ihnen waren rechts, hörten Störkraft und gaben an, Türken zu hassen, obwohl sie gar keine kannten.
Der Film hat mich emotional sehr aufgewühlt. Er ist ein Stück Zeitgeschichte, keine Frage, aber er vermittelt auch einen ziemlich heftigen Blick zurück in eine Zeit, in der sich auch meine eigene Kindheit und Jugend abspielte – in Marzahn, am Rande von Ost-Berlin, in einem Teil der Stadt, der mit so vielen Vorurteilen behaftet war und ist, dass ich mich selbst eine Zeitlang für ihn schämte.
Berichte und Dokus über Marzahn hatten oft den immergleichen Fokus, sie ließen dabei die vielen Jugendlichen außer Acht, die nicht so extrem aufwuchsen. Jugendliche wie meine Schulfreundin Sandra, die nie aus Marzahn weggezogen ist, die gern dort lebt, bis heute. Die sich immer wohlgefühlt hat und jeden Wandel, der durch ihre Siedlung ging, mitgetragen hat. Heute leben in Sandras Haus Menschen aus aller Welt, man kommt gut klar miteinander, erzählt sie mir. Auch wenn am Anfang viele Bedenken hatten. In einem Film über Marzahn ist Sandra nie vorgekommen. Sie polarisiert wahrscheinlich nicht genug.
Anders als die 15- und 16-Jährigen, die damals für „Marzahn, 1991“ vor der Kamera standen. Sie hießen René, Freddy, Doreen oder Jeannette. Damals hatte Marzahn knapp 170.000 Einwohner, davon waren 40 Prozent unter 25 Jahre alt. In der Doku herrscht viel Trostlosigkeit, die Jugendlichen sind gelangweilt, trinken Dosenbier, rauchen, hängen rum. Die Filmemacherinnen stellen ihnen viele Fragen. Und so kommt zunächst recht ungefiltert herüber, wie aufgeheizt die Stimmung zu dieser Zeit war.
Klischees über Marzahn: Kein falsches Bild, aber eben auch kein vollständiges
Ein paar Jungs berichten davon, wie sie ihre Tage verbringen, dass sie erst saufen und dann „einen aufklatschen“ gehen. Dass sie Vietnamesen abziehen, die vor der Kaufhalle Zigaretten verkaufen. Dazu wird Böhse-Onkelz-Musik eingespielt. Es ist das Bild von Marzahn, das das Image des Bezirks nach der Wende prägte, und das bei vielen immer noch nachwirkt. Es ist kein falsches Bild, aber eben auch kein vollständiges.
Wer genauer hinschaut, der sieht noch etwas anderes in der gut einstündigen Doku. Jenen kurzen Teil nämlich, in dem die Jugendlichen sich gegenseitig interviewen. Hier reden sie anders, vielleicht, weil sie untereinander sind. Es geht viel darum, ob man links oder rechts ist, aber man merkt, dahinter stehen oft keine ausgereiften Gedanken. Man spürt vielmehr eine Orientierungslosigkeit, den Wunsch, dazuzugehören.
Manche der Jugendlichen sind bereits das erste Mal arbeitslos geworden, weil die Betriebe, in denen sie eine Lehre begonnen haben, dichtgemacht wurden. Auch die Eltern sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Man schimpft auf Deutschland, auf den Westen. Damals schon, noch nicht mal ein Jahr nach der Wiedervereinigung.
Jugend im Marzahn der Neunzigerjahre: Der Wunsch, dazuzugehören
1991 war ich 12 Jahre alt. Ich ging noch nicht in Jugendclubs, den Treff in der Bärensteinstraße, um den herum die Filmaufnahmen entstanden sind, kenne ich nicht. Meine Jugend im Marzahn nach der Wende war weniger krass als die der jungen Leute im Film. Aber ich erinnere mich sehr wohl daran, dass man mit den falschen Klamotten schnell Probleme kriegen konnte. Daran, dass ich mit meinem Pali-Tuch um den Hals in manchen Gegenden Angst hatte, den Mädels mit den Bomberjacken zu begegnen.
Ich weiß aber auch noch, wie stark damals der Wunsch war, zu einer coolen Clique zu gehören. Gerade in einer Zeit der Umbrüche, in der so viel Neues auf uns einprasselte. Dass es bei mir eine linke Gruppe wurde, hatte mit meinem Umfeld zu tun. Mit anderen Freunden wäre vielleicht alles anders geworden. Wir waren jung, labil, leicht beeinflussbar. So wie die Jugendlichen im Film.

Wer vorschnell über Marzahn urteilt, der vergisst oft, dass es zu DDR-Zeiten ein Privileg war, dort zu wohnen. Meine Eltern lebten vorher in Prenzlauer Berg; zwei Zimmer, 46 Quadratmeter, Kohleheizung, kein Bad. Im Sommer duschten wir uns draußen auf dem Balkon mit einem Eimer ab, im Winter stiegen alle in eine Plastewanne im Wohnzimmer. Spätestens 1983, als mein kleiner Bruder unterwegs war, musste eine neue Bleibe her.
Draußen in Marzahn zogen sie im Eiltempo Verlockendes hoch: Vier-Zimmer-Wohnungen mit Zentralheizung und Wannenbädern, dazu kompletter Schul-, Einkaufs- und ÖPNV-Infrastruktur. Um eine dieser begehrten Neubauwohnungen zu bekommen, leistete mein Vater Hunderte Arbeitsstunden ab. Nach seiner eigentlichen Arbeit malochte er im Straßenbau, schleppte Steine für die Großsiedlung, die bald darauf für mehr als zehn Jahre unsere Heimat werden sollte. Meine Eltern waren froh, als wir Ende 1983 endlich nach Marzahn ziehen konnten. Den Prenzlauer Berg vermissten sie nicht.
Dass wir Mitte der Neunzigerjahre aus Marzahn wegzogen, hatte nichts damit zu tun, dass es dort so schrecklich gewesen wäre. Meine Eltern wollten ein Haus bauen, also zogen wir weg aus Berlin. Ich wäre lieber in Marzahn geblieben, vermisste die Großstadt und meine Freunde. Wenn wir uns fortan trafen, dann meist in der Mitte der Stadt. Nach Marzahn kam ich lange nicht mehr zurück. Ich dachte auch nicht viel daran.
Wenn mich in meinen Zwanzigern jemand fragte, woher ich komme, sagte ich „Berlin“. In Baden-Württemberg, wo meine Eltern inzwischen gelandet waren, präzisierte ich nur auf Nachfrage: „Ost-Berlin“. Den wenigen, die es noch genauer wissen wollten, erzählte ich, dass ich mal in Marzahn gewohnt habe.
Gleichzeitig bestand ich darauf, eigentlich aus Prenzlauer Berg zu kommen. Als hätten mich ein paar Kleinkindjahre mehr geprägt als die Dekade in Marzahn. Aber Prenzlauer Berg klang auf einmal so viel besser als Marzahn, zu dem den meisten außer „Platte“ und „Nazis“ nicht wirklich etwas einfiel.
Also distanzierte ich mich von meiner eigenen Herkunft, ohne mir einzugestehen, dass in mir sehr viel Ost-Berlin und auch sehr viel Marzahn steckte. Ich hatte im Studium an der FU viel mit West-Berlinern und Westdeutschen zu tun. Mein damaliger Freund, ein Musiker aus gutem Zehlendorfer Hause, wollte über meine Wurzeln nichts wissen. Vor seinen Eltern verleugnete er mich.
Erstes Date im Plattenbauviertel: Ein Blick aufs alte Kinderzimmerfenster
Viele Jahre später lernte ich einen Mann kennen, der mir ohne Umschweife sagte, er käme aus Marzahn. Für unser erstes Date fuhren wir mit der Straßenbahn raus in unsere alte Heimat. Er zeigte mir seinen Zehngeschosser in der Paul-Schwenk-Straße, ich ihm mein altes Kinderzimmerfenster in der Trusetaler.

Es fühlte sich merkwürdig an, nach so vielen Jahren wieder dort zu sein. Aber jetzt war da jemand an meiner Seite, der auch hier aufgewachsen war, der auch „Wohngebietspark“ sagte und im Hausaufgang Kartenkloppe gespielt hatte. Der als lässig-linker Skater die Angst kannte, an der nächsten Ecke den Falschen zu begegnen. Der dennoch mit seiner Clique eine gute Zeit hatte. Der meine Zerrissenheit teilte.