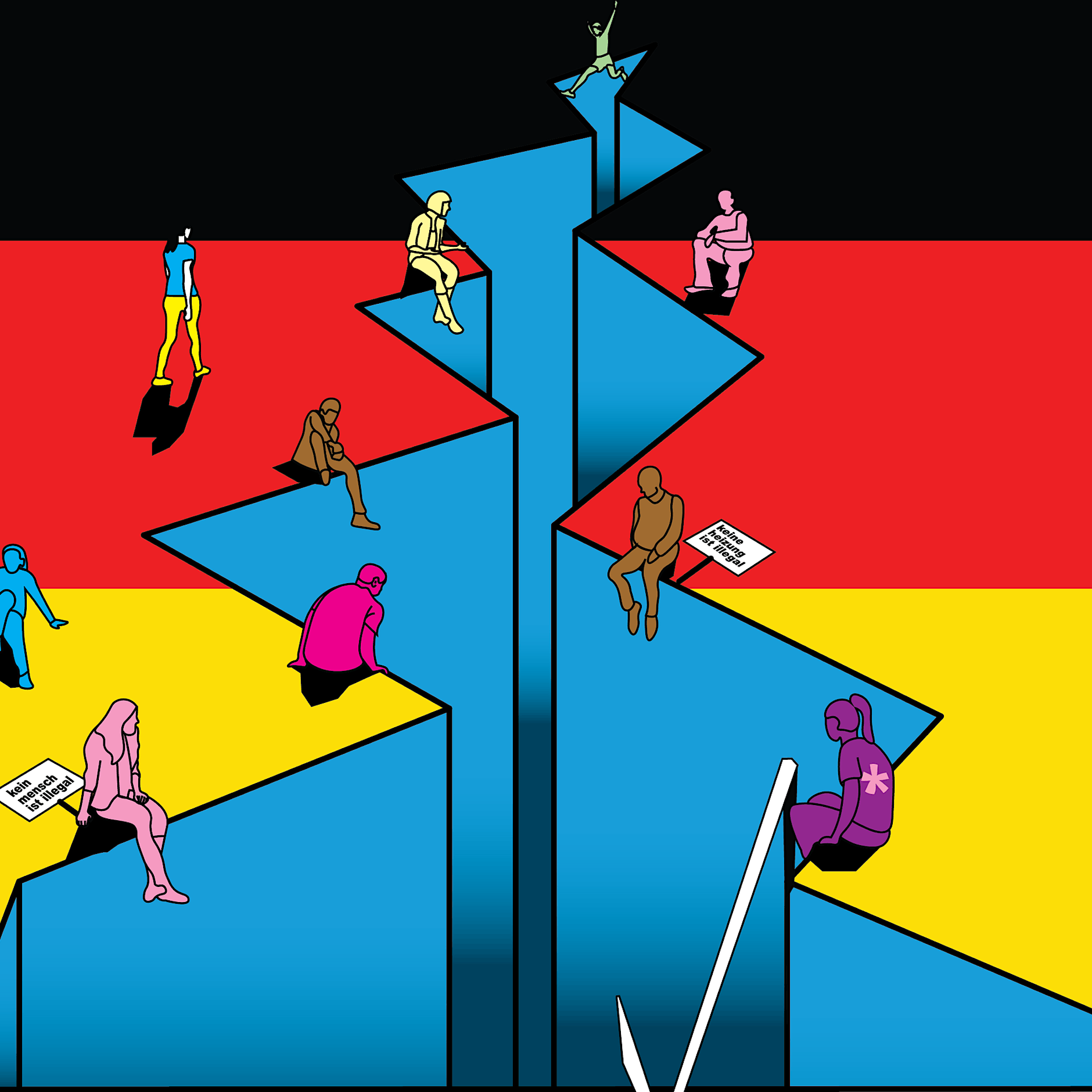Da ist dieser Wal, der einsamste Wal der Welt, heißt es. Irgendwo zwischen den Aleuten und der Südküste Kaliforniens soll er leben und doch hat ihn noch nie ein Mensch gesehen. Nur gehört, erstmals vor über dreißig Jahren. Seitdem ist der Wal ein Rätsel, umgeben von einem Mysterium, das in einem Geheimnis steckt. Selbst nach der von Leonardo DiCaprio produzierten Dokumentation „The Loneliest Whale“ bleibt es ungelöst.
Immer wieder haben Forscher seine Gesänge empfangen, auf einer Frequenz von 52 Hertz, und das klingt, als hätten zwei müde Klabautergeister Mühe, eine rostige Unterwasserdraisine in Bewegung zu setzen. Seine Artgenossen verstehen den 52-Hertz-Wal leider nicht, sie ahnen nicht einmal, dass es ihn gibt. Er singt einfach zu hoch für sie.
Ist dieser Wal deshalb einsam? Oder ist Einsamkeit manchmal ein Special Effect des Glücks?
Dann ist da Hans, etwa zehn Jahre alt, er sitzt oft auf einem Findling am Seeufer, wirft Steine ins Wasser, das seine Gedanken in konzentrischen Kreisen davonträgt. Hans ist der König einer namenlosen Insel, Entdecker einer namenlosen Welt, die Ostdeutschland sein könnte, geworfen in eine unbestimmte Zeit, die Sechzigerjahre vielleicht. Mit seinen an Gefühlen und Worten armen Eltern ist er auf diese Insel geflohen. Raus aus der Stadt und weg von Karl-Georg, dem Kalle, mit dem Hans so gerne Verstecken spielte oder Krieg.

Ist er ein Hans im Unglück? Oder kann er nicht ein lebenslanges Freundschaftsband knüpfen mit der Einsamkeit, seiner Insel?
Und da ist er, der Berliner Autor Dirk Gieselmann, 44, ein äußerlich in sich ruhender Kuschelbär von einem Mann, den man als Hipster missverstehen könnte. Am Telefon sprechen wir über seinen Debütroman „Der Inselmann“, in dem der 52-Hertz-Wal mehrmals, nun ja, auftaucht, Hans der Protagonist ist und die Frage, ob Einsamkeit schön oder traurig oder beides zugleich sein kann, Tier und Jungen miteinander vertäut.
„Der Wal half mir dabei, die Offenheit dieser Frage auszuhalten“
Gieselmann sagt, und die aus dem Balkonhintergrund zwitschernden Vögel scheinen ihm beipflichten, dass wir Menschen zwar geneigt seien zu glauben, der Wal müsse traurig sein. Er habe aber ein Interview mit einem Ozeanologen gelesen, darin die Warnung, den Wal zu vermenschlichen, ihn zu verkitschen. (Okay, dann ist das mit dem Vogelgezwitscher natürlich totaler Quatsch.)
Aber was ist mit Hans, dem das Leben so viele fiese Wunden schlägt, dass er verschalt und verkrustet und daraus eine Kraft zieht, die ihn schier unverwundbar macht, aber eben auch unzugänglich für zwischenmenschliche Beziehungen, was ihn letztlich zu einem 52-Hertz-Menschen macht – ist er trotzdem glücklich? Gieselmann sagt: „Der Wal half mir dabei, die Offenheit dieser Frage auszuhalten.“
So ab 2017 und bis ziemlich genau Mitte Februar 2019 war Dirk Gieselmann der heißeste Scheiß auf dem deutschen Reportermarkt. Beim Fußballkulturmagazin 11 Freunde – dort arbeiteten wir 2006 ein halbes Jahr zusammen und standen danach, ohne sie zu übertreten, an der Schwelle zur Freundschaft – mistete er den Textbaukasten aus, feuilletonisierte den Liveticker und setzte mehr Pointen, als Messi und Ronaldo Tore schießen konnten. Gieselmann gewann Journalistenpreise. Er trug jetzt einen Bart. Seine ohnehin kargen Textnachrichten wurden kryptisch.
Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung und auch mal der Spiegel klopften an, sie buhlten, fast rissen sie sich um ihn. Weil Gieselmann-Texte mit eingeschliffenen Lesegewohnheiten brachen. Weil er die schönsten Symptome fürs Alleinseinwollen kannte und die tragischsten Einheiten fürs Scheiternmüssen auch. Und so schickten sie ihn los – irgendwas ist immer – auf die Erotikmesse Venus, zu einem Konzert von Matthias Reim oder ins laut TripAdvisor beste und schlechteste Hotel nach Paris. Er kehrte immer mit zwei Handvoll Sätzen zurück, die als Tagesliteratur durchgingen. Da musste also noch etwas kommen.
Als Claas „Münchhausen“ Relotius von der Kanonenkugel fiel
Doch erst mal kam jener Februar 2019, der unweigerlich auf den Dezember 2018 folgte, als der Starreporter Claas „Münchhausen“ Relotius – hier bitte „Little Lies“ von Fleetwood Mac oder andere dazu perfekt passende Songzeilen mitsummen – von seiner Kanonenkugel stürzte und mit ihm der Spiegel in eine Glaubwürdigkeitskrise. Überall machten sich nun Textdetektive auf die Suche nach großen Fälschern oder kleinen Schummlern - und fanden, Zittern, Aufatmen, nur Gieselmann.
Um ihm die Verletzung von journalistischen Standards nachzuweisen, riefen die Inquisitoren sogar eine alte Erzieherin an, die bezeugen sollte, ob das stimmte, was Gieselmann, ihr ehemaliges Kindergartenkind, Jahrzehnte später über sich geschrieben hatte: dass er nämlich schüchtern sei. In diesem Text, „Mein Leben als Igel“ (Zeit-Magazin, 2017), standen dann jene zwei Sätze, die als Beweis für alles herhalten mussten: „Irgendwann, denke ich, muss doch auffallen, dass ich dieses Handwerk gar nicht recht beherrsche. Seit über zehn Jahren lebe ich nun schon mit dieser Angst aufzufliegen.“
Wer schüchtern ist, zweifelt an sich. Impostor-Syndrom nennt man das. Jedenfalls war Gieselmann, der Igeljournalist, der sich zu alldem nicht äußern möchte, vorerst erledigt.
Nicht nur deswegen, aber deswegen auch entstand der Plan, einen Roman zu schreiben. Gieselmann hatte jetzt die Zeit dafür, den Mut nahm er sich. Und diese real existierende Insel irgendwo im Osten, dazu die Legende, die er gehört hatte, das Schauermärchen, wonach dort draußen ein Eremit leben sollte, das konnte sein Stoff werden.
Gemeinsam mit einem befreundeten Fotografen mietete er also ein Boot, dann setzten sie über, obwohl man sie gewarnt hatte vor diesem Inselmann. Um die Sache nicht unnötig spannend zu machen: Ja, da lebte tatsächlich ein Mann, mit Unterbrechungen seit sechs Jahrzehnten schon. Aber nein, als literarische Vorlage taugte er kaum. Er war kein Hans.
„Wir saßen plötzlich alle wie auf einer einsamen Insel mit Distanz zur Außenwelt“
Doch in dieser Begegnung, sagt Gieselmann, begann sein neues Nachdenken über Einsamkeit, Weltabgewandtheit, eine zwangsläufige Zurückgezogenheit ins Ich, die Natur: „Und wie seltsam schön das alles sein kann.“ Vor der Pandemie wäre ein Inselmannroman eine verlockende, seichte Utopie gewesen. Dann habe Corona die Perspektive auf Einsamkeit verändert. „Wir saßen plötzlich alle wie auf einer einsamen Insel mit Distanz zur Außenwelt, in der ein Fuchs die Kontrolle über den Park übernahm.“
Der Schriftsteller Gieselmann musste sich vom Journalismus entfernen, eine neue Sprache finden, weg von Pointen und billigen Effekten, wie er sagt. „Ich habe eine Art archaische Sprache gesucht, die dem Naturraum gerecht wird, in den Hans gerät.“ Er legte sich einen Kanon an basalen Wörtern zurecht: Stein, Feuer, Wasser, Himmel, Mann, Frau, Junge. Dazu das Vokabular eines Zehnjährigen, hundert Wörter, mit denen er sich die Welt erschließe. „Dann ging es darum, diesen Kanon aufzufächern in seiner Bedeutungsvielfalt: Wie ist denn ein Stein beschaffen, wenn er die Kälte speichert im Winter? Und was geschieht mit dem Stein nach einem heißen Sommertag?“
Herausgekommen ist, falls es das gibt, ein Coming-of-Age-Abenteuer-und-Natur-Gedicht im Gewand einer Sage, die an keinen aktuellen Diskurs andocken will. Was wahrlich befreiend ist! „Der Inselmann“ ist eine Leseflucht und die Reise in eine unvoreingenommen staunende Fantasie eines heranwachsenden Kindes, das sich fragt: Wie schwer sind eigentlich Gespenster? Wo übersteht das Frühjahr den Winter? Merkt der See, wenn ich in ihn weine?