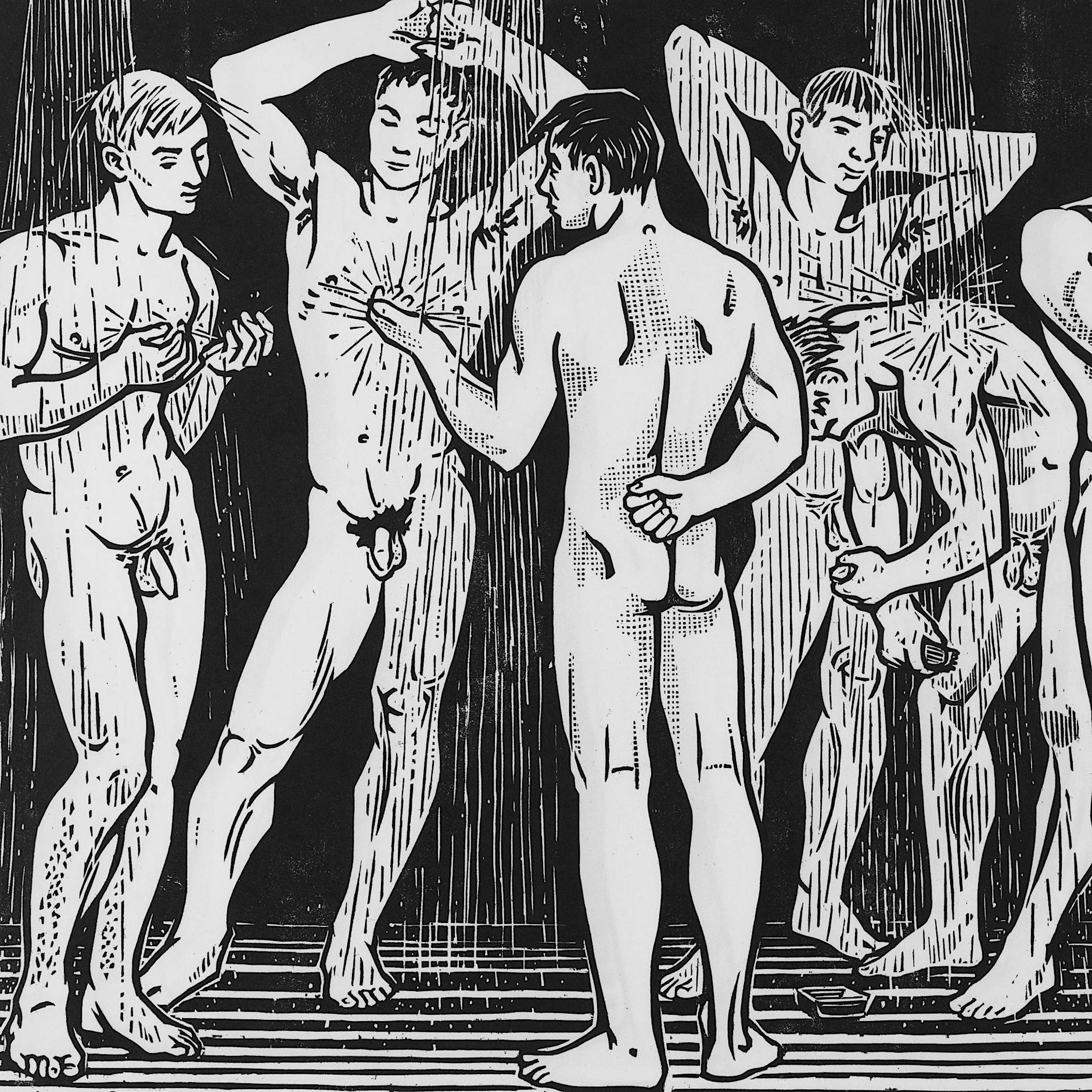Wir treffen uns in der Galerie Parterre in Berlin-Prenzlauer Berg, Danziger Straße 101. Hier ist derzeit eine Fotoausstellung über die Schönhauser Allee zu sehen, und in diesem Rahmen findet am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr die Veranstaltung „Queerer Osten“ mit Peter Rausch statt: ein Gesprächsabend darüber, wie der Prenzlauer Berg zu einem Zentrum der queeren Emanzipationsbewegung in der DDR wurde.
Berliner Zeitung: Herr Rausch, Sie sind 1950 geboren, 1968 wurde in der DDR der Paragraf 175 abgeschafft. Hat das für Sie gereicht, in dem Sinn, dass Sie keinen Sex haben mussten, der als illegal galt?
Peter Rausch: Hat nicht gereicht. In meiner aktiven sexuellen Zeit hatte ich den Paragrafen noch zwei Jahre.
Haben Sie das als ungerecht empfunden?
So viel Selbstbewusstsein hatte ich damals noch nicht. Ich dachte mir, wenn die DDR so ein Gesetz hat, wird das wohl richtig sein, und ich bin der Verbrecher. Aber zum Glück ist Sexualität stärker. Die sorgt dafür, dass sie zu ihrem Recht kommt. Man konnte in der Großstadt auch damals schon ein schönes Sexualleben haben, wenn man den Eingang gefunden hatte.

Wo war denn der Eingang in Berlin?
Ich habe den 1965 durch eine Sendung des SFB über die Verhältnisse am Bahnhof Zoo gefunden. Für die DDR war das ein Beispiel für den dekadenten, verfaulenden Kapitalismus. Mir war dann klar, wo sich die Schwulen in Ost-Berlin treffen, nämlich am Alex. In einer unterirdischen Klappe, also einer öffentlichen Toilette neben dem Berolina-Haus. Ich war damals in der Gartenstraße im Schwimmsport, und danach gab es eine halbe Stunde, über die meine Mutter keine Kontrolle hatte. Ich also hin, da standen lauter Männer an den Pissrinnen. Aber es passierte nichts. Drei Wochen später ging ich wieder hin und zwinkerte dem Ersten zu, der zu mir rüberguckte. Er hat dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Vier Wochen später holte ich mir dort den ersten Mann. Sex hatten wir in einer öffentlichen Toilette am Märkischen Ufer. Aber man lief in seinen Anfangsjahren schon mit einem schlechten Gewissen herum.
War das weg, nachdem der Paragraf abgeschafft worden war?
Nein. Der wurde ja klammheimlich abgeschafft, es gab keine öffentliche Diskussion. Man konnte sich keinen Standpunkt bilden.
Warum wurde er denn abgeschafft?
Es gab den Mythos, dass die damalige Justizministerin Hilde Benjamin zwei schwule Söhne hatte, also ein persönliches Motiv. Das ist durch nichts belegt. Den Kampf gegen den Paragrafen 175 gab es ja schon in den 20er- und 30er-Jahren. Die fortschrittliche bürgerliche Welt, Kommunisten und Sozialdemokraten hatten sich zum Ende der 20er-Jahre geeinigt, dass der Paragraf wegmüsse. Aber dann ergriffen die Nazis die Macht. Es gab also proletarische Kräfte, die für die Abschaffung waren, und die DDR hätte den Paragrafen gar nicht erst einführen müssen. Aber Wilhelm Pieck wollte ihn wohl beibehalten. Dr. Rudolf Klimmer, Arzt und Sexualwissenschaftler, Ludwig Renn, Schriftsteller, und wohl auch Johannes R. Becher, DDR-Kulturminister, die selber schwul waren, setzten sich dagegen ein, aber das hat nicht gereicht.
Das Gesetz ist das eine, das andere ist das gesellschaftliche Klima. Wie war es damit?
Die DDR war heteronormativ. Das ist auch ein Grund, warum sie scheitern musste.

Sie haben sich dann bald in der homosexuellen Szene engagiert. Wie kam das?
Im Zusammenhang mit der Flower-Power-Bewegung in den USA und der Studentenbewegung in Westeuropa entstanden Anfang der 70er Emanzipationsgruppen für Lesben und Schwule. Und wir hatten Kontakt zu denen. Die kamen immer mal rüber nach Ost-Berlin. Hauptanlaufpunkt war die Mocca-Bar im Hotel Sofia in der Friedrichstraße. Da traf der Michael Eggert die Schwestern aus dem Westen. Die schwärmten ja für den Osten, waren linksorientiert, wollten mit der Arbeiterklasse zusammenarbeiten. Aber die Arbeiterklasse in Ost und West wollte mit Schwuchteln nichts zu tun haben. Micha schleppte die West-Berliner Jungs aus der HAW (Homosexuelle Aktion West-Berlin) und den anderen Gruppen zu mir nach Hause. Ich hatte damals in der Rathausstraße gleich am Alex meine Wohnung. Die brachten ihre Infoblätter, Grundsatzerklärungen und Zeitschriften mit. Das war Anfang 1972. Wir haben ein Dreivierteljahr diskutiert, ob man das nicht auch in der DDR machen könnte. Erst mal traute sich keiner, dann aber waren wir doch zu dritt mit Lust auf Emanzipation. Am 15. Januar 1973 lief kurz vor Mitternacht in der ARD der Praunheim-Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Den sahen wir bei mir zusammen. Zwei Wochen später sagte Micha: Das ist jetzt unser Gründungstermin.
War das dann die HIB, die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin?
Ja, noch ohne den Namen HIB. Anfangs nannten wir uns nur: die Gruppe. Wir wollten Familie sein für den Kreis der Macher. Kommunikation und Selbsthilfe in der schwul-lesbischen Subkultur leisten. Und Partys, na klar. Und drittens das Gespräch mit der heterosexuellen Öffentlichkeit suchen.

Hatten Sie Räume?
Wir begannen mit Sonntagsnachmittagsveranstaltungen in wechselnden Wohnungen. Und wir bemühten uns bei den örtlichen Organen der DDR um ein Kommunikationszentrum. Wir gingen zur Ehe- und Sexualberatungsstelle in Mitte, zur Abteilung Kultur beim Magistrat, ins Haus der Gesundheit.
Wie war die Resonanz?
Ich sag es mal am Beispiel der Ehe- und Sexualberatungsstelle. Alle vier Wochen hatten wir da Gespräche, -spräche, -spräche mit Frau Dr. Otto, der damaligen Leiterin. Unser Wunsch war es, dort einmal in der Woche Beratung anzubieten. Doch die Gespräche versandeten, nach unserer Kenntnis pure Absicht. Ähnlich lief es bei den anderen Stellen auch. Der Teufelskreis war ja folgender: Es gab in der DDR kein Vereinsrecht. Wer also öffentliche Arbeit leisten wollte, musste unter das Dach einer Gesellschaft wie Kulturbund, FDGB, FDJ, Kirche usw. schlüpfen. Diese Gesellschaften aber verschlossen ihre Türen vor lesbisch-schwuler Emanzipation. Vor deren Türen etwas aufzubauen, war aber illegal. Über die Jahre versuchten wir mit Zeitungen, Zeitschriften, Fachleuten, örtlichen und staatlichen Einrichtungen bis zum Gesundheitsministerium, Innenministerium und Ministerrat zu kommunizieren. Schließlich landeten wir 1978 im Rechtsausschuss der Volkskammer. Wir haben dann mit viel Mühe eine Eingabe bei der Volkskammer durchgebracht, die an den Ministerrat weitergeleitet wurde. 1979 wurden wir zu einem Gespräch geladen: Nein, Sie kriegen kein Kommunikationszentrum, wir fördern in der DDR die heterosexuelle Familie, nicht die Homosexualität. Das war dann der Schlusspunkt der HIB, die offiziell sowieso nicht existiert hatte. Nach und nach hat uns die DDR die Luft abgedreht.

Inwiefern noch?
Wir haben immer mal Gaststätten für Partys gemietet: die Bärenschenke in der Friedrichstraße, einen Jugendclub oder Die gemütliche Ecke in Lichtenberg. Die Wirte hatten kein Problem mit uns, aber eben das Erlaubniswesen. Man brauchte für alle Veranstaltungen in der Öffentlichkeit eine Genehmigung der Polizei. Anfangs klappte das mit den Erlaubnissen. Als sich aber herumgesprochen hatte, wer wir waren, gab es keine Genehmigung mehr. Selbst kleine Tricks – zum Beispiel versuchten ein Mann und eine Frau aus unserer Gruppe ihre „Verlobungsfeier“ anzumelden – halfen nichts. Ausflüge mit Dampfer oder historischer Straßenbahn oder 30 Karten für „Tod in Venedig“ und 30 Karten für „Cabaret“ im Filmkunsttheater Studio-Camera Oranienburger Straße oder selbst gemachte Führungen durchs Scheunenviertel blieben uns. Wir machten unser Happening nun auf der Straße.
Und dann?
Wir lernten Charlotte von Mahlsdorf kennen. Sie hat uns die Räume im Keller ihres Gründerzeitmuseums angeboten, dort stand die Einrichtung der Mulackritze, dieser, sagen wir mal, „queeren“ Kneipe des Scheunenviertels aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo auch Nutten und Kleinkriminelle verkehrten. Dort machten wir unsere Sonntagsveranstaltungen als HIB. Es ging um Beratung: Sexualität und Partnerschaft, Homosexualität im Alter, Aufklärung zu Geschlechtskrankheiten und wo kann man gut Urlaub machen.
Wo konnte man das denn?
Budapest. Da konnte man echte Jeans kaufen. Und es gab dort diese Thermalbäder, die natürlich Treffpunkte waren. – Nach der Beratung gab es in Mahlsdorf Kaffee und Kuchen und eine Veranstaltung, wie am 9. Januar 1977 zum Beispiel „Haltung zur Sexualität und Homosexualität in der dt. Arbeiterbewegung“ als Vortrag und Diskussion. Wir hatten auch mal einen schwulen Vogelstimmen-Imitator im Programm. Ab 1975 gab es unser eigenes Kabarett, das Hibaré. Wir waren spielfreudig. Und auf den großen Partys haben wir dann auch Kabarettprogramm gemacht. War eine schöne Zeit. 1978 wurden unsere Sonntage bei Charlotte verboten. Die DDR hatte das Recht dazu, und Charlotte hatte Angst und Sorge um ihr Gründerzeitmuseum.
Gab es nicht auch Gaststätten als ständige Treffpunkte?
In den 60er.Jahren traf man sich in der Friedrichstraße. Man flanierte Sonnabendnachmittag dort lang und traf alle fünf Meter Bekannte. Es gab in der Friedrichstraße damals auch einige Kneipen, die Mocca-Bar eben und das Johannis-Eck und die G-Bierbar. In den 70er-Jahren wurden aus der Mocca-Bar und dem Johannis-Eck Intershops. Aber es gab in der Friedrichstraße bis nach der Wende die City-Klause und die Bärenschenke am Oranienburger Tor.

Waren Sie eigentlich bei der NVA?
Drei Jahre, von 18 bis 21. Ich hatte damals schon ein umfangreiches Sexualleben und bin dann immer schwarz nach Berlin gefahren. Das eine Mal dann hatte mich die Polizei im Friedrichshain hochgezogen. Die Polizei hatte immer viel Spaß, die Schwulen dort aufzuscheuchen. Ich war eine Woche im Militärknast. Als ich rauskam, wussten alle Bescheid. Ich hab keinen an mich rangelassen, das hat einigermaßen funktioniert. Natürlich gab es auch in der NVA Homosexualität, nur dass ich das erst nach meiner Militärzeit erfuhr.
War der Friedrichshain eine Cruising-Aerea?
Das Cruising ist dort so richtig in den 70er-Jahren entstanden. Vorher bis zur Wende gab es noch die Sauna in dem Schwimmbad der Gartenstraße. Da habe ich die wichtigsten Personen meines Lebens kennengelernt. Mitte der 70er-Jahre aber konnte man an einem Sommerabend durch den Friedrichshain gehen und rechts und links standen Männer. Es war wie bei einer Parade. Auch was die Kneipen angeht, hatte sich die Szene in den 70ern ausgeweitet und in den Prenzlauer Berg verlagert.
Erzählen Sie!
Es gab die Schoppenstube gegenüber von Konnopke und schon seit den 50er-Jahren das Café Peking an der Kastanienallee, Ecke Schönhauser, als die DDR noch Freundschaft mit China hielt. Als sich das änderte, wurde das Café Peking zum Café Ecke Schönhauser. Anfang der 70er wurde es renoviert und war nur noch bis zehn Uhr geöffnet. Daraufhin hat die Szene sich den Burgfrieden in der Wichertstraße ausgesucht. Als das Café Peking, wie wir es immer noch nannten, wieder bis ein Uhr aufhatte, haben wir es zurückerobert. Und als das Café Senefelder am Senefelder Platz Mitte der 70er-Jahre von einem lesbischen Paar übernommen wurde, haben wir das zu einem schwul-lesbischen Café gemacht.

Und der Sonntags-Club?