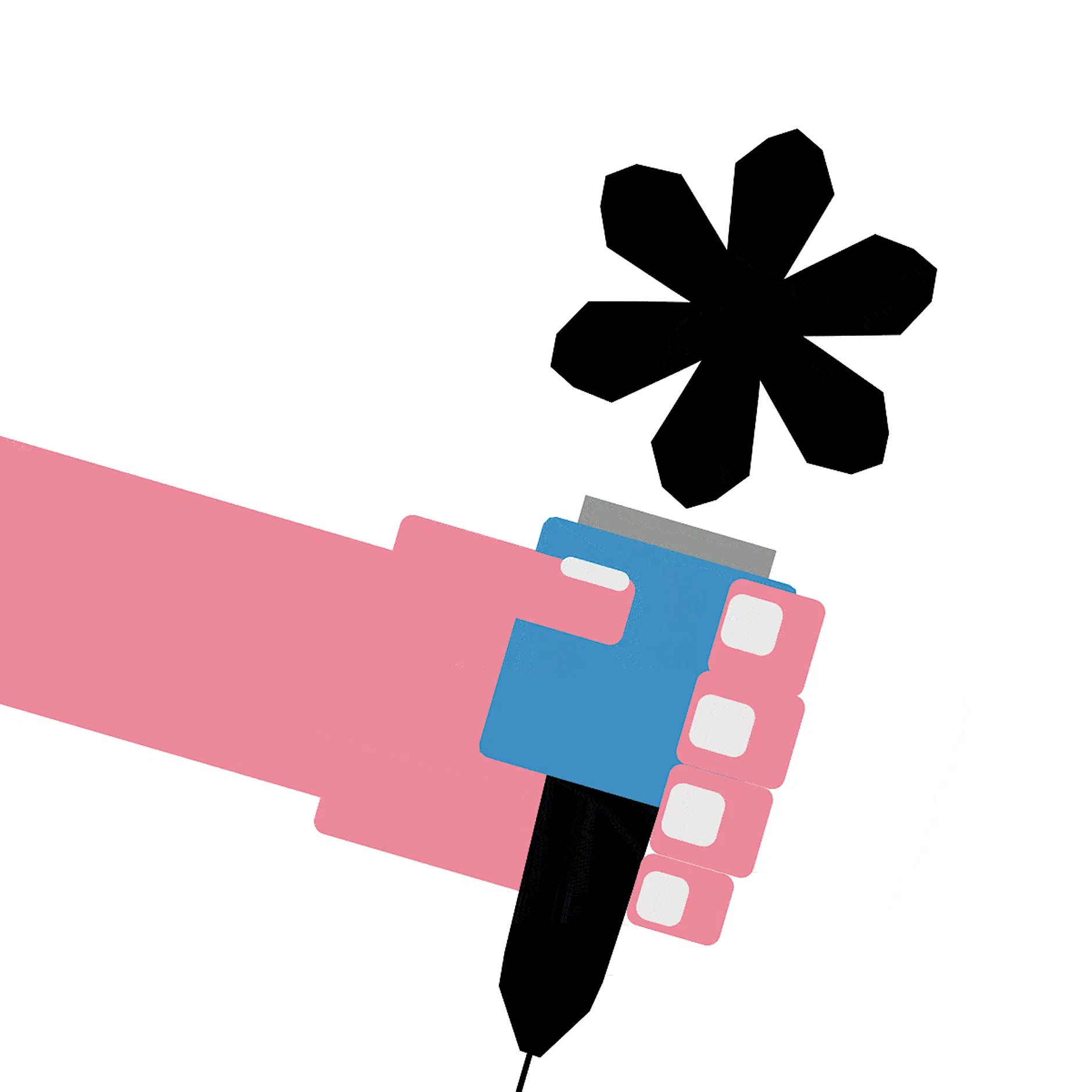Etwa jeder hundertste Mensch stottert. Hierzulande sind es insgesamt reichlich 800.000 Leute, ein Prozent der Bevölkerung. David Hugendick hat das freundlicherweise einmal umgerechnet: Es gibt mehr Stotterer in Deutschland „als zum Beispiel Ferrari-Besitzer. Mehr Stotterer als Profifußballer. Auch mehr Stotterer als Hochschulprofessoren, und die trifft man ja dann und wann“.
In seinem Buch „Jetzt sag doch endlich was“ umkreist der Autor, geboren 1980 in Bremerhaven, Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit, sein … Problem? Sein Handicap? Sein auffälliges Anderssein? Unsicher, wie er das Stottern nennen soll, schlägt er ganz unterschiedliche Begriffe vor. Sie lassen die persönliche Fallhöhe ahnen, in die er je nach Situation kommt: Defekt, Dysfunktion, Fehler, Krankheit, Gebrechen, Schaden, Knacks. Nach wissenschaftlicher Definition ist es eine neurophysiologische oder Redeflussstörung.
Endgegner D und W
Nicht jeder stottert gleich, kein Stotterer stottert immer. Wer aber nach der Pubertät noch davon betroffen ist, wird es nicht mehr los. Und da gehe es den Stotterern, lernte der Autor von einer Sprechtherapeutin, wie den Alkoholikern. Er erklärt die logopädisch diagnostizierten drei Formen der Sprechstörung und beschreibt auch, wie sich das Problem bei ihm selbst im Moment des Sprechenwollens darstellt. Einmal erinnert er sich an seinen Versuch, ein Stückchen aus Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ laut vorzulesen – und beim ersten „die“ am D hängenblieb. Für uns Leser hat er die Pause übersetzt in Buchseiten. Es sind drei.

Das D ist ein „Endgegner“, ein besonders gefährlicher Konsonant. Hugendick räumt ein, über eine Namensänderung nachgedacht zu haben. Das W ist übrigens auch sehr schlimm.
In der Geschichte gab es Versuche, dem Stottern mit Apparaten beizukommen. Der für seine Leistungen in der Chirurgie allgemein gefeierte Berliner Arzt Johann Friedrich Dieffenbach schnitt im 19. Jahrhundert an den Zungen herum, um sie gefügig zu machen. Erfolglos. Für Hugendick erschreckend war eine andere Maßnahme: Eine Therapeutin filmte ihn beim Sprechen und führte ihm in der Woche drauf die Aufnahme vor. Danach ging es an die Behandlung der Sekundärsymptome.
Er stottert, seit er sprechen kann. Seine Mutter nannte es „anstoßen“, der Erfahrung des Jungen damals durchaus entsprechend. „Ich war das Kind, das sich an Wörtern stößt wie an Couchtischkanten und Spielplatzgeräten. Gibt blaue Flecke, ist jedoch nicht so schlimm und geht vorbei“, schreibt David Hugendick. „So oft, wie ich ,anstieß‘, muss ich jeden Tag ziemlich geprügelt ausgesehen haben.“
Im übertragenen Sinne erlebt ein Stotterer durchaus Schmerzen, zugefügt durch falsche Zungenschläge der flüssig Sprechenden. Schon als Kind versuchte er, sich mit Synonymen zu helfen. Was die einen „cool“ fanden, nannte er „famos“. Doch so sprachen „damals nur Cordhosenrentner mit großem Latinum“. Statt „doof“ lieber „irrational“ zu sagen, ist für einen Zehnjährigen auch nicht gerade typisch. Kurz vor dem Abitur zitierte ihn der Geschichtslehrer zu sich und wünschte sich einen Aufsatz von ihm, der die mündliche Note ersetzen sollte. Der Grund, so schlicht wie fies: „Ich ertrage es nicht, wenn Sie stottern.“ Sehr oft habe er einen Bäckerladen verlassen, ohne Brötchen kaufen zu können, weil er das Wort nicht herausbekam.
Man muss ihn nicht bemitleiden. Man soll ihn nicht bemitleiden. Die soziale Leistung, die er sich vom Gegenüber wünscht, heißt Geduld. Denn was ihn am meisten kränkt im Umgang mit seiner Art des Sprechens, schreibt Hugendick, ist dieser Blick, der „übergeht in besonders gebanntes, ostentativ empathisches Zuhören, unterstützt von weit geöffneten Augen und einem sanften Zeitlupennicken, als sei ich ein sehr seltenes Pokémon oder als würde ich, falls ich es in den nächsten drei bis 27 Sekunden endlich über die Klippen eines Konsonanten geschafft habe, der Welt eine ungekannte Weisheit mitteilen“.
Mut? Ein paar Kleidergrößen zu groß
Die Beispiele zeigen: Hugendicks autobiografischer Essay ist ausgesprochen munter geschrieben, zuweilen selbstironisch, manchmal sogar albern. Er macht es den Lesern leicht, über seine Kränkungen zu lachen. Und wer sich ertappt fühlt, einem stotternden Menschen gegenüber schon die Augen verdreht zu haben oder noch schlimmer: Sätze zu Ende gesprochen zu haben, der hat diese Momente der Scham auch verdient.
Nur wenn nach einer Veranstaltung, die der Autor in seiner Rolle als Journalist auf einer Bühne moderiert hat, eine Besucherin sagt, „es sei sehr mutig von mir gewesen, mich überhaupt dorthin zu setzen“, fehlen ihm wirklich die Worte. Denn Mut scheint ihm „ein paar Kleidergrößen zu groß“.
David Hugendick stottert. Andere Menschen lispeln oder haben Sprachprobleme nach einer Krankheit wie etwa einem Schlaganfall, wieder andere sprechen einen Dialekt, den man in Berlin nur mit Untertiteln versteht, oder einfach immer sehr viel mehr als die durchschnittlichen 16.000 Wörter pro Tag. Hugendick hat Wege gefunden, mit dem Stottern umzugehen. Einer davon ist das Buch. Er macht sichtbar, was sonst verdruckst bemerkt oder beschwiegen wird. So ist es auch ein Buch über Gesellschaft.
In dem Abschnitt, in dem er die Zahl der Stotterer hierzulande hochrechnet, schlägt er vor, alle in einer Großstadt unterzubringen, und schmückt das damit aus, dass Touristen besser einen Stadtplan nutzen sollten, als Einheimische nach dem Weg zu fragen. „Und Obacht im öffentlichen Nahverkehr, da U‑Bahn-Durchsagen oft erst zu Ende sind, wenn die ,nächste Haltestelle‘ schon zwei Stationen hinter einem liegt.“ Die Bevölkerung dort wäre übrigens ungünstig gemischt. Es stottern fünfmal mehr Männer als Frauen.