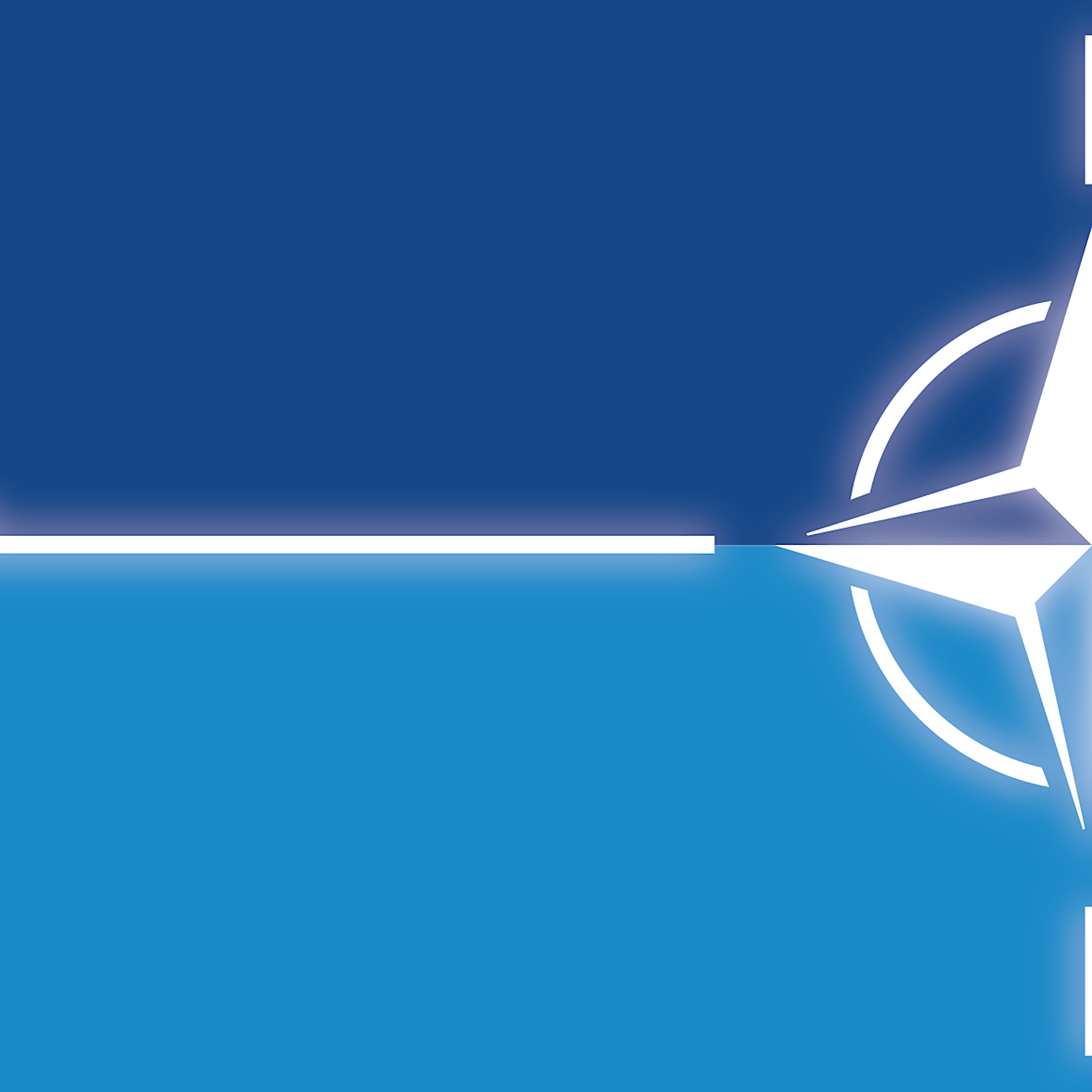Deutschland besitzt einen Exportartikel, der auf kein Containerschiff passt und doch weltweit ankommt: moralische Überlegenheit, gewonnen aus dem Rohstoff Schuld und veredelt zur „Erinnerungskultur“. „Wir waren die Schlimmsten – und erinnern uns am besten“ war einmal eine Selbstanklage. Inzwischen ist es ein Gütesiegel. Wer so gründlich gesündigt hat, so die heimliche Logik, muss heute der gründlichste Lehrmeister sein.
Und so steht dieses Land in der Gegenwart wie in einer seltsam umgebauten Kirche: Die Kerzen brennen, die Formeln sitzen, die Gemeinde nickt – und irgendwo da draußen werden die pausenlos Belehrten langsam taub.
Der Holocaustforscher Wolfgang Benz beschreibt Erinnerung für die Bundeszentrale für politische Bildung als notwendige Aufklärung über Fakten und Empathie – betont jedoch, zur Selbstgerechtigkeit bestehe kein Anlass. Er warnt vor esoterischem Selbstgenügen, moralischer Leerformel und einem Kitsch, der bloß Betroffenheit erzeugen wolle. Problematisch sei nicht das Erinnern, sondern seine Verwandlung in ein System, das sich für unfehlbar halte.
Wem dient diese Erinnerung? Den Opfern? Der Aufklärung? Oder vor allem der Selbstvergewisserung einer Mehrheit, die sich rituell bestätigt, auf der richtigen Seite der Geschichte gelandet zu sein?
Die Ersatzkirche und ihr Ablasshandel
Erinnerungskultur gleicht einer Ersatzkirche: das Dogma „Nie wieder“, eine Liturgie aus Gedenktagen und Kränzen, strenge Tabus – und ein moderner Ablass gleich dazu. Wer die richtigen Sätze spricht, darf sich moralisch entlastet fühlen. Zurück bleibt nicht selten ein substanzloses Ritual.

Der Historiker und Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner sprach im Deutschlandfunk von einer „Wohlfühl-Erinnerungskultur“. Man trauert, identifiziert sich, bekennt – und geht moralisch gestärkt nach Hause. Das Paradox: Wohlgefühl ist die Emotion derer, die nicht gemeint sind. Adressat der moralischen Inszenierung ist nicht „die Welt“, schon gar nicht „die Opfer“ – sondern man selbst.
Das ist bequem, weil es Verantwortung in Rituale verwandelt – wiederholbar, organisierbar, verwaltbar. Verantwortung dagegen ist sperrig. Sie stellt Gegenwartsfragen. Wo entstehen neue Feindbilder? Wer profitiert davon? Und was bedeutet „Nie wieder“, wenn es nicht in Stein gemeißelt wäre, sondern in Politik übersetzt werden müsste?
Friedrich Nietzsche hat diese Dynamik vorweggenommen: „Wer sich selbst verachtet, achtet sich doch immer noch dabei als Verächter.“ Heute hieße das: Deutschland hält sich für historisch so gründlich schuldig, dass es sich stolz auf die Schulter klopfen kann, wie vorbildlich es mit dieser Schuld umgeht.
Der tote Jude als Stolperstein
Der Autor Max Czollek hat dieses deutsche Bedürfnis nach einer Art historischem Rabatt als „Versöhnungstheater“ beschrieben. In einem Essay legte er dar, wie Erinnerung vielfach mit Wiedergutmachung gleichgesetzt werde, als Geste „vermeintlicher Versöhnung“ – und wie die Juden dabei für eine positive deutsche Identitätsstiftung instrumentalisiert würden. Die Einladungsliste für jüdisches Leben orientiere sich nicht selten am deutschen Außenblick, schrieb Czollek: „Na wer so auftaucht, wenn man Antisemitismus und Juden googelt.“

Man sucht nicht Menschen, sondern Funktionen. Man lädt keine Subjekte ein, man castet Rollen. Der „tote Jude“ eignet sich hervorragend: Er liegt im Boden eingelassen als Stolperstein, als Name auf Messingplatten oder als abstrakter Quader vor der US-Botschaft. Er widerspricht nicht. Der „lebende Jude“ ist komplizierter und manchmal uninteressiert an deutscher Selbsterbauung.
Der Soziologe Michal Bodemann nannte das in den 1990er-Jahren „Gedächtnistheater“: eine Öffentlichkeit, in der Juden nicht als Subjekte erscheinen, sondern als symbolische Ressource. Dahinter steht ein stiller Tausch – Ritual gegen Entlastung. Czollek trifft diesen Punkt, wenn er die irritierte Traurigkeit beschreibt, mit der nichtjüdische Deutsche reagieren, sobald jemand sagt, manches werde nicht wieder gut. Prompt erklären die Nachgeborenen den Betroffenen, was Erinnerung zu bedeuten habe.
Katechismus statt Debatte
Der Historiker A. Dirk Moses beschrieb in einem vielbeachteten Essay einen „Katechismus“, in dem die Holocaust-Erinnerung zum moralischen Fundament erhoben wird und Abweichung schnell als Häresie gilt. Geschichtsdebatten geraten so zu Loyalitätsproben. Nicht die Frage nach der Wahrheit steht im Vordergrund, sondern die nach der richtigen Haltung. Moses spricht von moralischer Hybris und von der bemerkenswerten Situation, dass nichtjüdische Deutsche Juden mit erhobenem Zeigefinger über angemessene Gedenkkultur belehren. Aus Schuld wird pädagogischer Eifer.
Was im Inland der Selbstvergewisserung dient, wird nach außen zur moralischen Exportware. Deutschland belehrt längst nicht mehr nur sich selbst, sondern erklärt der Welt, wie Geschichte zu verstehen und zu fühlen sei. Dahinter steht kein Dialog auf Augenhöhe, sondern ein Gefälle. Kaum erwogen wird, dass die in Berlin entworfene moralische Landkarte andernorts als Anmaßung erscheint – nicht wegen der Werte, sondern wegen Tonfall, Pose und Selbstgewissheit.
So kehrt ein alter Satz im neuen Gewand zurück. „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ – nicht mehr mit militärischer Macht, dafür mit normativer Autorität, gespeist aus der moralischen Überlegenheit der bewältigten Vergangenheit.
Feigenblätter: Staatsräson und andere Begriffskeulen
Dass das international registriert wird, überrascht kaum. Als die Pekinger Global Times die Grünen als „far right“ bezeichnete – ein propagandistisches Etikett für ihren als belehrend empfundenen Werteabsolutismus –, war das grob und verzerrend, traf aber einen Nerv. Denn deutsche Selbstgewissheit wirkt nach außen mitunter wie jene Überlegenheitsattitüde, von der man sich innerlich längst verabschiedet zu haben glaubte.
Die Staatsräson – das unverhandelbare Existenzrecht Israels – dient in Deutschland längst als Glaubensbekenntnis und moralisches Feigenblatt. Sie wird rituell beschworen, aber die Adressaten sind unklar. Trotz der Dichte an Gedenkveranstaltungen wird jüdisches Leben hierzulande immer unmöglicher und unsicherer.
Wie weit die begriffliche Verwahrlosung reicht, zeigt sich nicht nur in Talkshows und auf Demonstrationen, sondern auch in Texten, die sich für differenziert halten. In einem jüngst in der Berliner Zeitung erschienenen Beitrag, der das sogenannte Debanking israelkritischer NGOs anprangerte, fiel beiläufig der Satz: „Umso widersprüchlicher, als Palästinenser selbst zur semitischen Sprach- und Kulturgruppe gehören.“ Die Aussage ist begriffsgeschichtlich falsch. Sie funktioniert als alter rhetorischer Trick, der die Spezifik der Judenfeindschaft verwässert – und ist symptomatisch für eine Argumentationslinie, die ihre eigentlichen Motive hinter scheinbarer Sachlichkeit tarnt.
„Antisemitismus“ ist kein antiker Terminus, sondern ein Wort des 19. Jahrhunderts. Der deutsche Publizist Wilhelm Marr prägte ihn 1879 und gründete die „Antisemitenliga“. Der Begriff sollte bewusst pseudowissenschaftlich klingen – als scheinbar rationale Alternative zum religiösen Judenhass. Sprachwissenschaftlich bezeichnet „Semiten“ zwar Sprecher semitischer Sprachen, also auch des Arabischen und Aramäischen. Doch Antisemitismus richtete sich historisch nie gegen alle semitischsprachigen Gruppen, sondern ausschließlich gegen Juden, wie die Encyclopædia Britannica und das Deutsche Historische Museum dokumentieren.
Der deutsche Opfermythos und das große „Aber“
Parallel zur moralischen Überhöhung hat Deutschland einen eigenen Opfermythos konstruiert. Ja, man war Aggressor – aber die eigenen Städte lagen ebenfalls in Trümmern. Dresden brannte, Millionen waren auf der Flucht. Dabei ist es ein Unterschied, als Aggressor zu leiden und zu kapitulieren, oder von Aggression bedroht zu sein. Doch dieser Unterschied wird systematisch eingeebnet, wenn Bombennächte in eine Opferbilanz eingespeist werden, in der am Ende „alle gelitten“ haben.

Man müsse Dresden begehen als Gedenken, heißt es, aber gerne so, dass klar wird: Bombergeneral Harris war auch kein Engel, die Amerikaner auch nicht, die Russen schon gar nicht. Der moralische Disclaimer – „Natürlich einzigartig, aber …“ – ist zur Standardfloskel geworden. Dahinter beginnen die alten Muster der Relativierung und Verschiebung.
Schulterschluss der Schlussstrichzieher
An diesem Punkt treffen sich jene, die sich sonst hassen. Die Rechte ruft seit Jahrzehnten nach dem Schlussstrich. Björn Höcke erklärte das Holocaust-Mahnmal zum „Denkmal der Schande“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Wolfgang Benz erinnert daran, dass dieselben Argumente schon die NPD 1964 benutzte. Die AfD habe der NPD das Wasser abgegraben und verwende das gleiche Vokabular.
Ein Teil der Linken und der linksliberalen Mitte arbeitet am selben Ziel, nur mit anderen Mitteln. Sie überziehen die Öffentlichkeit mit moralischen Maximalforderungen, erheben Antifaschismus zum identitätspolitischen Distinktionsmerkmal, erklären jeden, der die Formen der Erinnerung kritisiert, zum Verdächtigen.
Antisemitismusbekämpfung verkommt zum Statussymbol. So stehen sich Rechte und Linke scheinbar gegenüber, fordern aber beide auf ihre Weise einen Schlussstrich: die einen offen, die anderen durch Überforderung und Saturierung. Das Ergebnis ist dasselbe – die NS-Zeit wird aus der Gegenwart herausgeschoben, entweder als erledigt oder als so sakral überhöht, dass jede wirkliche politische Lehre blockiert wird.
Dabei verschiebt sich die Rolle der sogenannten „Ersatzkirche“: Es sind gerade marxistische und kulturideologische Konzepte, die versuchen, traditionelle Verwurzelungen in Geschichte, das Bewusstsein einer Schicksalsgemeinschaft über Jahrhunderte hinweg, unter einen permanenten Auflösungsdruck zu stellen.
Jahrtausendealte Resilienz – der jüdische Widerstand gegen diese Entwurzelung – wird zum Problemfall, weil sie sich nicht reibungslos in die neue Ideologie einfügt. Genau hier reproduzieren sich ähnliche Vernichtungslogiken und mobilisierende Kräfte, wie sie die Geschichte bereits kannte, nur unter anderem Vorzeichen.

Nicht vergessen ist, wie in den 1970er-Jahren deutsche Linke der Revolutionären Zellen mit PLO-Flugzeugentführern gemeinsame Sache machten, ihre Waffen auf jüdische Geiseln richteten, die sie eigens selektierten. Sowohl der bewaffnete Arm als auch der intellektuelle „Widerstand“ sind Produkte dieser Denkschule – und damit am Ende nicht minder bedrohlich. Nur wird der vermeintlich antifaschistische Anspruch so zweckentfremdet, dass die eigentlich zu schützenden Adressaten – die Juden – am Schluss vor demselben Problem stehen wie zuvor: erneut bedroht, erneut instrumentalisiert, erneut ohne echte Solidarität.
Beide Seiten eint dabei – trotz aller Gegensätze – ein unbekehrbarer Kern: Die Rechte, die das völkisch-nationale Projekt weiterträumt, bleibt gegen jede historische Aufarbeitung immun; ihre Rechtfertigung speist sich aus Trotz und Abwehr. Die säkulare Ersatzkirche der linken Milieus wiederum produziert ihre eigenen Unbekehrbaren – jene, die im Kult der moralischen Überlegenheit eine neue Glaubensgemeinschaft finden, in der die Abweichung von der reinen Lehre als Häresie gilt.
In beiden Fällen geht es nicht mehr um Offenheit für Kritik oder um produktiven Streit, sondern um die sakrale Bewahrung eines identitätsstiftenden Narrativs. Der eine will sich nicht bekehren lassen, der andere darf es nicht – sonst würde das Fundament der jeweiligen Ersatzreligion bröckeln.
Erinnerungskultur hat ihren Wert, wenn sie nüchtern bleibt: Fakten, Empathie, Konsequenzen für heute. Sie verliert ihn, wo sie zur Bühne für moralische Selbstdarstellung wird, auf der Nachgeborene anderen vorschreiben, wie Geschichte zu empfinden sei – ob im Inland oder im Ausland.