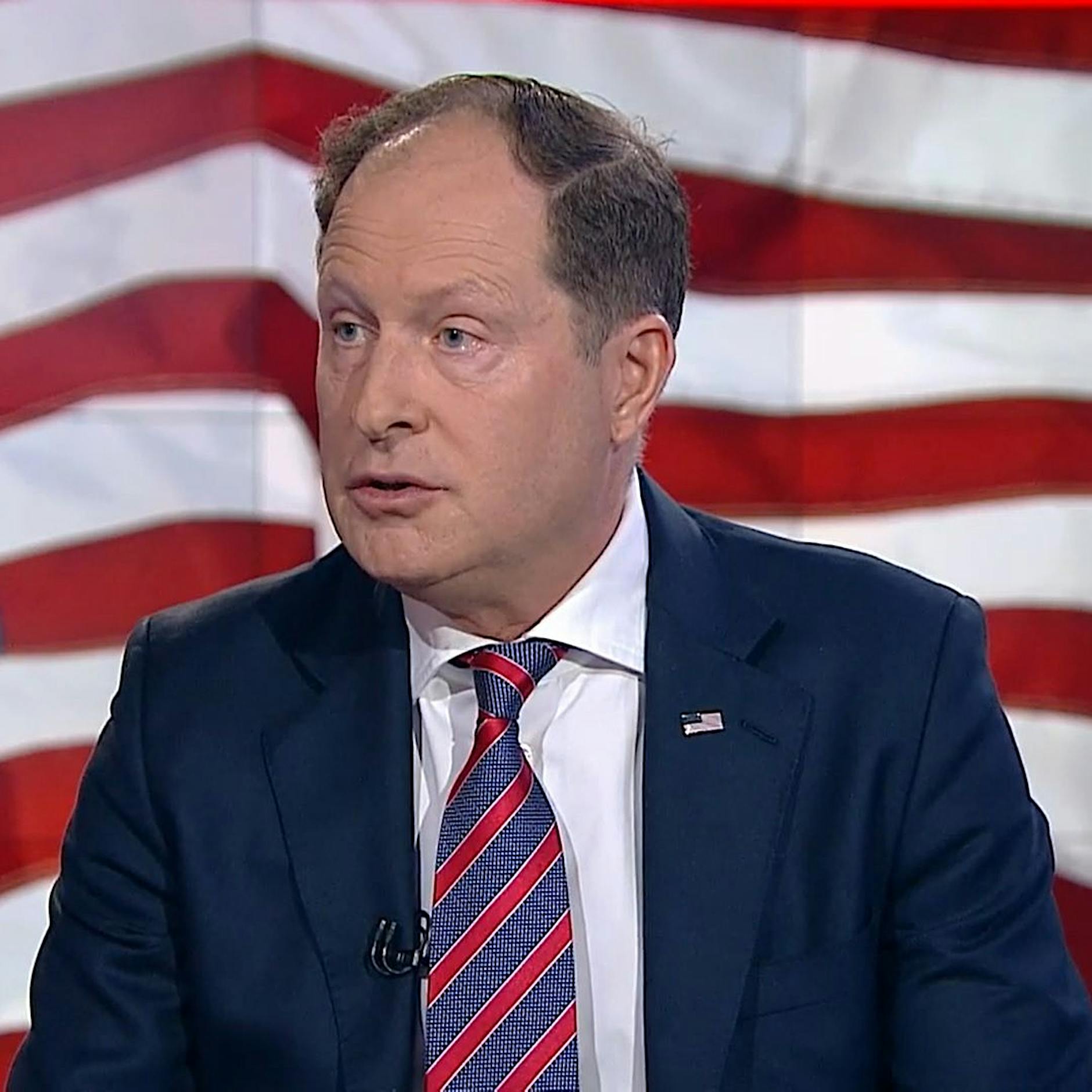Die AKP verliert seit 2015 an Zuspruch, nicht nur in der Türkei, sondern – auf dem höheren Ursprungsniveau – auch in Deutschland. Mit über 67 Prozent der Stimmen liegt der Zuspruch der „deutschen Türken“ für den alten und neuen Präsidenten zwar höher als im Endergebnis in der Türkei – um ein deutsch-türkisches Phänomen handelt es sich aber nicht. Zwar gibt es Auswanderungsregionen mit deutlich schlechteren AKP-Wahlergebnissen wie Skandinavien oder Australien sowie die USA. In Österreich, Frankreich und den Beneluxstaaten wiederum ist die Unterstützung für Erdoğan und seine Partei gleich hoch oder sogar höher als in Essen, Mannheim oder Berlin.
Mehrheit ist keine Mehrheit
Häufig wird aus der Mehrheit der Wählenden ohne Umschweife eine „Mehrheit der Deutschtürken“, was eine grobe Verzerrung darstellt. Denn von den Türkeistämmigen in Deutschland beteiligt sich nur ein Viertel an türkischen Wahlen. Die Hälfte der insgesamt rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln hierzulande ist in der Türkei gar nicht wahlberechtigt. Und: Die Hälfte vom Rest der verbliebenen wahlberechtigten „Deutschtürken“ wiederum verzichtet komplett darauf, ihre Stimme bei einer Türkei-Wahl abzugeben.
Studien legen nahe, dass diese über zwei Millionen türkeistämmigen „Nichtwähler“ das Programm und die Ziele Erdoğans mehrheitlich ablehnen. Fakt ist, dass die knapp 500.000 (65 Prozent von 750.000) tatsächlich Erdoğan-Wählenden weniger als 17 Prozent der Türkeistämmigen in Deutschland ausmachen.
Wie lässt sich dennoch erklären, warum Erdoğan und seine Partei in Deutschland trotz der zunehmend autokratischen Politik konstant bis zu 15 Prozent über dem Gesamtergebnis liegen?

Einige Argumente sind bekannt.
1. Erdoğan gibt den Türken in der Diaspora Selbstbewusstsein, kompensiert ihre Abwertungserfahrungen durch die Mehrheitsgesellschaft.
2. Seine Partei und ihre Vorfeldorganisationen betreiben systemisch „Auslandsakquise“. Das AKP-nahe Netzwerk rund um die sogenannten United International Democrats (UID) ist stabil und robust. Oppositionsparteien verfügen nicht über solche Strukturen.
3. Für die parteipolitischen Zwecke werden staatliche Institutionen und staatsnahe Medien ohne Scham ausgenutzt.
Folge von regionaler Herkunft und Heimatnostalgie
Das alleine erklärt aber nicht den AKP-Erfolg.
Politische Präferenzen gehören zum „unsichtbaren Gepäck“ einer Migration. Die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter stammte meist aus ländlichen Gebieten an der Schwarzmeerküste oder Zentralanatoliens. Diese Regionen sind auch heute Erdoğan-Hochburgen, in den entsprechenden Wahlkreisen holt er ähnlich gute Ergebnisse wie in Deutschland.
Unterschied Ruhrgebiet und Hauptstadt
Auch innerdeutsch zeigen sich die Langzeitfolgen unterschiedlicher Herkünfte, wie etwa der Vergleich von Ruhrgebietsstädten mit Berlin zeigt, wo mehr Zugewanderte aus westtürkischen Metropolen und auch viele Kurden leben, wodurch das Wahlverhalten entsprechend diverser ist. Zudem sind in den vergangenen Monaten und Jahren verstärkt Türken aus Istanbul und Izmir nach Berlin eingewandert, auch sie haben im Generalkonsulat in Berlin ihre Stimme abgegeben. Sie gehören eher einer akademischen Schicht an, die laizistisch orientiert ist.
Natürlich sind Menschen nicht auf eine politische Orientierung aus ihrer Herkunftsregion (schon gar nicht derjenigen ihrer Vorfahren) festgelegt. Bei nicht wenigen erweisen sich die Bindungen jedoch als langlebig.
Verstärkt werden derartige „Beharrungskräfte“ häufig von einer nostalgisch verklärten Verbundenheit zur alten Heimat. Sie soll möglichst so sein und bleiben, wie sie erinnert wird. Dadurch entwickeln weltweit viele Auswanderergruppen mehrheitlich eine konservative Haltung gegenüber den politischen Verhältnissen im Herkunftsland, während sie im neuen Zuhause durchaus offen für die – in der Regel migrationsfreundlicheren – linksliberalen Parteien sind.
Derartige Flexibilität nach dem Motto „das Beste aus beiden Welten“ mag irritieren, auf eine pragmatisch-abgeklärte Art ist sie durchaus folgerichtig. Das gilt übrigens auch für Deutsche, die in den 1960er- und 1970er-Jahren in die USA ausgewandert sind.
Folge von (Diaspora-)Nationalismus
Die politische Entwicklung in der Türkei ist wie derzeit in vielen Weltgegenden von Nationalismus geprägt. Zwei Kernthemen: Kurdenpolitik und die Auseinandersetzung mit Griechenland. Erdoğans Verfassungsänderung, die ihm seine heutige Machtfülle ermöglicht, wurde erst möglich, als ihr die stramm rechte Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) zustimmte.
Ohne die MHP hätte das AKP-geführte Wahlbündnis zum zweiten Mal in Folge keine parlamentarische Mehrheit erreicht. Sie mobilisiert ebenso zehn Prozent der Stimmen wie mittlerweile auch die von ihr abgespaltene Gute Partei (İyi Parti) aus dem Wahlbündnis der Republikanischen Volkspartei (CHP).
Letztlich haben also beide großen Lager (Kemalismus und Islamischer Konservatismus) ohne Unterstützung aus dem nationalistischen Lager keine (absolute) Mehrheit. Das hat auch die Präsidentschaftswahl gezeigt, wo Ultranationalist Sinan Oğan – ebenfalls ein ehemaliges MHP-Mitglied – eine zweite Runde erzwang.
Viele konservative Kräfte mobilisieren ihre Wähler
Auch diese Entwicklungen bleiben nicht ohne Einfluss auf die „Diaspora“. Der bekannte Nationalismus-Forscher Benedict Anderson hat bereits vor vielen Jahren auf eine neue ortsunabhängige Form dieser Ideologie hingewiesen, den „Long-Distance-Nationalismus“.
Mittlerweile mobilisieren nicht nur die UID und andere islamisch-konservative Kräfte im Ausland. Auch die „Grauen Wölfe“, eine der größten rechtsextremen Bewegungen in Deutschland insgesamt mit bundesweit über 300 Vereinen, ist hier aktiv. Mit ihrer Hilfe erreichte auch die MHP hierzulande ein überdurchschnittliches Ergebnis von 12,6 Prozent. Ein Bündnis macht es möglich – bei der Präsidentschaftswahl haben auch diese Stimmen auf Recep Tayyip Erdoğan eingezahlt.