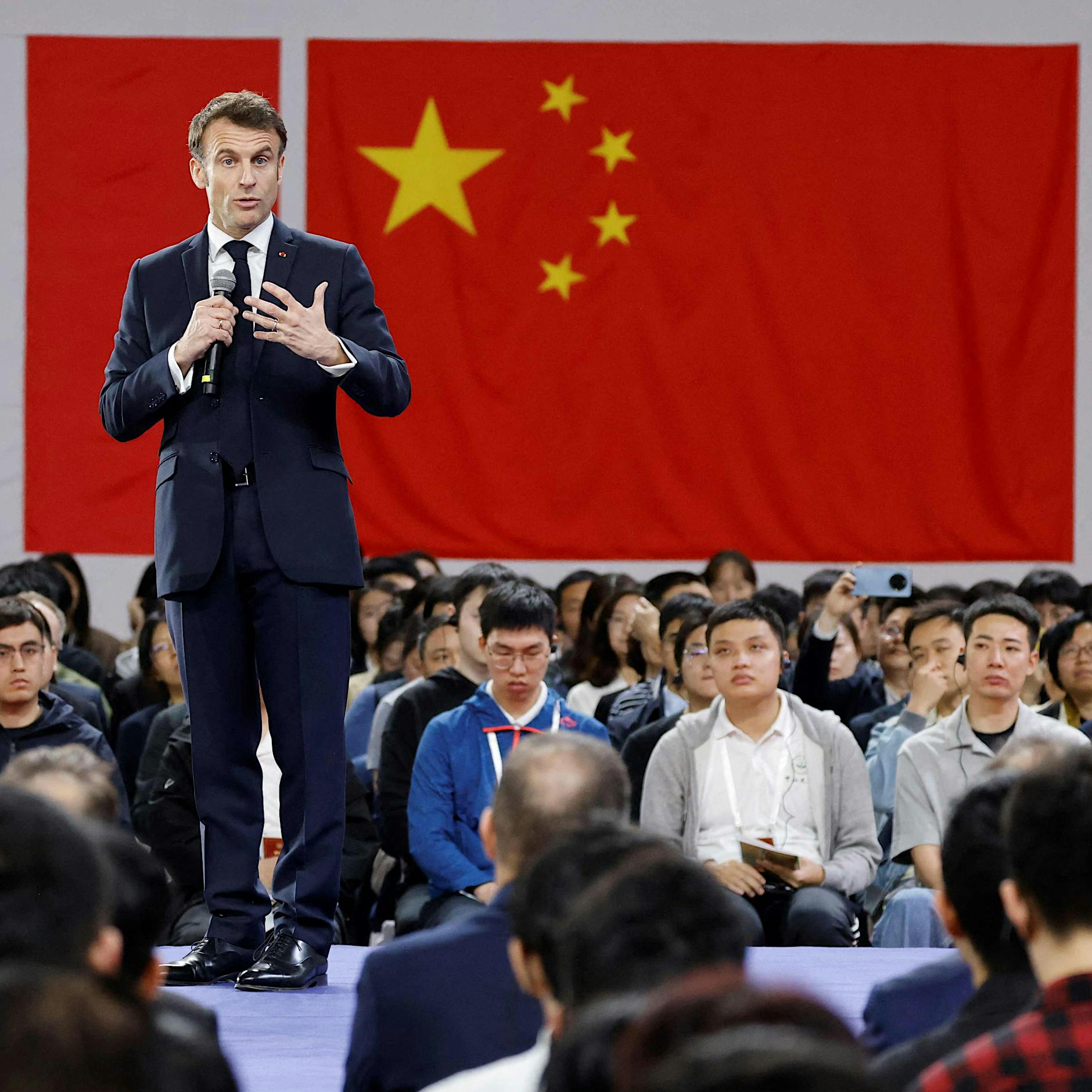Das Baltikum und die Ukraine sind in Aufruhr. Chinas Botschafter in Paris sagte am vergangenen Wochenende dem französischen Sender LCI, dass einige Länder der ehemaligen Sowjetunion nach internationalem Recht keinen wirksamen Status hätten.
Er meinte die Ex-Sowjetrepubliken, oder, wie man heute noch öfter sagt: die sogenannten postsowjetischen Staaten. Länder – von Estland über Armenien bis Usbekistan –, die unterschiedlicher in ihrer Kultur, Politik oder Geschichte nicht sein könnten. Der Vorfall hat auch bei mir etwas ausgelöst.
Nach dem Abitur an einer Köpenicker Oberschule im Jahr 2014 wollte ich mich vertieft mit dem großflächigen Kulturraum in Osteuropa auseinandersetzen: mit der Geschichte und den historischen Narrativen, den Sprachen und Gesellschaften. Deshalb habe ich über sieben Jahre lang studiert. In Potsdam, Moskau, Berlin und Vilnius.
Der Fokus meines Studiums in all den verschiedenen Orten war stets russlandzentriert – die 14 Staaten, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängig wurden, hat man hingegen oft als „postsowjetisch“ beschrieben. Sowohl in Lehrbüchern als auch in Vorlesungen von Professoren und Dozenten wie auch im Gespräch mit Kommilitonen. Auch ich nutzte den Begriff, ohne ihn intensiv zu hinterfragen.
„Postsowjetisch“: Die historischen Probleme mit dem Begriff
Doch damit ist nun Schluss. Denn die Begrifflichkeit „postsowjetisch“ ist eine undifferenzierte Sichtweise. So fallen mir persönlich nicht viele Gemeinsamkeiten auf, die sich beispielsweise die Hauptstädte Tallinn und Duschanbe teilen. Die ehemalige Sowjetunion wird in all ihren Facetten gedanklich meistens nur als Russland fortgeschrieben, Länder wie Belarus, Aserbaidschan und Tadschikistan werden dagegen ausgeblendet und in ihrer Geschichte, Geografie und Kultur auf die sowjetische Epoche reduziert.
So wächst beispielsweise in der belarussischen Identität die Bedeutung der Epoche des polnisch-litauischen Großfürstentums, bei den Esten, Letten und Litauern sind es die Unabhängigkeitskriege in den Wirren der 1910er-Jahre, ähnlich verhält es sich in Georgien. All die Phänomene sind zwar in Expertenkreisen bekannt, der Großteil der Menschen in Deutschland wisse jedoch nur, dass all die Länder „postsowjetisch“ seien. Auch 32 Jahre nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums.

Auch Experten ändern ihre Positionen
Der Wandel im Umgang mit dem Begriff zieht sich derzeit durch große Teile der Osteuropawissenschaft und Expertencommunity. Anerkannte Politologen, Ökonomen, selbst die renommiertesten Osteuropaexperten aus Europa und den USA haben jahrzehntelang den „postsowjetischen“ Begriff genutzt: in Essays, in Handlungsempfehlungen für Regierungen und Unternehmen, in langen Analysen. Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres meiden auch sie den „postsowjetischen“ Begriff. Auch ich tue das.
If you still don't understand why the label "post-soviet" is offensive, just take a look at this map 🤷🏼♂️ pic.twitter.com/bqLboI1t5w
— Matas Maldeikis MP 🇱🇹 (@MatasMaldeikis) April 25, 2023
So merkte ich während meines Auslandssemesters an der Universität in Vilnius immer mehr, dass der Begriff eine Fremdbezeichnung ist. Litauer habe ich nicht angetroffen, die von sich selbst behaupten, sie seien „postsowjetisch“. Es ist ein Ausdruck, mit dem es sich viele leicht machen, eine derart ausgedehnte geografische Region – die von der Ostsee bis ins asiatische Hochgebirge reicht – herunterzubrechen und schlussendlich zu pauschalisieren.
In dem Zusammenhang ist ein Gespräch mit einer litauischen Soziologin lange im Gedächtnis geblieben. „Würden Sie Deutschland heute noch als postfaschistisch bezeichnen oder Bosnien als postjugoslawisch oder Finnland als postschwedisch?“, fragte sie mich und kritisierte: „Doch Litauen, Moldau und Kasachstan sind und bleiben in vielen Köpfen auch über 30 Jahre nach dem Kommunismus immer noch postsowjetisch.“ Die Vergleiche ergaben Sinn.
Und was meinen Sie?