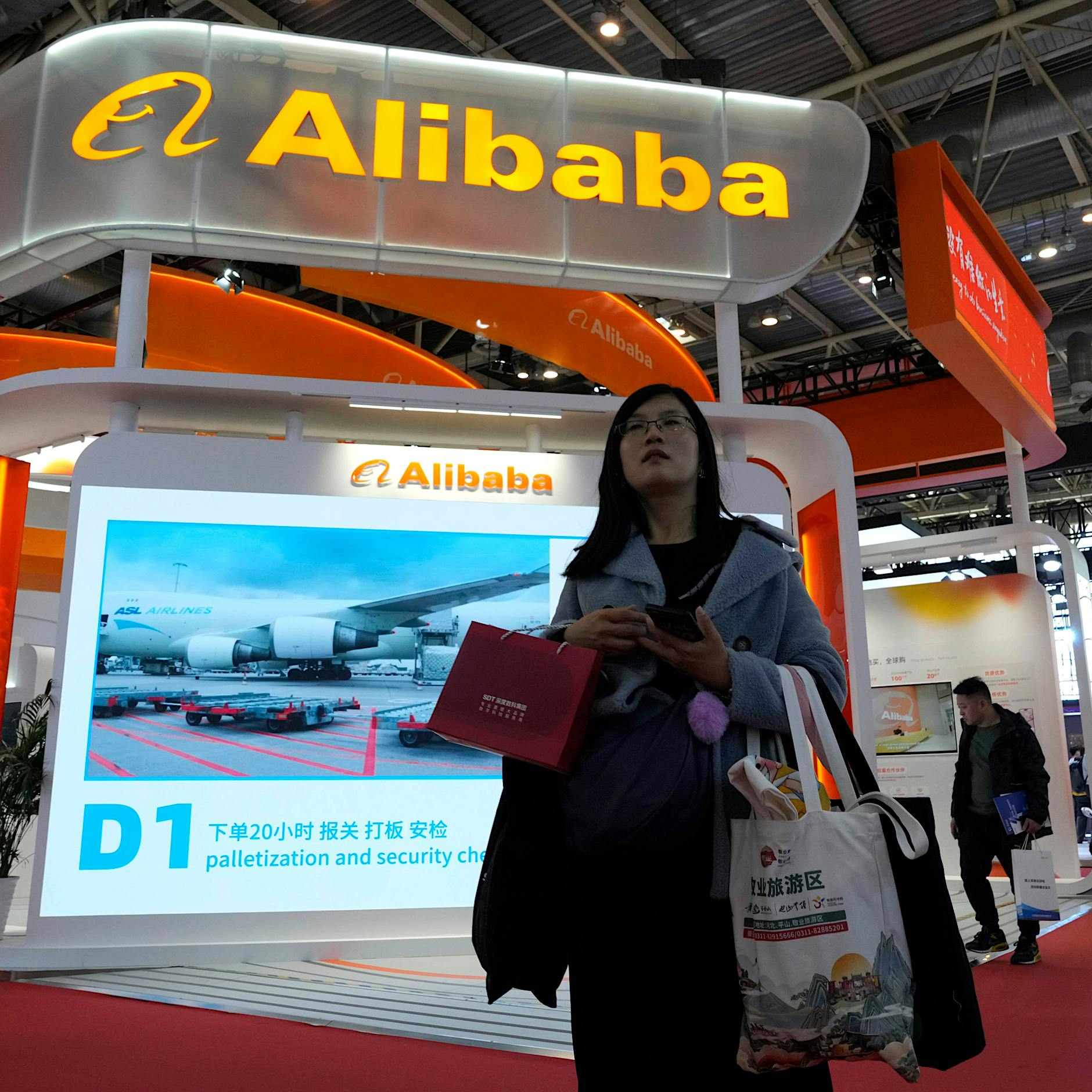Das Jahr der Schlange hat begonnen, und Peking zeigt der Welt gleich mal, was sie von China erwarten kann. Bei einer Aufführung unter der Leitung des renommierten chinesischen Regisseurs Zhang Yimou traten 16 Roboter des chinesischen Robotikunternehmens Unitree, gekleidet in wattierte Jacken im nordostchinesischen Stil auf, zusammen mit Tänzerinnen des chinesischen Xinjiang Art Institute. Die humanoiden Roboter können nicht nur geschmeidig ihre Taille drehen und menschliche Beinbewegungen nachahmen, sondern auch Taschentücher drehen und äußerst geschickte Aktionen ausführen, berichtet die staatliche Global Times.
In Interviews erzählten die Ingenieure von Unitree von ihren Bestrebungen, die Roboter so zu programmieren, dass sie auf Musik reagieren. Wie Videos der chinesischen Staatsmedien zeigen, haben die Roboter die komplexen Tänze gut gelernt. Ihre motorischen Fertigkeiten beeindruckten das Publikum. Sie könnten die Taschentücher besser falten als Menschen, zitieren chinesische Medien Besucherinnen.
Das Unternehmen teilte laut Global Times am Dienstagabend mit, dass die Roboter eine KI-gesteuerte Ganzkörper-Bewegungstechnologie verwenden, die ein maximales Gelenkdrehmoment von 360 Newtonmetern erreichen kann. In Verbindung mit einer 360-Grad-Panorama-Tiefenwahrnehmungstechnologie können sie jede Bewegung in ihrer Umgebung präzise erfassen. Darüber hinaus können sie durch fortschrittliche KI-Algorithmen Musik perfekt „verstehen“ und ihre Bewegungen in Echtzeit entsprechend der Musik anpassen.
Auch die Beobachter aus dem Westen stellen fest, dass hier Außergewöhnliches geschieht: „Die Vorführung humanoider Tänze in Peking findet zu einer Zeit statt, in der diese Roboter für die größten Technologieunternehmen wie Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk und den Halbleitergiganten Nvidia rasant zur Priorität werden“, schreibt das US-Magazin Business Insider.
Die Chinesen belassen es indes nicht bei tanzenden Robotern: In der südwestchinesischen Stadt Chongqing und in Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu bot die in Shenzhen ansässige Damoda Intelligent Control Technology Auftritte elektrischer, vertikal startender und landender Flugzeuge (eVTOL), die den Nachthimmel mit einer komplexen und präzisen Lichtshow erleuchteten.
Auch auf Feldern, auf denen China von der Entwicklung ferngehalten werden soll, melden chinesische Unternehmen Erfolge. Wie Bloomberg berichtet, betrifft dies vor allem den wichtigen Bereich der Chipproduktion, in denen aus China „Durchbrüche“ erwartet werden. Jüngstes Beispiel ist laut Heise und Techninsights ein Erfolg im besonders umkämpften Bereich der Chip-Herstellung: Die YMTC-Tochter ZhiTai soll das erste Modell mit Bausteinen aus der „Xtacking 4.0“-Generation entwickelt haben. Heise erläutert: „Ein Chip besteht aus 294 Speicherlagen. Nicht alle sogenannten Layer speichern tatsächlich Daten, um die Produktionsausbeute zu erhöhen. Techinsights vermutet, dass etwa 270 aktiv sind – selbst das wäre heute Rekord.“ Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, denn YMTC steht wie andere chinesische Chipfertiger auf der von den USA vorangetriebenen westlichen Sanktionsliste: „Sie bekommen daher keine topmodernen Lithografie-Systeme von ASML und haben keinen Zugriff auf viele Designtools. YMTC gelingt es trotzdem, ganz vorn bei der NAND-Flash-Entwicklung mitzuspielen“, urteilt Heise.
Die Global Times erläutert, dass es sich bei den Technologie-Spektakeln zum Neujahrsbeginn nicht um eine abstrakte Machtdemonstration handle, sondern um eine große Transformation, durch welche es den Menschen in China besser gehen soll: Früher sei die Reise zum Frühlingsfest eine überfüllte Fahrt in langsamen, grün gestrichenen Zügen gewesen, schreibt die Zeitung: „Heute erstreckt sich das umfassende, vielschichtige Verkehrsnetz des Landes über 6 Millionen Kilometer, und während der Reisesaison zum Frühlingsfest werden über 510 Millionen Bahnreisende transportiert. Neue Linien wie die Linien Shanghai-Suzhou-Huzhou und Jining-Datong-Yuanping wurden in Betrieb genommen. Über 30.000 Ladestationen und fast 50.000 Ladeplätze an Autobahnen bedienen die wachsende Zahl der Besitzer von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik. Sechzehn im Inland produzierte Großflugzeuge des Typs C919 haben sich der ‚warmen Heimreise‘ zum Frühlingsfest angeschlossen. Städte wie Shanghai, Tianjin und Guangzhou erleben einen neuen Aufschwung bei Kreuzfahrten, und der ‚Reiseansturm zum Frühlingsfest auf dem Meer‘ wird voraussichtlich über 100.000 Passagierreisen umfassen. Die zunehmend bequemere und komfortablere Heimreise der Chinesen während des Frühlingsfests ist ein Beweis für die tiefgreifenden Veränderungen in Chinas Verkehrsinfrastruktur.“
Die Leistungsschau war von einem PR-Coup begleitet worden, der den Westen in helle Aufregung versetzt hat: Das chinesische Internet-Unternehmen DeepSeek hatte die neueste Version seiner Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestellt, die angeblich mit viel geringeren Kosten vergleichbar gut Ergebnisse wie die US-Konkurrenten erzeugen. Zunächst brachen die Börsenkurse der US-Giganten ein. Vor allem der Chiphersteller Nvidia war betroffen, verlor laut Bloomberg zeitweise 589 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Danach begannen unbekannte Hacker, DeepSeek mit Angriffen zu überziehen: Sie eskalierten ihre Cyberangriffe am frühen Donnerstag plötzlich massiv. Die Angriffsbefehle überstiegen die vorherige Angriffswelle am Dienstag um mehr als das Hundertfache, so das chinesische Cybersicherheitsunternehmen XLab.
Das Labor sagte, es habe mindestens zwei Botnetze beobachtet, die an den Angriffen am Donnerstag beteiligt waren und zwei Angriffswellen starteten. Die beiden bei diesem Angriff verwendeten Botnetze, HailBot und RapperBot, sind zwei seit langem aktive Botnetze, die professionelle DDoS-Dienste zum Angriff auf globale Ziele bereitstellen. RapperBot greift täglich durchschnittlich mehr als 100 Ziele an, mit Spitzenbefehlsvolumina im Tausenderbereich. Seine Ziele liegen in Brasilien, Weißrussland, Russland, China und Schweden. Die Angriffe von HailBot sind stabiler als die von RapperBot. Laut XLab werden täglich durchschnittlich Tausende von Angriffsbefehlen ausgeführt, die sich auf über 100 Ziele auf dem chinesischen Festland, in den USA, Großbritannien, der chinesischen Region Hongkong, Deutschland und anderen Regionen richten. Wer hinter den Bots steckt, ist unbekannt. Ihre Wirkung ist indessen unbestritten.
Neben den Angriffen startete im Westen eine politische Debatte, die kurz zuvor vom scheidenden US-Sicherheitsberater Jake Sullivan bereits intoniert worden war: Auf Axios ließ Sullivan die düstere Prophezeiung vom Stapel, dass die USA ein neues „Manhattan Project“ benötigten, weil die Gefahr der chinesischen KI in ihren Verheerungen der Wirkung einer Atombombe in nichts nachstehe.
Sollte es den USA nicht gelingen, den Wettlauf um die beste KI der Welt zu gewinnen, würde dies „dramatische und dramatisch negative Folgen haben“. So würden „extrem mächtige und tödliche Waffen“ plötzlich dem exklusiven Zugriff durch einige wenige Großmächte entzogen – Sullivan spricht hier originellerweise von der „Demokratisierung“ der Waffen. Weiter warnt er vor „massiven Störungen und Verlagerungen von Arbeitsplätzen sowie einer Lawine von Missinformationen“. Axios analysiert: „Amerika muss schnell eine Technologie perfektionieren, von der viele glauben, dass sie intelligenter und leistungsfähiger sein wird als der Mensch. Wir müssen das tun, ohne amerikanische Arbeitsplätze zu dezimieren und versehentlich etwas mit Fähigkeiten freizusetzen, die wir nicht erwartet oder auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Wir müssen China sowohl bei der Technologie als auch bei der Gestaltung und Festlegung ihrer globalen Nutzung und Überwachung schlagen, damit sie nicht von bösen Akteuren katastrophal eingesetzt wird.“ Das Magazin kommt zu einem überraschenden Schluss: Das Ziel könne „nur durch eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft erreicht werden – und wahrscheinlich durch eine schwierige, aber unerlässliche Kooperation mit China“.
Wie ernst der Westen die Entwicklung in China nimmt, zeigt das China-kritische Merics-Institut in Berlin, dessen Experten die technologische Leistung der Chinesen unumwunden anerkennen: DeepSeek, dessen 40-jähriger Gründer Liang Wenfeng kürzlich mit Ministerpräsident Li Qiang zusammengetroffen sei, habe „einen Ressourcen schonenden Ansatz erfolgreich umgesetzt“. Der Erfolg stärke „auch die Befürworter von Open-Source-Modellen in China und darüber hinaus: DeepSeek hat die sogenannten Gewichte seines R1-Modells öffentlich gemacht, die zentralen Parameter, mit denen Entwickler weltweit das Modell lokal betreiben und weiterentwickeln können“. Dies stelle „führende Unternehmen vor gewaltige Herausforderungen“. OpenAI werfe „DeepSeek vor, ohne Erlaubnis die Arbeit des Unternehmens genutzt zu haben“.
Hier wird allerdings bereits ein Teil der westlichen Abwehrlinie sichtbar: Mehrere US-Medien behaupteten nach dem DeepSeek-Spektakel, die Chinesen hätten eigentlich gar nichts Eigenes entwickelt, sondern nur von den Amerikanern geklaut. Reuters berichtete, einige Techniker glaubten, dass DeepSeeks Modell einige seiner Vorteile möglicherweise von US-Modellen gelernt habe. Mit der sogenannten „Destillationstechnik“ würde ein älteres, etablierteres und leistungsfähigeres KI-Modell die Qualität der Antworten eines neueren Modells bewerten lassen, wodurch die Erkenntnisse des älteren Modells effektiv übertragen werden. Dies bedeute, dass das neuere Modell die Vorteile der enormen Investitionen in die Entwicklung des ursprünglichen Modells ohne die damit verbundenen Kosten nutzen könne.
Ebenso schnell kamen Datenschutzbedenken auf: Sicherheitsforscher aus den USA entdeckten im Internet eine große Datenbank mit sensiblen Daten der chinesischen KI-Anwendung DeepSeek. Forscher des Cloud-Sicherheitsunternehmens Wiz aus New York veröffentlichten am Donnerstag einen entsprechenden Report. Daraus geht hervor, dass DeepSeek eine seiner wichtigen Datenbanken im Internet ungeschützt veröffentlicht hatte. Dadurch seien unter anderen Benutzereingaben – insgesamt mehr als eine Million Datensätze – für jeden offen einsehbar gewesen, so die dpa und Heise.
Verwunderlich ist dergleichen angesichts der massiven Hackerattacken nicht, weil die Daten im Zuge der Angriffe leicht hatten gestohlen werden können. Doch erste Länder reagierten prompt: So nahm Italien die App von DeepSeek am Mittwoch aus den App-Stores von Google und Apple. Während die italienische Datenschutzbehörde die erste Behörde war, die die Datenschutzrichtlinie von DeepSeek offiziell ins Visier nahm, erklärten andere Aufsichtsbehörden in Europa, dass alle Dienste die KI- und Datenschutzregeln der Region einhalten müssten, ohne DeepSeek explizit zu erwähnen, berichtet TechCrunch.
In anderen Teilen der Welt waren die Reaktionen dagegen anders geartet: Indiens IT-Minister Ashwini Vaishnaw lobte am Donnerstag die Fortschritte von DeepSeek und sagte laut TechCrunch, Indien werde die großen Sprachmodelle des chinesischen KI-Labors auf inländischen Servern hosten, eine seltene Gelegenheit für chinesische Technologie in Indien. Die Ankündigung signalisiert einen Kurswechsel: Seit 2020 hat Indien mehr als 300 mit China verbundene Apps und Dienste verboten, darunter TikTok und WeChat, und dabei nationale Sicherheitsbedenken angeführt.
Die Genehmigung, DeepSeek in Indien zu hosten, ist an die Bedingung geknüpft, dass die Plattform alle Daten indischer Benutzer im Inland speichert und verarbeitet, im Einklang mit Indiens strengen Anforderungen an die Datenlokalisierung. „Datenschutzprobleme in Bezug auf DeepSeek können gelöst werden, indem Open-Source-Modelle auf indischen Servern gehostet werden“, sagte Vaishnaw auf einer Branchenkonferenz.
Menschenrechtler sehen die Entwicklung dagegen kritisch. Haiyuer Kuerban vom Weltkongress der Uiguren sagte der Berliner Zeitung: „Natürlich kann technologischer Fortschritt der Menschheit zugutekommen. Er gibt aber auch ein großes Potenzial für Missbrauch.“ Er glaube nicht, dass die „Tech-Community in der Lage sein wird, das Fehlverhalten der Kommunistischen Partei Chinas zu korrigieren“.
Kuerban: „Nach chinesischem Recht müssen Unternehmen dem Staat Zugang zu ihren Daten gewähren und vorbehaltlos zusammenzuarbeiten. Ein Paradebeispiel ist WeChat, das eng mit der Regierung zusammenarbeitet und als wichtiges Überwachungsinstrument dient. Auch der Fall Jack Ma zeigt, wie schnell Tech-Größen bestraft werden, wenn sie nicht nach der Pfeife der KPCh tanzen. Vor diesem Hintergrund besteht kein Zweifel daran, dass auch DeepSeek unter der Kontrolle der chinesischen Regierung steht.“ Einen effektiven Schutz für Nutzer aus Deutschland gäbe es nicht: Es gäbe als in China keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen und die Kommunistische Partei übe eine übermächtige Kontrolle aus. Selbst große Technologien wie WeChat können sich dem nicht widersetzen: „Die starke Zensur bei Themen wie Uiguren, Tibet oder Hongkong zeigt, dass es sich hier nicht um eine neutrale technologische Innovation handelt.“ Nutzer aus Deutschland oder dem Westen sollten sich daher „sehr genau überlegen, ob sie der KPCh Zugang zu ihren Daten gewähren wollen“.
Kuerban sagte, die neuen Technologien in China bedeuten für die Uiguren eine „noch umfassendere Überwachung, eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit und eine Perfektionierung der bereits bestehenden Unterdrückung“: „Künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung und Big-Data-Analysen werden bereits gezielt eingesetzt, um die Kontrolle über die Uiguren lückenlos auszuweiten.“ Schon jetzt seien „die Uiguren einer beispiellosen digitalen Überwachung ausgesetzt - die neuen technologischen Errungenschaften verschärfen diese Repression nur noch weiter“.