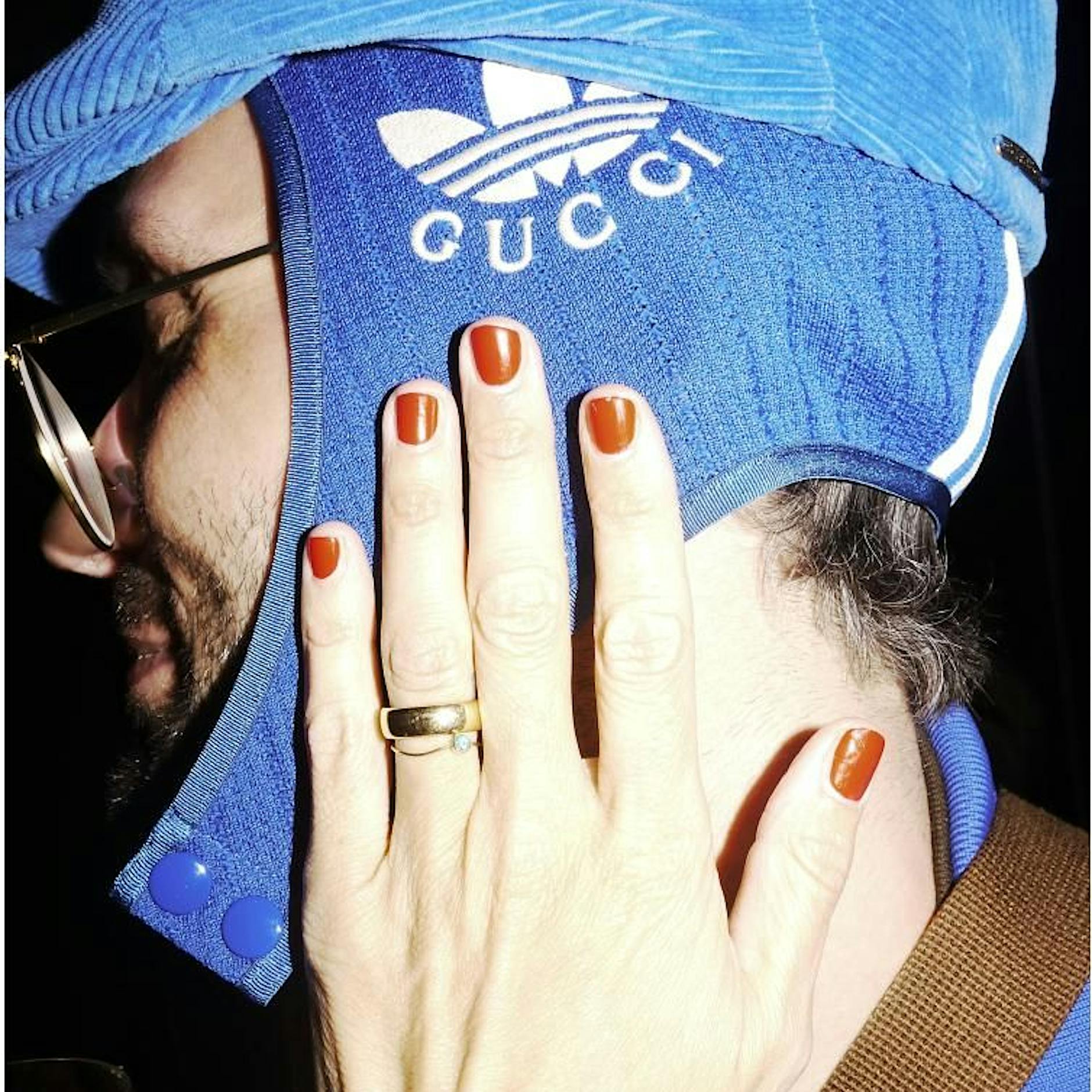Kurvige Frauen werben für Nivea-Cremes und Zara-Kleider, selbst bei „Germany’s Next Topmodel“ dürfen sie längst mitmachen – die Body Positivity ist im Mainstream angekommen. Was das für die Prêt-à-porter bedeutet, lässt sich nun wieder verstärkt auf ihren Laufstegen sehen: Einen Backlash nämlich, eine Gegenreaktion zurück zu dürren Armen und herausstehenden Hüftknochen.
Der Mager-Look ist in die Mode zurückgekehrt. Das hat auch Vanessa Friedmann erkannt. Die Frauen auf den Laufstegen ihrer Stadt seien im Februar so „schockierend dünn“ gewesen, schrieb die Modekritikerin der New York Times unlängst auf Twitter, dass sie sich kaum auf die vorgeführten Kleider habe konzentrieren können.
Die österreichische Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner überrascht das kaum. Sie sagt im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: „Die Kardashian-Schwestern haben sich von ihren Kurven verabschiedet und Gwyneth Paltrow spricht in einem Podcast darüber, wie wenig sie isst. Kaffee, Knochenbrühe und Gemüse – mehr nimmt sie nicht zu sich. Solche Dinge geschehen mit großer Öffentlichkeit.“ Lechner forscht seit Jahren zu Themen der Körperbilder und Diskriminierung.

Auch aktuelle Zahlen belegen, dass es mit der demonstrativen Body Positivity der vergangenen Jahre dann doch nicht so weit her ist: Das Branchenblatt Vogue Business hat sich die Mühe gemacht, mal genauer hinzusehen – und mitzuzählen. Gerade einmal 0,6 Prozent der 9137 Outfits auf den jüngsten Fashion Weeks in New York, London, Mailand und Paris wurden demnach von sogenannten Plus-Size-Models mit Kleidergröße 44 oder mehr präsentiert.
Echte Vielfalt hat einen Preis, strukturelle Veränderungen wie unterschiedliche Schnitte.
Das Magazin resümiert: Frauen jenseits der amerikanischen Size Zero, also der Kleidergröße 30, würden in der Prêt-à-porter nach wie vor kaum gebucht. Models mit den Größen 36 bis 42 hätte es auf den Fashion Weeks zwar vereinzelt zu sehen gegeben; fast 96 Prozent der gebuchten Frauen trugen jedoch 30 bis 34.
Dementgegen steht die Lebensrealität der Kundinnen, die doch eigentlich adressiert werden sollen: Die Deutsche Presse-Agentur zitiert das Statistische Bundesamt, demzufolge Frauen in Deutschland durchschnittlich die Größen 42 bis 44 tragen.

Mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Modebranche argumentieren gegenüber Vogue Business mit rein praktischen Gründen: Es sei zu umständlich, Musterkleider auch auf größere Größen zu gradieren. Einfacher sei es, mit Standards zu arbeiten, die für alle gebuchten Models gelten.
Stattdessen zeigt man einmal eine dickere Frau und nimmt dafür den Applaus mit.
„Das kann ich nicht gelten lassen“, kommentiert indes Elisabeth Lechner. „Echte Vielfalt hat einen Preis, da geht es um strukturelle Veränderungen wie unterschiedliche Schnitte. Das kostet Geld und braucht Zeit. Stattdessen zeigt man einmal eine dickere Frau und nimmt dafür den Applaus mit.“
Dass sich die Mode nicht immer an der Realität orientieren, sondern Fantasiewelten erschaffen will, ist nichts Neues. Auch, dass Frauen jenseits der Kleidergröße 40 längst noch nicht zum Standard geworden sind auf den Brettern, die die Modewelt bedeuten, dürfte kaum überraschen. Dass jetzt aber nicht nur das schlanke, sondern auch das magere Model wieder zurück ist auf den Laufstegen, sorgt für Aufsehen.

In den 1960ern sowie den 1990ern war es bekanntlich schon einmal soweit: Waren die Sixties geprägt von überaus schmalen Vorbildern wie der Stilikone Twiggy wurde rund 30 Jahre später der kränkliche „Heroin Chic“ von Kate Moss en vogue. Im neuen Jahrtausend propagierte der Designer Hedi Slimane den extraschmalen Körper, erst bei Dior Homme, später bei Saint Laurent und Celine. Nun scheint dieser Look zurückzukommen: Allein unter dem Hastag #heroinchic finden sich fast 70.000 Beiträge auf Instagram.
Wir bekommen minimal unterschiedliche Körper zu sehen, viel mehr wurde nicht erreicht.
Eigentlich hatten viele Modemarken Besserung gelobt; selbst staatliche Regularien gibt es hier und dort – genutzt hat am Ende offenbar nichts davon. Frankreich zum Beispiel, Land der gehobenen Mode, hatte 2017 verbindliche Gesundheitstest für Models eingeführt: Labels, die Frauen ohne ein solches Schreiben engagierten, müssen seitdem mit empfindlichen Strafen wie Zahlungen bis 75.000 Euro rechnen.
Dass diese Maßnahmen kaum zündeten, verwundert die Wissenschaftlerin Lechner nicht. Was das Ankommen der kräftigeren Körpers im Mainstream angeht, so spricht sie von einer „kommerziellen Heidi-Klum-Diversity“. In Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ etwa bekäme das Publikum „jetzt minimal unterschiedliche Körper zu sehen, doch viel mehr wurde nicht erreicht.“ Das Ideal hätte sich lediglich ein wenig verschoben – hin zu einer etwas üppigeren Sanduhrfigur, die vielen Frauen trotzdem unerreichbar bleibt. „Aber wo waren die sehr dicken Körper oder Haut, die nach einer Geburt herabhängt?“, fragt Lechner.

Dass der möglichst schmale Körperbau nun wieder zum Thema wird, hat auch mit aktuellen Modetrends zu tun. Denn die Branche hatte zuletzt ja den Stil der 2000er-Jahre und mit ihm die kurzen Miniröcke, Hüfthosen und Bauchfrei-Tops wiederentdeckt. „Diese Art von Kleidung ist für dicke Körper quasi unmöglich zu tragen, außer man hat den großen Mut, vermeintlich Imperfektes zu zeigen“, so Lechner gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „In diese Schnitte passt der Bauch einfach nicht hinein.“
Dazu passt, dass in den USA aktuell ein angebliches „Wundermittel“ die Runde macht: Verschreibungspflichtige Diabetesmedikamente, die den Hunger unterdrücken sollen; Unternehmer Elon Musik schwärmt gar öffentlich davon. In den USA sollen die Medikamente zwischenzeitlich knapp geworden sein – selbst für Diabetespatientinnen und -patienten, die auf sie angewiesen sind. Zudem seien Schönheitseingriffe abermals auf dem Vormarsch, so Lechner.
Heute schließen sich Menschen gegen den Schönheitsdruck in sozialen Netzwerken zusammen.
„Beim populären Buccal Fat Removal wird im Grunde ein Teil der Wange herausgeschnitten, damit man wie die gefilterte Version seiner selbst aussieht“, gibt die Wissenschaftlerin ein Beispiel. Dass Frauen und Männer vermehrt mit dem Wunsch, auch in der Realität so auszusehen wie nach der Nutzung eines digitalen Instagram-Filters, in die plastische Chirurgie kämen, wurde in den vergangenen Jahren schon häufig berichtet.

Auch hier sollen mancherorts staatliche Regularien greifen: In Frankreich etwa wird aktuell ein Gesetzesentwurf diskutiert, demzufolge Influencerinnen und Influencer Bilder entsprechend kennzeichnen müssten, auf denen sie sich zum Beispiel schmaler oder glatter retuschiert haben. Gerade jüngeren Nutzerinnen und Nutzern von Sozialen Medien soll so deutlich gemacht werden, dass es sich bei den Fotos ihrer Idole nicht um reelle Aufnahmen handelt.
Auch Elisabeth Lechner, die Wissenschaftlerin, zeigt sich hoffnungsvoll. Sie selbst sei in den 2000er-Jahren Teenager gewesen, der Dekade der Hüfthosen und Bauchfrei-Tops, in der es schlichtweg überhaupt keine kurvigen Frauen auf Laufstegen oder in Modemagazinen gab. „Heute aber schließen sich Menschen gegen den Schönheitsdruck in den sozialen Netzwerken zusammen. Das ist wirkmächtig“, meint sie.
Wer sich gegen den dürren Look ausspricht, kann indes auch das Gegenteil von Body Positivity bewirken. Längst haben sich auch schlanke Frauen untereinander solidarisiert, die es sich nicht mehr gefallen lassen wollen, dass ihre Körper als Negativbeispiele für einen krankhaften Trend herhalten sollen.