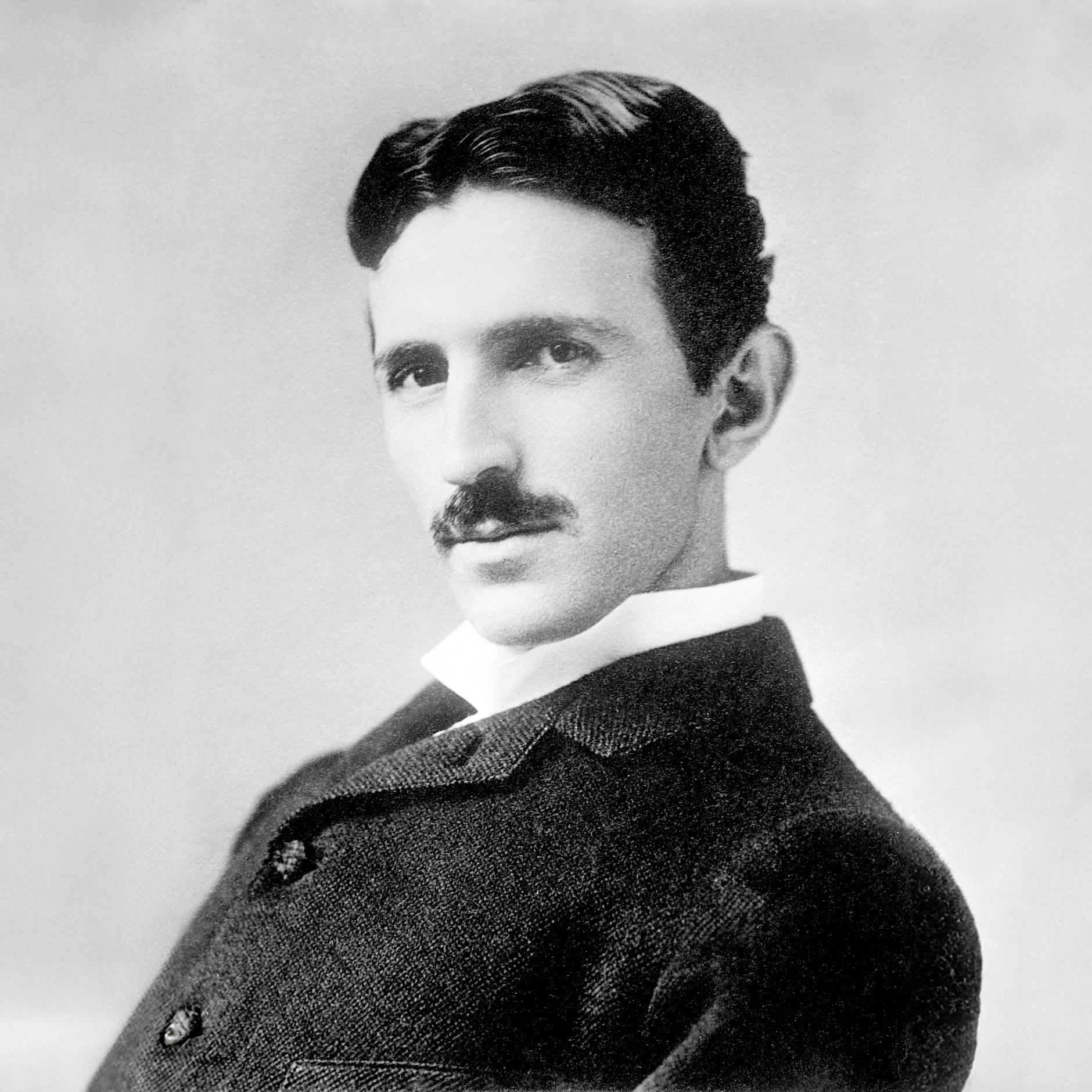Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Im Februar vor zwei Jahren bebte in der syrisch-türkischen Grenzregion mehrmals die Erde. Das Auswärtige Amt sprach auf seiner Homepage von einer der „schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre. Über sechzigtausend Menschen fielen den Beben zum Opfer, über einhundertzwanzigtausend wurden verletzt.“ Nach Jahresfrist war von den vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan seinen Landsleuten versprochenen mehr als 300.000 neuen Wohnungen lediglich ein Sechstel gebaut worden. Die Berliner Zeitung berichtete am 6. Februar 2024, dass laut türkischer Regierung „noch immer 700.000 Menschen in Behelfsunterkünften“ in etwa 400 Containerdörfern lebten. In Nordwest-Syrien, so meldete damals das Auswärtige Amt, war die Lage unverändert „extrem angespannt“.
Daran wird sich durch die jüngste Entwicklung in Syrien wenig geändert haben. Über die Erdbebenopfer von damals spricht heute niemand, anderes beherrscht die Nachrichten aus der Region.
Gewiss gab und gibt es auch in anderen Teilen der Welt Naturkatastrophen. So bebte beispielsweise in der chinesischen Provinz Sichuan am 12. Mai 2008 die Erde. Sogar um einiges stärker als in der Türkei und folglich mit noch mehr Opfern. Und so drängt sich die naheliegende Frage auf, wie dort mit dem Desaster umgegangen wurde. In der Region östlich des tibetischen Hochplateaus – knapp halb so groß wie die DDR – verloren an jenem Maitag fast sechs Millionen Menschen ihr Obdach und etwa 70.000 ihr Leben.

Verschwenderischer Umgang mit Energie
Sechzehneinhalb Jahre nach dem Beben fahre ich mit dem Mietwagen nach Yingxiu. Dort, etwa 100 Kilometer nordwestlich der 20-Millionen-Einwohner-Metropole und Provinzhauptstadt Chengdu, lag das Epizentrum.
Es ist ein angenehmes Reisen auf der neuen Autobahn, für deren Benutzung wie inzwischen auf vielen Autobahnabschnitten in der Volksrepublik eine Mautgebühr erhoben wird. Angenehmer, als seinerzeit der Reporter der Süddeutschen Zeitung reiste. Der schlug sich im Mai 2010 als „bislang einziger westlicher Reporter“ nach Yingxiu durch. Die letzten Kilometer bewältigte er nach Selbstauskunft in einem achtstündigen Fußmarsch durch „eine Schneise aus Tod und totaler Zerstörung“. Davon ist heute nichts mehr zu ahnen oder gar zu sehen.
Die Straße jenseits der Autobahn windet sich die Berge hinauf, es ist trübe und feucht, die Wolken hängen tief. Da und dort sind im Dezembergrau kleine und größere Siedlungen zu erkennen. Die Bergdörfer sehen aus, als habe jemand Häuser an die bewaldeten Felsen geklebt. Die Bäume ringsum krallen sich mit ihren Wurzeln sichtbar ins Gestein. Über die Bergkuppen schwingen sich Leitungen von Mast zu Mast, kreuz und quer gehen die Stromtrassen. Im Tal produzieren etliche Wasserkraftwerke Energie, die in jede noch so winzige Siedlung fließt – in Heizungen wie in Computer und in digitalen Schnickschnack. Der Umgang mit Energie ist hier wie im ganzen Land reichlich verschwenderisch, nicht nur bei der Beleuchtung von Straßen und Gebäuden.
400 Staudämme waren in Mitleidenschaft gezogen
Unten im Tal strömt der wasserreiche Min Jiang dem Jangtsekiang entgegen, oft gebremst von Betonriegeln, in denen viele Turbinen laufen. Auch die Staudämme erwiesen sich damals als beachtliches Problem, etwa 400 waren in Mitleidenschaft gezogen worden.
Endlich erreiche ich einen Parkplatz oberhalb Yingxius. Die Kleinstadt zählt heute knapp 6000 Einwohner, so viele, wie seinerzeit Menschen im Ort starben. Auch im Dunst und ohne Riesenrad ist Yingxiu zu überblicken. Das hochgestellte Karussell am Rande des Parkplatzes hat offenbar ein geschäftstüchtiger Chinese errichten lassen, damit die Touristen für umgerechnet zwei Euro die Nase noch höher über das Tal recken können als zu ebener Erde. Bei diesen trüben Aussichten lohnt die Investition jedoch nicht. Andere Touristen scheinen das auch so zu sehen: Das Rad steht still.

Mehr Ruhmes- denn Trauerhalle
Die Flusssiedlung liegt gelassen in der Landschaft, als stünden die Häuser schon ewig dort. Dabei ist kein Gebäude älter als 16 Jahre. Das Museum neben dem Parkplatz ist noch um einiges jünger und nennt sich Epicenter Memorial Hall, eine zweigeschossige Gedenkhalle am Hang des Dorfes Yuzixi. Das sind ein paar Dutzend Häuschen mit winzigen Vorgärten, in denen Gemüse wächst. Auch jetzt im Winter.
Eine Etage des Stahlbetonbaus liegt in der, die andere über der Erde. Ein kühner und zugleich unauffälliger Bau eines chinesischen Architekten, mehr eine Ruhmes- denn eine Trauerhalle. Mit Installationen, Schautafeln und großen Fotos vermittelt man einen Eindruck von der Katastrophe und erklärt, wie man die Folgen überwand. Auch an jene Besucher ist gedacht, die noch nicht lesen und den Sinn der vielen Grafiken kaum erfassen können. Auf einem Brett stapeln die Kinder Bauklötze, dann drücken sie auf einen Knopf und die ganze Installation beginnt zu vibrieren: Stärke acht wie am 12. Mai 2008. Der Klötzchenturm stürzt zusammen.
Natürlich fehlt in der Bildergalerie keine der damals führenden Persönlichkeiten, welche aus der Hauptstadt herbeieilten, um den Fortschritt der Bergungsarbeiten und beim Wiederaufbau zu begutachten. Tatsächliche Opfer sieht man kaum. Nur deren Zeugnisse: Briefe, die die Überlebenden damals ihren Verwandten im Lande schrieben, Lebenszeichen aus den Trümmern und Mitteilungen, wer von der Familie nicht mehr ist oder noch vermisst wird. Andere verarbeiteten ihre Trauer in Gedichten oder Zeichnungen. Diese hängen am nackten Beton des beeindruckenden Bauwerks.
Mit einem pastoral-propagandistischen Ton
Mit Pathos wird auf Tafeln der nationale Einsatz des Wiederaufbaus in der Region in mehreren Sprachen gerühmt: „Die gesamte Partei, die Streitkräfte und die Menschen aller ethnischen Gruppen haben sich geschlossen hinter der starken Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und des Staatsrates zusammengeschlossen, um die schwere Zeit zu überstehen.“
Auch wenn der pastoral-propagandistische Ton in den Ohren eines Westeuropäers ein wenig schwülstig klingt: Der Stolz ist verständlich, weil es binnen drei Jahren in einem kollektiven Kraftakt gelang, nicht nur den vorherigen Zustand wiederherzustellen, sondern zugleich die gesamte Region mit ihrer Infrastruktur zu modernisieren. Nicht grundlos setzt sich das chinesische Wort für Krise aus zwei Schriftzeichen zusammen: Das eine steht für Gefahr und Konflikt, das andere für Chance und Neugestaltung. Die Provinz Sichuan gehört inzwischen zu den ökonomisch stärksten in der Volksrepublik.

Eine Ruine wurde zur Erinnerung stehen gelassen
Draußen geht es ein paar Stufen hinab zur eigentlichen Gedenkstätte. Eine Frau hockt auf einem Stuhl und bietet gelbe Chrysanthemen zum Kauf. Etliche Besucher haben an diesem Vormittag das Angebot bereits angenommen. Die Blumen liegen in Reih und Glied auf dem Sockel zu Beginn des Gräberfeldes. Die Wiesen am Hang werden geteilt durch schwarze Marmorblöcke, in die Namen mit Lebensdaten gemeißelt sind. Dorf für Dorf, kleine und größere, wie an der Zahl der Eintragungen zu sehen ist. Das jüngste Opfer war keine drei Wochen alt – dort finden sich besonders viele Blumen. Der Älteste, der unter den Trümmern seines Hauses starb, war 96.
Etwas abseits liegen die Soldaten, die bei ihrem Einsatz ihr Ende fanden. Sie sind gefallen, sagt die offizielle Sprachregelung. Die jungen Männer haben nicht nur einen eigenen Grabstein, sondern auch ein Gesicht. Unter ihren Bildern liegen ebenfalls reichlich gelbe Chrysanthemen. Stumm defilieren ganze Familien vorbei und beugen die Knie. Es heißt, dass bis zu 100.000 Soldaten im Einsatz waren, um Trümmer zu beseitigen und Tote zu bergen. An die 70.000, wie gesagt, aber eben nicht so viele wie 1976 in Tangshan, wo fast 700.000 Menschen starben. Es war – nach dem Beben in Shaanxi 1556 – das opferreichste nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt. In Shaanxi gingen sogar mehr als 800.000 Menschen zugrunde, weil die meisten damals in Berghöhlen lebten.
Ich rolle hinunter in den Ort, um die einzige Ruine zu besuchen, die man zur Erinnerung hat stehen lassen. Die Xuankou-Mittelschule stand erst zwei Jahre, ehe sie zusammenbrach. Sie ersetzte die Schule von Xuankou, jener Kleinstadt, die 50 Kilometer flussaufwärts in einem Stausee unterging.
Diese Ruine besitzt, wie an der Vielzahl der schweigenden Besucher leicht festzustellen ist, im nationalen Bewusstsein der Chinesen einen festen Platz. Vergleichbar vielleicht mit dem sogenannten Atombombendom in Hiroshima oder den Trümmern der Frauenkirche in Dresden zu DDR-Zeiten. Ein Mahnmal der Demut und der Ohnmacht. Es steht stellvertretend für fast 7000 Schulgebäude, die in der ganzen Provinz bei dem Erdbeben zerstört wurden.

Die Nachricht ging als Wunder um die Welt
Sprachlos steht man vor dem vormaligen Fünfgeschosser mit den Klassenzimmern, in denen 43 Schüler und acht Lehrer starben. Mehr als 1500 konnten sich ins Freie retten und zusehen, wie ihre Schule wie ein Kartenhaus zusammenstürzte. Auch die anderen zum Schulkomplex gehörenden Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch zerborstene Fenster geht der Wind, und aus den Trümmern wächst Grün. Auf einem Bohlenweg umrunde ich mit einigem Grauen das Massengrab. Immerhin: Die Retter bargen nach 68 Stunden eine elfjährige Schülerin lebend – die Nachricht ging als Wunder um die Welt.
Dass nach drei Jahren das Leben im Erdbebengebiet von Sichuan wieder völlig normal lief, dass alle Schulen wieder standen, die Staudämme gesichert waren und jede Familie, die ihr Haus verloren hatte, eine neue Bleibe gefunden hatte, war hingegen keine Nachricht im Westen wert. Wohl aber, dass der seinerzeit noch hofierte Dissident Ai Weiwei die Namen der toten Schüler sammelte und im Internet veröffentlichte mit dem Argument, dass die chinesischen Behörden alles vergessen machen wollten. „Das heutige China basiert darauf, dass wir uns der Vergangenheit nie stellen“, erklärte er damals im Deutschlandfunk.
Nun, ich gewann einen anderen Eindruck. Und Containerdörfer wie in der Türkei und in Syrien habe ich auch nicht gesehen.