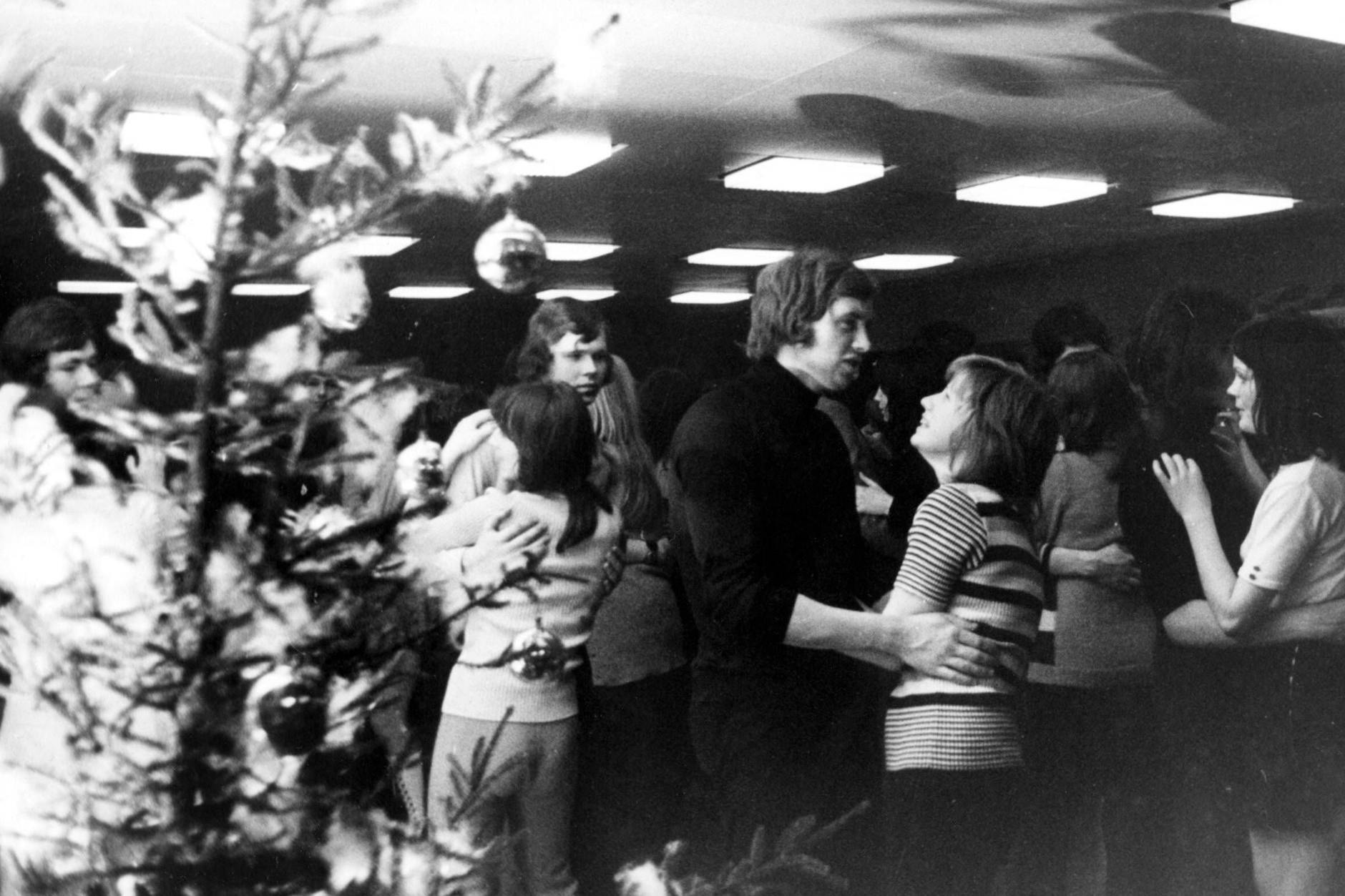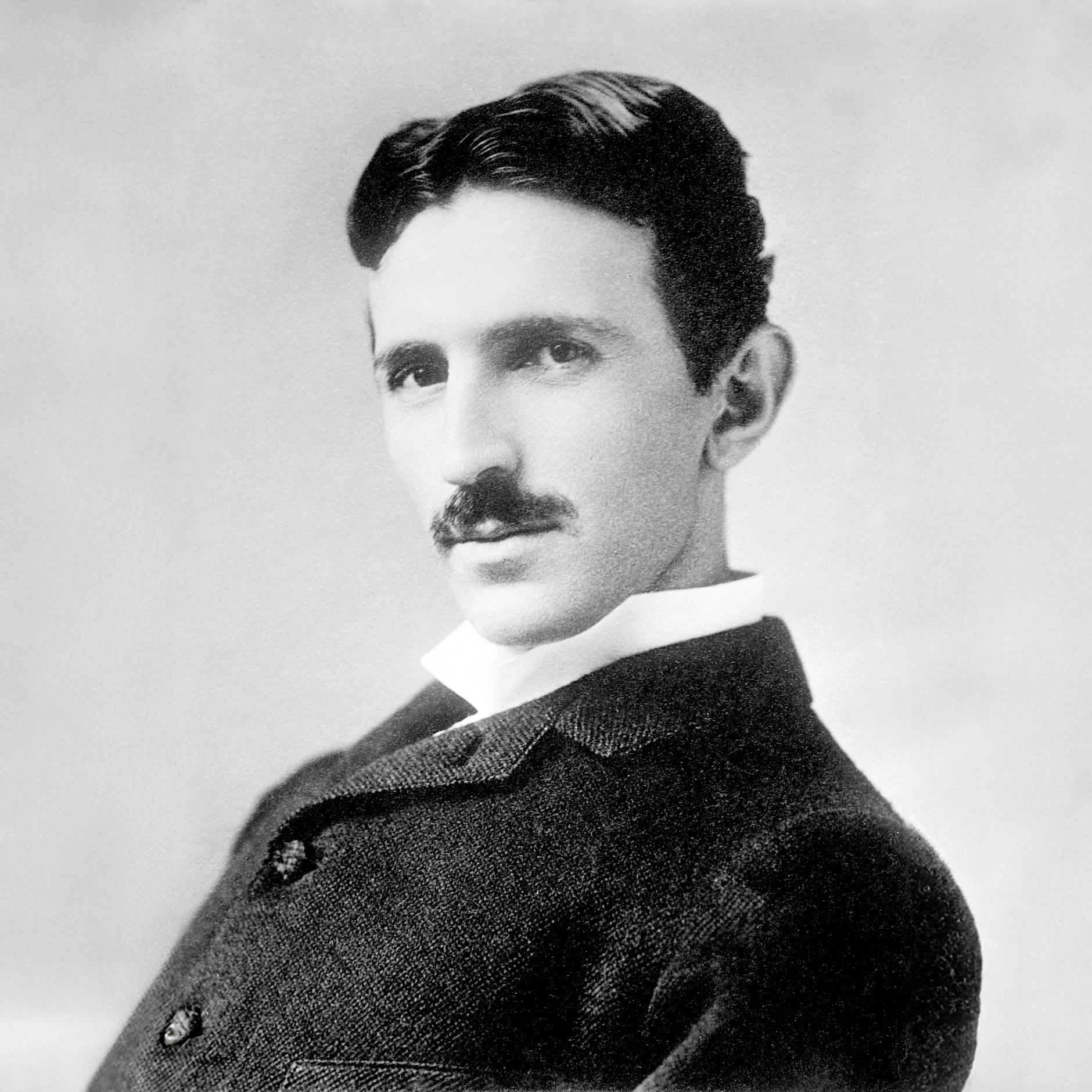Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Mein Verhältnis zu dem in den Ländern christlicher Tradition bedeutendsten Fest des Jahres war von Anfang an ambivalent. Meine Mutter feierte es halbherzig mit uns, meinem Bruder und mir. Für sie war es eine Konzession an den Zeitgeist, ein Zugeständnis gegenüber dem, was alle taten, was auch ihre Kinder von ihr erwarteten. Sie wollte sie auf keinen Fall enttäuschen. Auch in Zeiten, in denen wir in einem Kinderheim waren, kamen wir zu den hohen Feiertagen nach Hause. Sie kaufte manchmal sogar einen Weihnachtsbaum. Und vor allem gab es Geschenke.
Auf mich traf Brechts Kinderlied allerdings nur bedingt zu: Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten. Ich hatte in dieser Hinsicht meinen Geburtstag – drei Tage vor der großen Bescherung – denkbar schlecht gewählt. Für mich fielen Geburtstag und Weihnachten fast zusammen, was sich auf die Geschenke nachteilig auswirkte.

Es konnte mich auch nicht trösten, dass zu meinem Geburtstag in der Aula der Schule eine aufwendige Geburtstagsfeier stattfand, in pompösen Reden der Geburtstag des großen Führers der Völker gewürdigt wurde, des weisen Josef Stalin, der im Kreml über das Schicksal der Welt wachte und nie schlief. Ich teilte mir mit diesem schnauzbärtigen Übermenschen, diesem Heiligen, den 21. Dezember, ein wenig fiel sein Ruhm und sein Glanz und sein Licht auch auf mich herab. Sein Bild schmückte die Rückseite unserer Schulhefte, wie auch das des Präsidenten der Republik, des gütigen Wilhelm Pieck.
Zu meinem Geburtstag breitete meine Mutter die Geschenke vor mir mit dem Kommentar aus: „Such dir aus, was für Deinen Geburtstag und was für Weihnachten ist.“ Von Spannung und Vorfreude konnte unter diesen Bedingungen kaum die Rede sein. Ich mache meiner Mutter keine Vorwürfe.
Die Jugend in einem Waisenheim verbracht
1901 in der Wörtherstraße in Berlin-Prenzlauer Berg geboren, hatte sie ihre Jugend in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg als Halbwaise aus bescheidenen Verhältnissen in einem jüdischen Waisenheim verbracht, den Auerbachschen Anstalten, in der Schönhauser Allee, im Osten Berlins. An diese „Anstalten“ hatte sie die besten Erinnerungen, auch wenn keine Weihnachtsgeschenke in ihnen vorkamen. Dafür wurden alle Kinder zu Chanukka – dem großen jüdischen Lichterfest, das fast zeitgleich mit Weihnachten gefeiert wird (und ihm historisch vorausging) – vom Kaufhaus Hermann Tietz (Herti) von Kopf bis Fuß neu eingekleidet.

Doch als Kind kannte sie keine Familienfeier, zelebrierte nicht wie die Mehrheitsgesellschaft die Gemütlichkeit unter dem Weihnachtsbaum. Und auch als Erwachsene hatte sie keinen Anlass, das Verpasste nachzuholen. Von ihrer Familie waren nach den zwölf Jahren der Naziherrschaft nur mein Bruder und ich übriggeblieben. Ich kannte keine Großmutter, weder Tante noch Onkel noch Neffen oder Cousins, obwohl es sie gegeben hatte.
Bis heute fällt es mir schwer, die Feinheiten von Verwandtschaftsverhältnissen zu verstehen. Das ändert sich ein wenig, seitdem ich zwei Töchter, einen Sohn und sieben Enkel als meine Familie bezeichnen kann, und die meiner Gefährtin Monique in Frankreich hinzukommt. Weihnachten werden wir bei meiner älteren Tochter Rahel in Berlin feiern. Ich kann ihr vertrauen, dass ein wohlgeschmückter Weihnachtsbaum sowie köstliche Speisen und Getränke dem Anlass gerecht werden.
Ein vielsagender Witz
In meinem bisherigen Leben war ich jedoch denkbar schlecht darauf vorbereitet, in angemessener Weise das christliche Fest der Geburt des Heilands, wie die Mehrheit meiner Mitbürger, zu feiern. Dabei ist es längst auch ein weit über den Kreis der Christen hinaus beliebtes Fest zum Ende des Jahres, gewissermaßen ein Volksfest.
Ich denke an einen jüdischen Witz, der das sehr schön veranschaulicht: Ein jüdisches Mädchen wird in New York von ihrer christlichen Freundin eingeladen, das Weihnachtsfest mit ihr und ihrer Familie zu feiern. Sie kommt mit Geschenken beladen und ganz erfüllt von dem schönen Abend nach Hause und sagt zu ihren Eltern: „Stellt euch vor, die Christen feiern auch Weihnachten.“

An zwei Weihnachtsfeiern erinnere ich mich besonders. Die erste fällt in meine frühe Studienzeit. Meine Seminargruppe bei den Romanisten der Humboldt-Universität bestand Anfang der Sechzigerjahre aus acht Kommilitoninnen und mir. Wie in allen Betrieben, Institutionen, Einrichtungen der DDR wurde gern und ausgiebig gefeiert – besonders in der Vorweihnachtszeit. Meine Kommilitoninnen – die meisten stammten aus der Provinz, hatten bei einer Wirtin ein kleines Zimmer gemietet – fragten mich, ob wir nicht in der Karlshorster Wohnung, in der ich ein großes Zimmer zur Verfügung hatte, eine Feier machen könnte. Ich sagte zu, übernahm einen Teil der Bewirtung und verpflichtete mich sogar, einen Weihnachtsbaum zu besorgen.
Vielleicht hatte ich zu lange gewartet, es gelang mir nur noch, einen Baum zu erwerben, der nicht mal bescheidenen Ansprüchen genügte, vor allem, was seine Fülle betraf. Vermutlich hatte er längere Zeit zuunterst gelegen, war vom Gewicht andere Bäume erdrückt worden. Die Bäume wurden damals nicht wie heute aufwendig verpackt aufgestellt. Dafür kosteten sie auch nur einen Bruchteil der heutigen. Und es war auch etwas umweltfreundlicher. Obwohl die jährliche Aufzucht und das Fällen von Hunderttausenden jungen Bäumen ein ökologisch mehr als fragwürdiges Unterfangen bleiben.
Mit vielem guten Willen konnte man meinen Weihnachtbaum als solchen gelten lassen. Es war eine Frage der Perspektive. Seine Vorderseite ließ kaum zu wünschen übrig, seine hintere Seite jedoch war so gut wie nicht vorhanden, sie war flach wie ein Bügelbrett.
Ich fand eine Lösung: Ich nagelte den Baum mit seiner flachen Seite an die Wand, über der Heizung. Auf diese Weise hob er sich stattlich von der Fläche ab, seine Rundung dem Zimmer zugewandt. Geschmückt mit Kerzen und Weihnachtskugeln kam er nach meinem Empfinden dem Idealbild des Weihnachtsbaumes recht nahe. Stolz und mit mir zufrieden erwartete ich meine Gäste. Als die jungen Frauen eintraten, erkannte ich an ihren entsetzten Gesichtern, wie sehr ich mich geirrt hatte. In bester Absicht hatte ich die vorweihnachtlichen Gefühle und Erwartungen meiner lieben Mitstudierenden gründlich verletzt.

Ich versuchte, ihr Entsetzen zu verstehen, mich mit ihrer Gefühlswelt zu identifizieren, und erkannte, dass mein derart präsentierter Baum eher an den Gekreuzigten als an den Neugeborenen erinnerte. Ungewollt hatte ich einen großen Sprung in der Geschichte Jesu vollzogen, waren mir Geburt, Kreuzigung und Auferstehung, Weihnachten, Ostern und Pfingsten durcheinandergeraten. Doch bald war der erste Schock überwunden, die Köstlichkeiten und der Wein trugen zu einer entspannten Atmosphäre bei. Es wurden schließlich doch noch fröhliche Weihnachten.
Rollenspiele in Damaskus
Einige Jahre später war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften. Ich trug damals einen großen schwarzen Bart, der sich unerwartet bei einem ersten Rollenspiel bewährt hatte. 1970 begleitete ich eine Delegation des Komitees der Antifaschisten der DDR nach Syrien. Sie war von den Veteranen des Unabhängigkeitskampfes gegen die französische Kolonialmacht eingeladen worden. Ich nutzte eine freie Stunde, um mir auf dem Markt eine komplette Beduinenausstattung zu kaufen. Mit dieser eingekleidet, das Gesicht umrahmt mit dem sogenannten Arafat- oder Palästinensertuch, festgehalten von einem schräg auf dem Kopf sitzenden dicken braunen Stoffring, erschien ich zur verabredeten Stunde vor der DDR-Botschaft in Damaskus.
Ich hatte große Mühe, den misstrauischen Pförtner davon zu überzeugen, den ihm unbekannten Araber, der behauptete, der Dolmetscher der Antifa-Delegation zu sein, in die Botschaft einzulassen. Weitere Jahre später half mir mein Bart, recht glaubwürdig den Rabbiner in dem Stück „Der Dibbuk“ darzustellen. Nun bekam ich eine dritte Rolle angeboten. Ausgerechnet die eines Weihnachtsmannes.
Denn auch die Philosophen meines Institutes, von Amts wegen Marxisten, ließen es sich nicht nehmen, das heilige christliche Fest zu feiern. Dazu waren die Familien eingeladen. Für die Kinder sollte ein Weihnachtsmann Geschenke verteilen, unter allen Begleitumständen, die von der Tradition verlangt werden. Man fragte mich, ob ich bereit wäre, die Rolle zu übernehmen. Ich sagte zu, allerdings unter der Bedingung, nicht mit einem weißen Wattebart, sondern mit meinem eigenen, natürlich gewachsenen aufzutreten. So betrat ich die Bühne in einem roten Mantel und einer roten Kapuze, einen großen Sack auf dem Rücken.
Ich entnahm dem Sack ein erstes Geschenk, das von den Eltern zuvor sorgfältig ausgewählt und eingepackt worden war, verlas den Namen des Kindes und bat dieses, auf die Bühne zu kommen. Dort musste es sich allerdings sein Geschenk verdienen – mit einem Lied, einem Gedicht, einer Geschichte. In gleicher Weise rief ich nach und nach alle Kinder auf. Ich erfreute mich der glücklichen Kindergesichter, sah auf die zufriedenen Eltern – meine Kollegen – hinunter. Es wurde ein fröhlicher, entspannter Abend, der dem Gebot christlicher Nächstenliebe voll gerecht wurde.

Ein selten schönes Lob für einen Laienschauspieler
Stunden später gab mir eine Kollegin einen Dialog wieder, dem sie gelauscht hatte. Hinter ihr saßen während meiner Performance zwei etwa sechsjährige Mädchen. Sagte die eine zur anderen: „In Wirklichkeit gibt es keinen Weihnachtsmann, verkleidete Männer spielen die Rolle.“ Antwortete die andere: „Du hast recht, und man erkannt an dem weißen Wattebart, dass sie unecht sind. Doch zu uns ist der echte gekommen, kein nachgeahmter, das kannst du an seinem Bart sehen.“