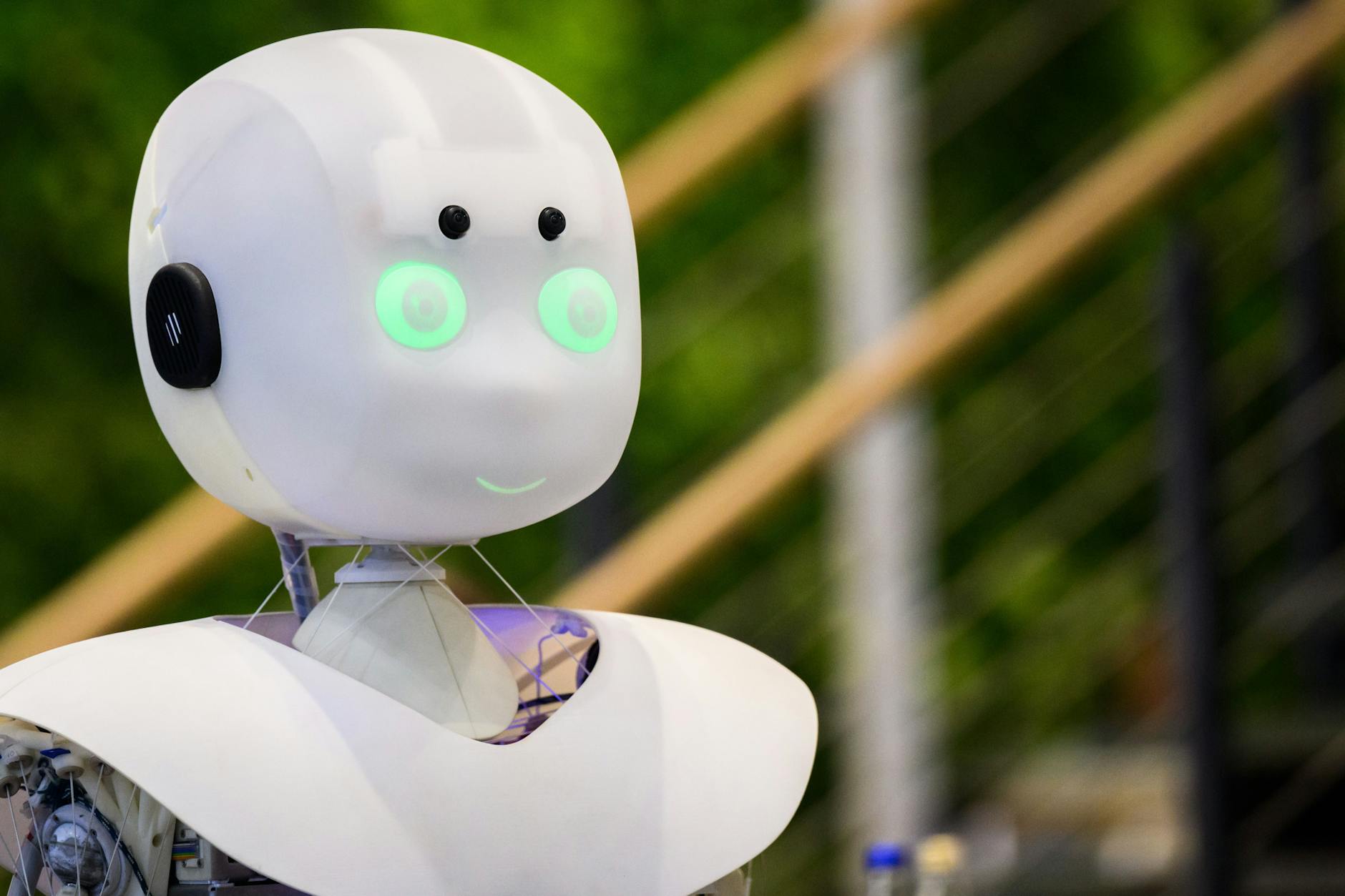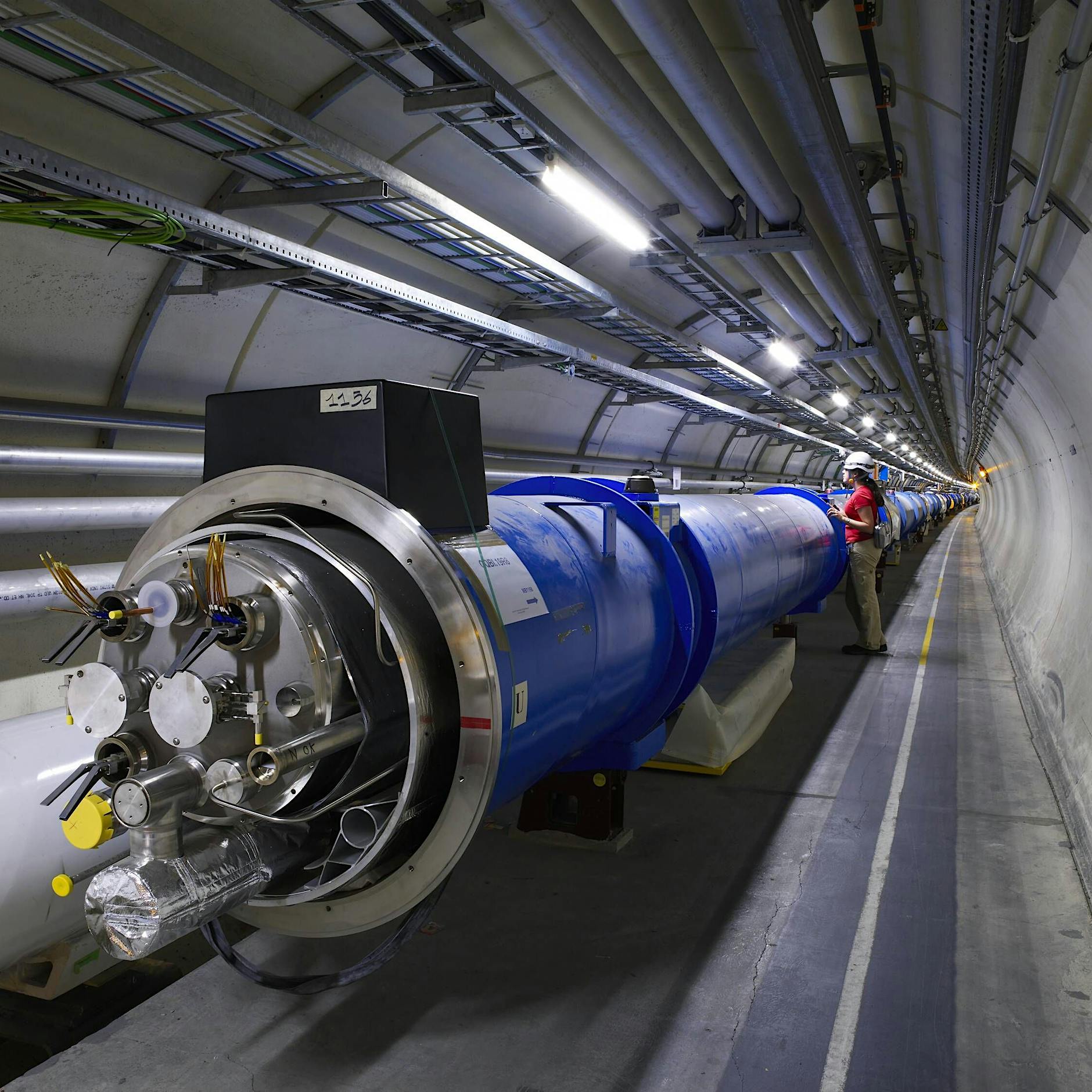Deutschland kann, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) jetzt einräumt, „in einigen Technologiefeldern nicht ohne Weiteres mit sehr innovationsstarken Ländern und Hochleistungsstandorten mithalten und (liegt) im zukunftsweisenden Bereich der Spitzentechnologien und der Digitalisierung (zurück).“
Angesichts der seit Jahren erkennbaren Gebrechen unseres Forschungs- und Innovationssystems ist das nicht überraschend. Nun will das BMBF Fortschritt wagen und hat seine stets als erfolgreich gepriesene Hightech-Strategie sang- und klanglos über Bord geworfen und sie durch eine neue „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ der Bundesregierung ersetzt, die „unsere Technologieführerschaft verteidigen und in Teilen auch neu erringen“ soll.
Dazu will sie Lösungsansätze, die mittel- bis langfristig auch das Innovationssystem neu ausrichten sollen, nicht nur in Antworten der Vergangenheit suchen. Es sieht aber nicht danach aus, als wäre das mehr als eine wohlklingende politische Floskel. Denn nicht anders als schon die zu den Akten gelegte Hightech-Strategie 2025 definiert die neuen Strategie-Missionen, die dazu dienen sollen, die beteiligten Ressorts sowie Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft auf Prioritäten und gemeinsame Leitlinien einzuschwören.
Was mit der Hightech-Strategie erreicht worden ist und was die neue Zukunftsstrategie besser machen kann, bleibt ein Geheimnis des BMBF. Auch welche Leitidee hinter ihr steht, welche Vision für Deutschland sie verfolgt, und wie sie verwirklicht werden soll, erklärt es nicht. Schwergewichtige Wissenschaftsorganisationen und Wirtschaftsverbände haben in ihren Stellungnahmen zum Textentwurf der Zukunftsstrategie, die das BMBF selbst öffentlich gemacht hat, zu Recht Antworten auf diese Fragen erwartet.
Denn Technologieführerschaft zu verteidigen oder auch neu zu erringen, kann ja nicht das oberste Ziel sein, auf das alle im Gleichschritt zumarschieren. Außerdem sei, so der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom, „angesichts knapper Kassen sowie des globalen Wettbewerbs unklar, ob auf allen Technologiefeldern die Rückstände aufgeholt werden können, geschweige denn, ob sich die Aufholjagd lohnt“.

Keine klare Strategie für die Zukunft
Den K.o.-Schlag versetzt der neuen Strategie der Chef der Expertenkommission für Forschung und Innovation, die seit Jahren die Bundesregierung berät, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Das „erklärte Ziel der hier vorliegenden Zukunftsstrategie bleibt in der alten Logik stecken: Deutschlands (und Europas) führende Rolle als Forschungs- und Innovationsstandort zu unterstützen. […] Wir haben rund tausend erstklassige Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen im Land, wir haben Spitzenforscher und Weltklasseleistungen in vielen Grundlagendisziplinen. Was wir weniger haben, ist eine klare Strategie für die Zukunft“.
Deshalb steht auch die Absicht der Bundesregierung, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und der Wirtschaft auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, begründungsfrei im Raum. Zumal Deutschland mit einer Quote von 3,1 Prozent schon jetzt weltweit in der Spitzengruppe liegt, laut Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stand 2022) zum Beispiel deutlich vor den USA (2,2 Prozent) und China (2,1 Prozent).
Allerdings „(gibt es) in keinem Land der Erde definierte Vorstellungen über den notwendigen oder auch nur den hinreichenden Umfang staatlicher und privatwirtschaftlicher Forschungsausgaben“, so Wolfgang Frühwald, der vor vier Jahren verstorbene Alterspräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, schon 1999.
Jedenfalls hat die Steigerung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den vergangenen Jahren Deutschland nicht davor bewahrt, im weltweiten Innovationswettbewerb an Boden zu verlieren. Welche Ziele und Missionen man auch definieren und wie viel Geld man für Forschung und Entwicklung auch aufwenden mag, diesen Sinkflug wird das nicht stoppen können, solange man an überkommenen Denkmustern festhält, statt sich von dem bisherigen „Innovationstheater“, wie Katharina Hölzle, Leiterin des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart sowie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, es nennt, zu verabschieden.
Wir dürften uns, meint sie, nicht länger vormachen, „dass eigentlich doch alles ganz gut läuft, ein paar kleine Veränderungen und Anpassungen ausreichen und unsere Stärken der Vergangenheit auch die der Zukunft sein werden“. Stattdessen erachtet sie es für notwendig, vorhandene Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen abzuschaffen oder zu verändern.
So fortschrittswagemutig ist das BMBF aber denn doch nicht. Es belässt es bei eingefahrenen Routinen und tastet Strukturen nicht an. Stattdessen fügt es zwei neue Agenturen in das Forschungs- und Innovationssystem ein und deklariert das als strategische Maßnahme, um dessen Innovationsfähigkeit zu stärken. Obwohl dazu schon im Rahmen der Hightech-Strategie eine kaum noch überschaubare Palette von Gremien, Plattformen, Pakten, Netzwerken, Foren und Agenturen, in das System eingebaut worden sind.
Gebraucht wird Modernisierung
Eine Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) soll, heißt es auf der Internetseite des BMBF, die „Transferbewegung verbreitern und beschleunigen“, indem sie vor allem Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) sowie kleine und mittlere Universitäten unterstützt, dazu soll sie „individuell und vor Ort neue Transfernetzwerke und Partnerschaften mit anderen Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren oder der öffentlichen Verwaltung aufbauen“.

Damit könne sie „Lücken füllen“, Innovationsregionen und bestehende Innovationsförderprogramme sowie die ebenfalls neue Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) „ergänzen“. SPRIND soll hochinnovative Ideen mit dem Potenzial für eine Sprunginnovation aufspüren und fördern. Sie stehe für eine positive „Denkkultur des Scheiterns“, die Freiräume und Risikobereitschaft für neue Ideen befördern soll und sei somit ein „Reallabor“ für innovative Wege der Vernetzung und Förderung im „Innovationsökosystem“.
Dieses forschungspolitische Manöver nach alter Manier stößt in Wissenschaft und Wirtschaft auf mehr Kritik als Gegenliebe. Nicht nur, dass bei SPRIND die großen Player außen vor blieben, lasse sich Wissenstransfer nicht „in separierte Organisationsformen oder Agenturen auslagern“. Vielmehr sei es nötig, das gesamte Innovationssystem samt der Instrumente der Forschungsförderung und bestehender Institutionen zu modernisieren und Strukturen aufzubauen, die Grundlagenforschung, Angewandte Forschung und Wissenstransfer systemisch verzahnen und darin auch systematisch Studierende einzubinden.
Auch die in der Zukunftsstrategie benannten „Steuerungseinheiten“ seien kritisch zu hinterfragen. Denn: „Weder Industrie noch Wissenschaft“, so der Verband der Chemischen Industrie, „werden sich in dem gewünschten Maße in Missionen einbringen, wenn diese ausschließlich vonseiten der Politik und Verwaltung gesteuert werden.“
Warum sich das BMBF einer Reform des Forschungs- und Innovationssystems verweigert, obwohl es aus der Wissenschaft und der Wirtschaft dazu gedrängt wird, und eine „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ ohne klares Ziel und ohne erneuerte Instrumente und Prozeduren vorgelegt hat, die den Sinkflug von Forschung und Innovation sicher nicht aufhalten wird, ist kaum zu verstehen.
Zumal die Expertenkommission für Forschung und Innovation in ihrem Gutachten 2023 die Alarmglocke geläutet und gemahnt hat, dass sich auch die Bundesregierung selbst „den Anforderungen stellen, sich für neues Denken und innovative Lösungen, neue Zielsetzungen und Strategien sowie neue Handlungs- und Kooperationsformen öffnen (muss). Sie ist ebenso aufgerufen, ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen und ihre Prozesse grundlegend zu erneuern. Mit einem Weiter-wie-bisher wird man die anstehenden langfristigen Aufgaben nicht lösen können“.
Was muss sich ändern?
Leider belassen es auch Wissenschaftsorganisationen und Wirtschaftsverbände bei Kritiken und Appellen, ohne selbst Ideen anzubieten, wie ein reformiertes Forschungs- und Innovationssystem konkret aussehen könnte, das ihnen Rechnung trägt.
Denkbar wäre beispielsweise, die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen (AiF) zu einer gemeinsam vom Bund und der Wirtschaft getragenen Forschungs- und Transferorganisation zu vereinigen und diese so zuzuschneiden und zu profilieren, dass sie die Projektförderung des Bundes übernehmen kann; denn beiden ist der Transfer von Forschungsergebnissen in ihre Gene geschrieben und beide werden, wenngleich auf unterschiedliche Weise, vom Bund und der Industrie finanziert.
Die FhG ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung, deren Institute vor allem Auftragsforschung für Großunternehmen, aber auch Grundlagenforschung betreiben. Die AiF ist ein von der Industrie getragenes Netzwerk aus forschenden Unternehmen, Forschungsvereinigungen und -instituten zur Förderung von Forschung, Transfer und Innovation im Mittelstand.

Sie organisiert als Projektträger auch die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung. Beide sind daher so tief wie kaum eine andere Forschungsorganisation sowohl mit den Belangen der Forschung als auch mit den Erfordernissen und Bedingungen für die Anwendung von Forschungsergebnissen vertraut.
Da sie durch vielfältige Stränge sowohl mit Unternehmen verschiedener Branchen der Wirtschaft als auch mit Einrichtungen der gesamten Forschungslandschaft verbunden sind, haben sie einen breiten Überblick über nahezu das gesamte Forschungs- und Entwicklungsgeschehen in Deutschland.
Gebraucht wird fundamental neues Denken
Aufgrund dieser Kompetenzen und Erfahrungen in der Forschung, der Forschungskooperation und dem Projektmanagement könnte eine aus der DFG und der AiF hervorgegangene Forschungs- und Transferorganisation rechtzeitig förderwürdige Projekte identifizieren und neue Formen und Instrumente einer bürokratiearmen Förderung entwickeln, die sich nicht am Modell einer linearen Abfolge von Grundlagenforschung, Angewandter Forschung, Entwicklung und Transfer orientieren.
Denn in der Realität sind das zwar unterscheidbare, aber synchrone Phasen eines ganzheitlichen Innovationsprozesses, die wechselseitig miteinander verbunden sind und sich auf vielfältige Weise gegenseitig befruchten.
Damit eine solche strategisch angelegte Erneuerung von Strukturen und Prozessen in unserem Forschungs- und Innovationssystem gelingen kann, müssten alle beteiligten und betroffenen Akteure über ihren Schatten springen und das Risiko wagen, wirklich fundamental neu zu denken. Vermutlich werden viele aber ein Arsenal von Argumenten vorbringen, mit denen sie begründen werden, dass ein solches Vorhaben absurd und nicht realisierbar ist.
Vielleicht hätten sie damit sogar recht. Aber dann sollten sie die neue Forschungs- und Innovationsstrategie des BMBF nicht nur kritisieren und grundlegende Änderungen fordern, sondern selbst entweder Ideen entwickeln, wie ein reformiertes Forschungs- und Innovationssystem konkret aussehen könnte oder eingestehen, dass sie nicht gewillt oder in der Lage sind, grundlegend neue Wege zu gehen und radikal neue Lösungen zu entwickeln.
Klaus Urban, Jahrgang 1944, war unter anderem Leiter der Abteilung Forschungsorganisation der Akademie der Wissenschaften der DDR. Im Bundesforschungsministerium war er als Regierungsdirektor für die Materialforschung zuständig. Von 1996 bis 1999 war er Nationaler Experte bei der EU-Kommission.