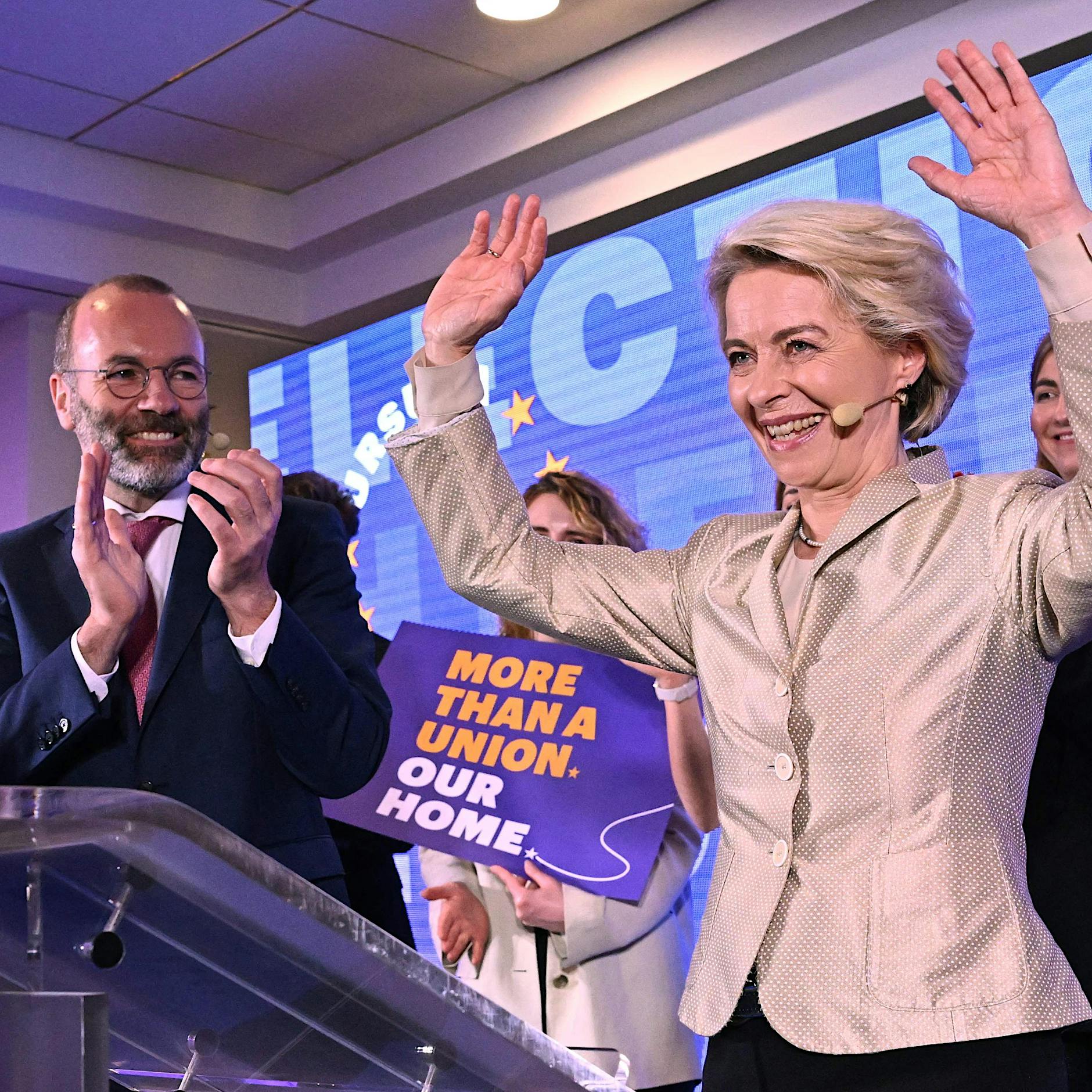Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Die Grünenvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sind zurückgetreten. „Das Wahlergebnis von Bündnis 90/Die Grünen am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade“, hieß es in einem Statement. Und weiter: „Dabei geht es nicht um das Schicksal einer Partei. Wir stehen vor einer Bundestagswahl im nächsten Jahr, bei der es entscheidend darum gehen wird, welchen Weg Deutschland für die nächsten Jahre und Jahrzehnte einschlägt, welches Land wir sein wollen.“
Die Grünen scheinen erkannt zu haben, dass die Wahlen in Ostdeutschland nicht nur eine Abstimmung über die Landespolitik waren und sich die Ergebnisse wesentlich gegen die amtierende Bundesregierung zu richten scheinen. War das der Anfang von ihrem Ende? Noch nicht ganz, die Koalitionäre im Bund gehen offenbar zur Tagesordnung über, gleichwohl auch sie vom Wähler abgestraft wurden.
Doch woher kommt diese extreme Unzufriedenheit? Sie auf das Thema Migration zu reduzieren, wie allgemein üblich, wäre zu einfach gedacht. Wir haben es im Lande leider mit einer kriselnden Wirtschaft zu tun. Die Leute fürchten schlicht und ergreifend um ihren Wohlstand. Der dümpelt für viele schon lange nur in eine Richtung – abwärts. Beschleunigt durch eine galoppierende Inflation und eine verfehlte Energiepolitik. Das Jahr 2022 bescherte den Deutschen die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte.
Jedoch der Ampel die alleinige Schuld an dieser Talfahrt in die Schuhe zu schieben, wäre zu kurz gegriffen. Egal ob Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder GroKo, alle etablierten Parteien waren nämlich seit mehr als 25 Jahren dabei, mit einer neo-bzw. wirtschaftsliberalen Politik einem besonders markt-radikalen Kapitalismus in Deutschland den Weg frei zu machen. Lohnverzicht, Rentenkürzungen und die Anhebung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent gehen auf sein Konto. Genauso wie unsere eingestampften Sparbücher, der Mietenwahnsinn oder eine kaputtgesparte Infrastruktur. Auch dass von Privatisierungsfetischisten Kliniken dichtgemacht werden oder Pflegeheime auf Maximalprofit getrimmt sind. Dass dort im Schnitt 2871 Euro pro Monat im ersten Aufenthaltsjahr – das Doppelte einer Durchschnittsrente von 1384 Euro – als Eigenanteil für die stationäre Pflege kassiert werden darf, ist diesem Turbo-Kapitalismus anzulasten.
Politik für Reiche
Allein für Wohlhabende und Besserverdienende gab es Geschenke, deren Interessen wurden nachhaltig bedient: Der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer wurde um 11 Prozentpunkte abgesenkt, eine Vermögensteuer wird nicht mehr erhoben, die Erbschaftsteuer ist viel zu gering und die Steuern auf Kapitalerträge wurden bei gerade mal 25 Prozent eingefroren. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die privaten Geldvermögen in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelten. 7716 Milliarden Euro sind auf diversen Konten und Depots gebunkert. Ein schöner Batzen, leider höchst ungleich verteilt. Wenn heute 90 Prozent des Privatvermögens in der Hand von 20 Prozent der Bevölkerung liegen, und die untere Hälfte der Bevölkerung so gut wie gar nichts besitzt, braucht sich keiner zu wundern, wenn viele Wähler sich von denen abwenden, die in der Vergangenheit den Sozialstaat zerlegt haben, sodass die Reichen reicher und alle anderen ärmer wurden.
In Deutschland werden vor allem Arbeitnehmer und Selbstständige, diejenigen mit den mittleren und unteren Einkommen, mit Steuern und Abgaben übermäßig stark belastet, müssen sich aber anhören, dass für Schulen, Rente, Straßen und Krankenhäuser das Geld fehle. Da stellt sich natürlich die Frage, warum diese Misere nicht endlich mit einem Politikwechsel überwunden wird. Auch abseits neuer Staatsschulden.
Nur ein Beispiel: Eine Abgabe auf die großen Geldvermögen in Höhe des Eingangssteuersatzes wie bei den Einkommen und der Staat könnte seine wegen der Schuldenbremse liegen gebliebenen Milliarden-Investitionen in Infrastruktur und Gemeinwesen locker stemmen. Eine Belastung der Reichen – geht so was? Es beträfe nur ihre Euros. Ihre Betriebsvermögen – von Reichenflüsterern gern bei Gerechtigkeitsdebatten als Nebelkerze in die Runde geworfen – blieben dabei außen vor. Ebenso ihre Immobilien oder Luxusgüter.
Geht trotzdem nicht? Bei den Alten ging es jedenfalls! Rot-Grün beschloss vor 20 Jahren die Anhebung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre, beschnitt damit durch die Hintertür die Renten um 7,2 Prozent. Darüber hinaus hat man die Besteuerung der gesetzlichen Renten eingeführt, viele Ruheständler werden so um mindestens weitere 14 Prozent geschröpft. Man sieht, wo ein politischer Wille ist, eröffnen sich Spielräume, um das Staatssäckel zu füllen.
Gelegentlich wird ja kolportiert, dass es bloß an der Kommunikation und am Bild läge, wenn der Ampel schlechte Noten gegeben werden. Gewiss, wenn ein grüner Wirtschaftsminister drohende Insolvenzen von Unternehmen dahingehend erklärt, dass sie dann eben mal eine Zeit lang aufhören zu verkaufen, oder seine Parteifreundin und Ministerkollegin im Auswärtigen Amt darüber fabuliert, dass wir einen Krieg gegen Russland kämpfen, hat das sicherlich kommunikativ Luft nach oben. Schlimmer ist aber, dass es von erheblicher Inkompetenz im Amt zeugt, peinlich und gefährlich zugleich ist. Was hätte wohl ein Helmut Schmidt zu solchen Ministern gesagt? Und wenn Grünen-Chefin Ricarda Lang anzweifelt, dass das starke Wahlergebnis der Alternative für Deutschland (AfD) ein Beleg für eine gescheiterte Migrationspolitik sei, grenzt das an Realitätsverweigerung oder politische Naivität. Die Konsequenz hat sie mit ihrem Rücktritt gezogen. Das verdient Respekt, damit ist aber kein einziges Sachproblem gelöst.
Einstürzende Brücken sprechen ihre eigene Sprache
Doch bei vielen Themen, die die Leute umtreiben, hilft auch die professionellste Kommunikation nicht wirklich. Einstürzende Brücken sprechen ihre eigene Sprache, genauso wie fehlende Wohnungen, ewige Wartezeiten auf einen Arzttermin oder unpünktlicher öffentlicher Personenverkehr. Oder wenn viele Rentnerinnen nach einem langen Arbeitsleben feststellen müssen, dass sie mit ihrer Rente nicht mehr bekommen als all die über fünf Millionen Menschen, die bei uns leistungslos von Bürgergeld und Sozialhilfen leben. Und etwa die Hälfte der Bezieher sind eben keine Bürger dieses Landes. Zur Klarstellung, nichts gegen eine breite Solidargemeinschaft und die in diesem Jahr vorgenommene deutliche Erhöhung des Bürgergeldes. Doch zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit muss mit den Renten nachgezogen werden. Die Erhöhung in diesem Jahr reicht dazu bei weitem nicht aus. Die war schon zuvor von der Inflation mehr als aufgefressen worden. Gleiches gilt für die unteren Lohngruppen.
Auch die Debattenkultur in den Medien kommt im Volk nicht immer gut an. Es wird viel zu viel einseitig moralisiert und der Meinungskorridor eingeengt. Nur drei Beispiele aus einer langen Liste von Themen, die am Maßstab sogenannter Political Correctness, wer auch immer den definiert hat, gemessen werden: Wer in Wort und Schrift am generischen Maskulinum festhält, ist gegen Vielfalt und hat die Gender Studies nicht verstanden. Wer die unkontrollierte Migration eindämmen will oder auch nur ein Fragezeichen über die schöngeredete Integration setzt, wird der Fremdenfeindlichkeit verdächtigt, zumindest wird seine Weltoffenheit angezweifelt. Wer für Verhandlungen zur Beendigung der russischen Aggression in der Ukraine eintritt, wird zum Putin-Freund abgestempelt.
Es gab also eine Reihe guter Gründe für die Bürger, den Ampel-Parteien, CDU inklusive, jüngst die Zustimmung an den Wahlurnen zu verweigerten. So funktioniert Demokratie. Die AfD erhielt knapp ein Drittel aller Stimmen. Fraglich ist allerdings, ob diese Partei die Interessen der kleinen Leute, der arbeitenden Mitte der Gesellschaft, besser vertritt als die anderen. Die AfD will laut ihrem Grundsatzprogramm Erbschaft- und Vermögensteuern ganz abschaffen und bei anderen Steuern Obergrenzen einführen, auch bei den Sozialabgaben. Trotzdem wird sie von vielen gewählt, denen ein solches Programm nicht zugutekommt.
Sogar die Jugend wählt rechts. Ein Paradoxon, das wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern der Euro-Zone oder den USA beobachten können, nicht die linken, sondern rechte Parteien profitieren von der Unzufriedenheit der Leute in den Mittelschichten mit der wirtschaftsliberalen Politik, die zulasten ihres Wohlstands geht. Und natürlich von den Ängsten, die bei ihnen durch den zunehmenden Migrationsdruck ausgelöst werden und auf den die herrschende politische Klasse keine Antwort findet oder finden will. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hält mit einigem Erfolg gegen diesen Trend. Ob die etablierten Parteien zu einer Kurskorrektur fähig sind, wird sich zeigen. Der Bundesvorstand der Grünen ließ in seinem Statement zum angekündigten Rücktritt wissen: „Es braucht einen Neustart“. Gleich einen Neustart? Es geht auch einfacher. Die Reset-Taste würde genügen, zurück zu einer Marktwirtschaft, vor der „sozial“ wieder großgeschrieben wird.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.