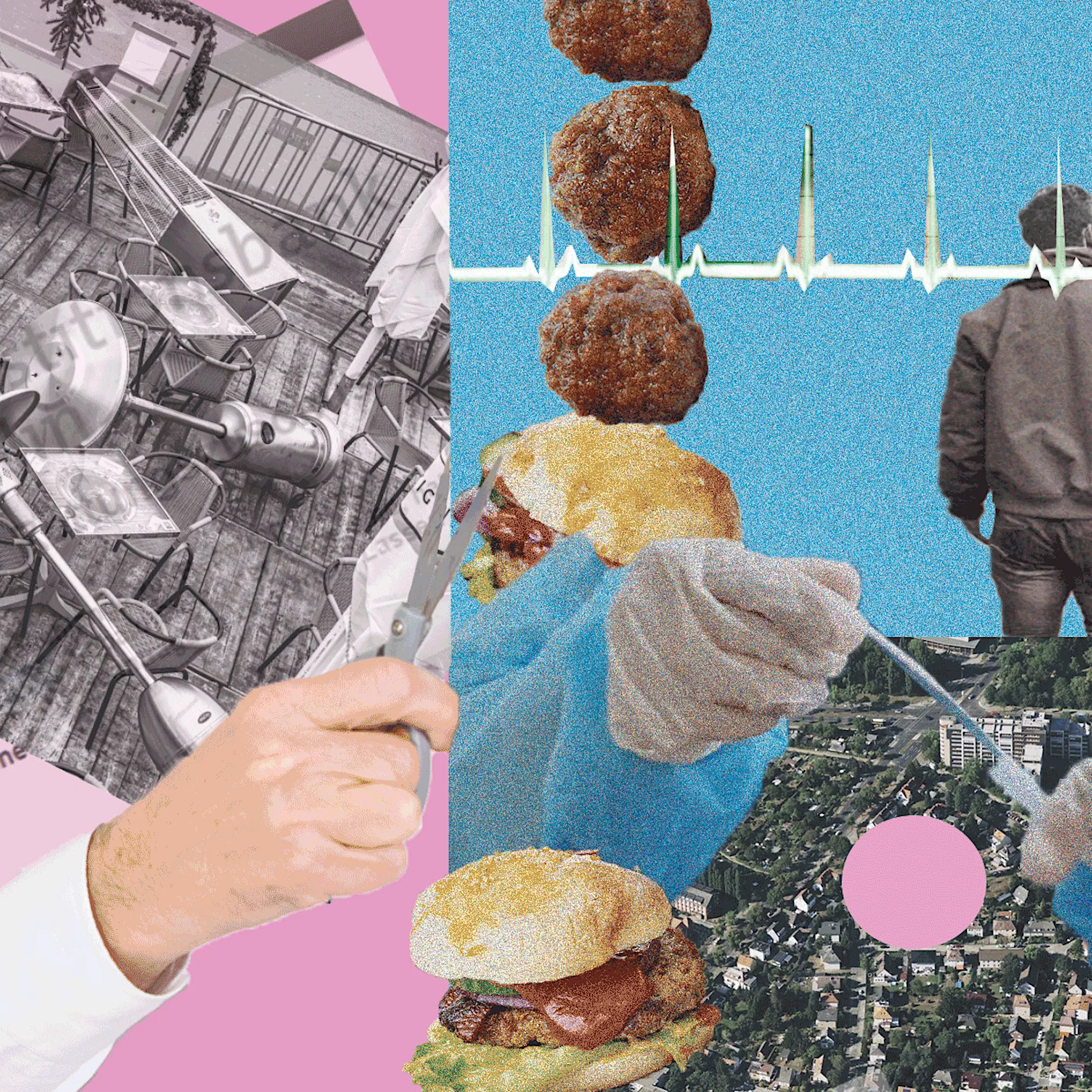In der Ecke neben dem weißen Kamin mit der Glashaube steht ein rotes Sofa. Auf dem abgezogenen Dielenboden liegt ein gewebter Teppich in Brauntönen, passend zur ockerfarbenen Wand. Das Wohnzimmer ist groß. Charlotte M. wohnt auf 140 Quadratmetern, die Wohnung gehört ihr. „Ich habe sie vor zwölf Jahren gekauft, damals war sie noch bezahlbar.“ Der Preis: 450.000 Euro. „Heute ist sie das Dreifache wert.“
Wenn man auf dem roten Sofa sitzt, blickt man auf die Terrasse und die mit Lavendel, Efeu und Petunien bepflanzten Terrakotta-Töpfe, in denen Solarleuchten stecken. Charlotte M., 51 Jahre alt, wohnt in einem Gartenhaus, vom hektischen Treiben auf den Straßen in Berlin-Mitte bekommt sie kaum etwas mit. „Hier ist meine Ruhe-Oase, hier tanke ich Kraft.“
Es ist 19 Uhr, sie ist gerade mit dem Fahrrad aus dem Büro gekommen. Die Sonne scheint auf die Terrasse. „Ich habe um 8 Uhr angefangen zu arbeiten, musste mehrere Meetings vorbereiten, Berichte schreiben und Geschäftspartner kontaktieren. Ich telefoniere manchmal den ganzen Tag.“ Heute hat sie gegen 18.30 Uhr im Büro ihren Laptop zugeklappt.
Charlotte M. ist Geschäftsführerin eines Family-Office-Unternehmens. Diese Firmen dienen der Verwaltung, der Organisation und dem generationsübergreifenden Erhalt des Vermögens einer Familie. „Mein Job ist es, das Vermögen von reichen Menschen zu verwalten und anzulegen, in Fonds, Aktien oder Unternehmensbeteiligungen“, sagt sie. Millionen-Beträge wandern manchmal über ihren Tisch. Dafür muss sie sich in Gesellschafterstrukturen auskennen, unentwegt mit Steuerberatern und Rechtsanwälten kommunizieren. Sie hat ein Team von zehn Angestellten, die sie dabei unterstützen. Sie hat sie selbst eingestellt, weil sie sich in Personalfragen auskenne, sagt sie. „Menschenkenntnis ist das A und O.“
Vor zwei Tagen führte sie mal wieder ein Mitarbeitergespräch. Es ging um Leistung und Feedback. „Das schafft eine Atmosphäre einer kreativen Zusammenarbeit. Je mehr meine Mitarbeiter sich geschätzt fühlen, desto besser ist das Geschäftsklima.“
Sie schaut prüfend nach draußen. „Ich muss gleich noch Blumen gießen, das geht nur abends, wenn es nicht mehr so heiß ist.“ Dann sieht sie auf ihren Laptop, den sie gerade wieder aufgeklappt hat. Zahlen stapeln sich in einer Excel-Tabelle. „Ich habe heute extra einen Kassensturz gemacht, das war auch für mich lehrreich.“
Wir treffen Angestellte, Rentner, Gastronomen und viele mehr, die uns offen darlegen, wie viel sie verdienen und was davon jetzt und künftig noch übrig bleibt. Alle, die uns einen Blick in die Haushaltskasse erlauben, bleiben auf Wunsch anonym.
Wenn auch Sie uns Ihre Lage schildern wollen, können Sie uns gerne schreiben. Kontakt: leser-blz@berlinerverlag.com
Charlotte M. ist in einem 2400-Seelen-Dorf in Unterfranken groß geworden. Sie wuchs inmitten von Feldern, Wäldern, Seen auf. Und von Nachbarn auf, die neugierig am Zaun standen. „Man war eine gläserne Person, musste immer darauf achten, was man preisgibt und wie man sich verhält.“ Du musst was schaffen, sagte man immer zu ihr. Die Nachbarn meinten nicht unbedingt arbeiten, sondern heiraten. Sie lächelt. „Ja, das Dorfleben. Ich habe es gemocht, aber mich hat es nach dem Abitur in die Ferne gezogen.“
Sie entschied sich für Heidelberg, schrieb sich an der Universität für Politikwissenschaften und Romanistik ein. „Ich wollte Journalistin werden, damals noch, aber es kam anders.“ Nach fünf Jahren hatte sie einen Magister-Abschluss und zudem einige Auslandssemester absolviert. In den kommenden Jahren schlossen sich noch ein paar Semester in Betriebswirtschaft an. „Ich liebe Zahlen, neben Literatur und Politik.“
Die Wahl-Berlinerin, rote Haare, blaues Kleid, steht kurz auf, lässt Wasser aus dem Hahn in ein Glas laufen. Die Solarleuchten auf der Terrasse fangen an zu schimmern. „Mein Weg war schnell entschieden, es war eher Zufall, aber ein guter.“ Nach dem Studium nahm sie einen Job in einem internationalen Logistik-Unternehmen an. „Ich konnte perfekt Französisch und Englisch, das hat mir damals geholfen.“
Berliner Chefin managte das Vermögen eines Unternehmers
Ins Ausland reist sie heute noch oft. „Das erweitert den Horizont, man gewinnt einen anderen Blick, auch aufs eigene Land. Ich muss immer wieder über den Tellerrand schauen. Das gibt mir Energie und stärkt meine kritische Einstellung gegenüber unserem Leben in Deutschland und Europa.“ Sie brauche diese geistige Freiheit.
Fünf Jahre war sie in der Firma, danach begann sie, für einen Unternehmer zu arbeiten. „Dort habe ich das Handwerkszeug für meinen heutigen Job gelernt.“ Sie habe für ihren damaligen Chef alles gemanagt – vom Vermögen bis hin zu seinen Bilanzen. Manchmal organisierte sie auch Golfturniere oder Abendessen. „Ich war plötzlich in einer Welt gelandet, die ich vorher nicht kannte.“ Sie nimmt einen Schluck Wasser. Und ergänzt: „Es ist auch nicht meine Welt.“
Bei dem Unternehmer blieb sie 15 Jahre, seitdem ist sie Geschäftsführerin in dem Family-Office. Sie schaut auf ihren Laptop und rechnet vor: „Ich verdiene – je nachdem, wie die Tantiemen ausfallen – im Jahr 160.000 Euro brutto. Mein Festgehalt beläuft sich auf 11.000 Euro brutto monatlich, das macht netto etwa 7000 Euro. Aber wie gesagt, oft kommt eine Prämie obendrauf.“ Für ihre inzwischen abbezahlte Wohnung gibt sie derzeit etwa 650 Euro im Monat aus. „Das sind die Betriebskosten, und die sind recht hoch, beinahe wie eine Miete.“ Im kommenden Jahr muss sie 100 Euro mehr bezahlen.
Hinzu kommt eine Rentenvorsorge von 170 Euro. „Es ist die Riester-Rente, die habe ich damals gleich abgeschlossen, als sie eingeführt wurde.“ Etwa 200 Euro fallen im Monat für Telefon, GEZ und Internet an. Ein Auto hat sie nicht, dafür ein BVG-Monatsticket von 65 Euro. Das Geld wird abgebucht, in den vergangenen drei Monaten profitierte sie automatisch von dem 9-Euro-Ticket.
Ansonsten fährt sie oft abends nach Terminen mit dem Taxi nach Hause. Alle zwei Monate besucht sie ihre Mutter in Bayern, manchmal auch öfter. Dorthin fährt sie mit dem Zug. „Für Taxifahrten innerhalb Berlins und für die Bahnfahrten zu meiner Mutter gebe ich etwa 100 Euro im Schnitt im Monat aus.“ Und dann sind da noch Blumen, für die sie etwa 30 Euro im Monat ausgibt. „Vor allem im Sommer, ich liebe Blumen.“
Für Lebensmittel im Monat gibt sie 100 Euro die Woche aus, sprich 400 Euro im Monat. „Ich gehe außerdem oft essen, mindestens zweimal die Woche, das sind im Monat bestimmt zusätzlich noch einmal 400 Euro, die ich in Restaurants ausgebe.“ Für Drogerieartikel zahlt sie etwa 100 Euro.
Jüngst überwies sie eine große Spende an Ärzte ohne Grenzen
Sie lehnt sich zurück und sagt: „Ich weiß, dass es mir gut geht.“ Sie versuche, andere teilhaben zu lassen. „Ich unterstütze meine Familie, meine Mutter hat eine kleine Rente. Und ich spende außerdem ziemlich viel Geld an soziale Organisationen.“ Jüngst überwies sie 3000 Euro an Ärzte ohne Grenzen, als der Krieg in der Ukraine losging. Sie hat überlegt, ob sie Geflüchtete aufnehmen soll. „Doch da sind so viele bürokratische Hürden aufgebaut worden, dass ich aufgegeben habe. Ich hatte dann auch Bedenken, weil ich kaum Zeit für eine Flüchtlingsfamilie gehabt hätte. Ich arbeite oft lange.“
Das Gemeinwesen sei ihr sehr wichtig, sagt sie. „Ich trete daher auch nicht aus der Kirche aus, weil die für mich, als ich noch im Dorf lebte, eine ganz wichtige soziale Institution war.“ An Kirchensteuer zahlt sie etwa 5500 Euro im Jahr.
Ich musste mich entscheiden. Job oder Kind. Alle reden von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber das ist nach wie vor nicht so.
Charlotte M. lebt allein, sie und ihr Partner haben sich vor drei Jahren getrennt. „Ich bin in der Wohnung geblieben, weil ich sie damals gekauft habe. Unsere Interessen haben sich irgendwann auseinanderdividiert, leider“, sagt sie.
Wegen ihres Berufs ist sie kinderlos geblieben. „Ich musste mich entscheiden. Job oder Kind. Alle reden von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber das ist nach wie vor nicht so.“ Ein Mann habe es da nach wie vor leichter. „Er würde in gleicher Position wahrscheinlich auch das Doppelte verdienen.“ Sie weiß, wovon sie redet. „Ich bewege mich tagtäglich in einer Männerwelt und muss um Akzeptanz kämpfen und immer besser sein als andere.“
Charlotte M. ist 1,60 Meter groß und von zierlicher Statur. „Ich trage immer hohe Schuhe, um meinen Kollegen und Geschäftspartnern wenigstens annähernd auf Augenhöhe zu begegnen.“ Sie wisse aber, wie sie sich durchsetzen könne. „Das habe ich den stabilen Familienverhältnissen in meiner Kindheit zu verdanken.“ Über die Jahre hat sie sich zudem diplomatisches Gespür erarbeitet. „Ich weiß inzwischen, wem ich trauen kann und wem nicht. Die Luft oben ist dünn.“
Als 2021 die SPD an die Macht kam, hat sie sich gefreut. „Sie ist für mich trotz vieler Fehltritte – wie Hartz IV – die Partei der sozialen Gerechtigkeit, und die brauchen wir gerade jetzt in Deutschland.“ Die Krise zeige, dass die Kluft zwischen Arm und Reich viel zu groß geworden sei. „Wir haben eine soziale Schieflage im Land.“ Statt daran etwas zu ändern, renne die Regierung den Entwicklungen meistens hinterher. Gerade zeige sich das besonders in der Umweltpolitik. „Erneuerbare Energien hätten schon viel früher ausgebaut werden müssen. Die Quittung zahlen wir jetzt, weil wir am Gashahn Russlands hängen, statt uns selbst versorgen zu können.“
Jetzt werde auch deutlich, dass vor allem ärmere, aber auch mittelständische Haushalte unter dieser Misswirtschaft leiden. „Viele werden im kommenden Jahr kaum ihre Energiekostenrechnungen zahlen können.“ Dafür brauche es jetzt Pläne und keine Entlastungsprogramme nach dem Gießkannenprinzip.
Charlotte M. findet es beispielsweise ungerecht, dass jetzt im September der Energiekostenzuschuss an alle Arbeitnehmer in Deutschland gezahlt wird. Rentner und Studenten bekommen den Zuschuss nicht. Und die, sagt sie, hätten manchmal kaum etwas zum Leben. „Die Unterstützung muss zielgerechter erfolgen, ich zum Beispiel brauche sie nicht“, sagt sie. „Ich bin auch dafür, dass Reiche gerade in diesen Zeiten einen höheren Beitrag leisten sollten. Nur so kann eine Gesellschaft funktionieren.“
An Zeiten wie heute war damals nicht zu denken, für mich war ein Krieg ganz weit weg. Da war der Mauerfall, Berlin baute sich neu auf, verfiel aber auch an manchen Ecken.
Es ist dunkel geworden auf der Terrasse, die Solarlampen leuchten. Beugt man sich über die Brüstung, sieht man den Fernsehturm am Alexanderplatz. Es ist ein friedlicher Abend. „Ich bin eigentlich ein Wessi, aber damals bewusst in den Ostteil der Stadt gezogen, mich hat der Aufbruch fasziniert, ich wollte am Puls der Zeit sein“, sagt sie. Bevor sie nach Mitte zog, lebte sie in einer Mietwohnung in Weißensee.