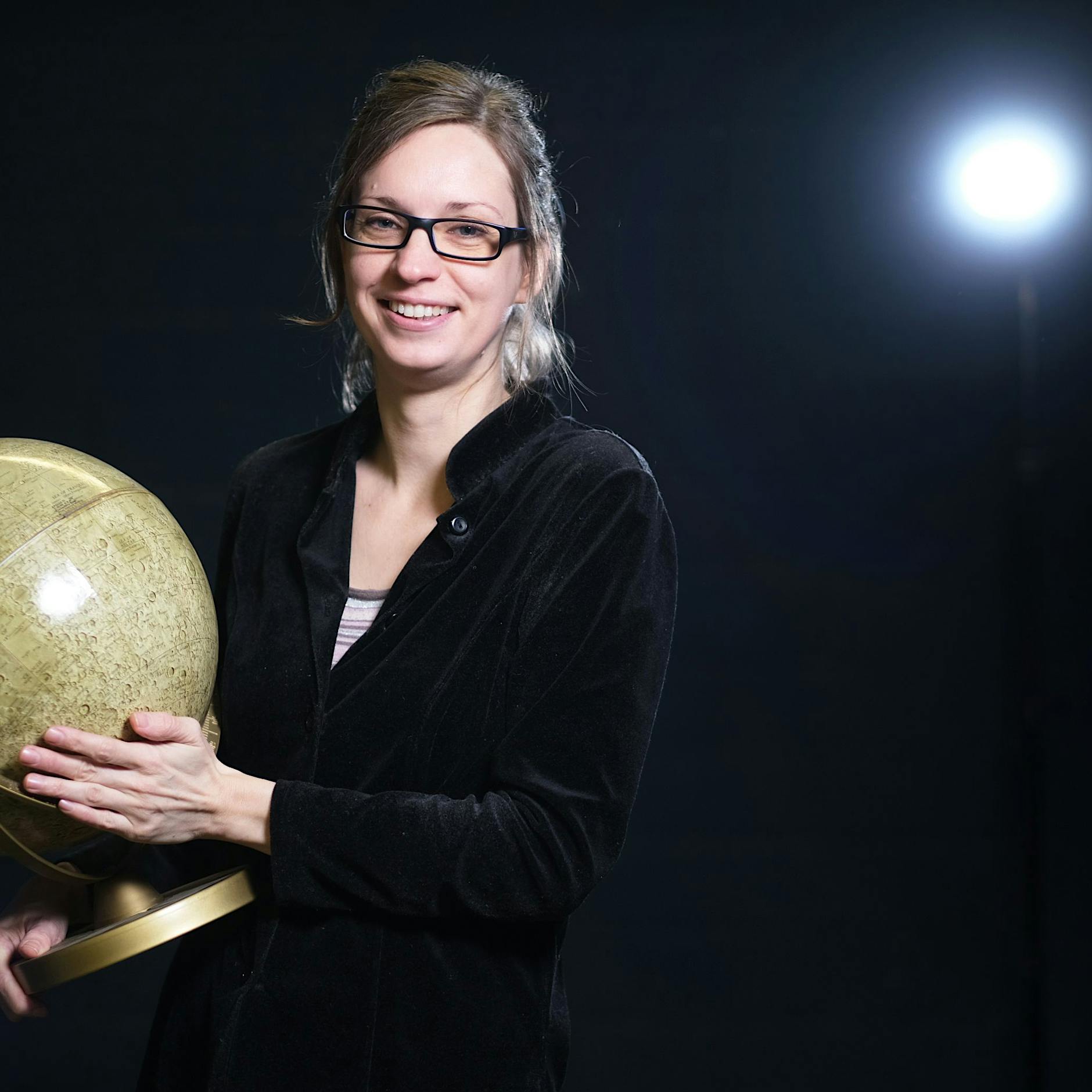Ein regnerischer Tag, Unter den Linden, Januar 2023 – doch ein Blick nach unten und plötzlich stehe ich in der Bernauer Straße an einem schwülen Sommertag, August 1961. Ich trage Soldatenstiefel und in der Hand eine Waffe, direkt neben mir ist die Grenze aus Stacheldraht und ich höre die Gedanken eines jungen Soldaten: Ist es besser, auf diese Seite der Grenze zu bleiben? Könnten seine Genossen ihn erschießen, wenn er sie überquert? Aber dann wagt es er – und ich sehe alles aus seiner Perspektive, wie er rennt und über den Stacheldraht springt. Oder springe ich selbst?
Es ist ein Bild, dass alle aus den ersten Tagen nach dem Mauerbau kennen – mehr als 60 Jahre später als Virtual-Reality-Erlebnis für eine neue Generation Berliner verwirklicht. Das VR-Erlebnis „Der Sprung“ ist ein Highlight, worauf Geschäftsführer Carsten Kollmeier besonders stolz ist. „Nur hier kann man so was machen“, sagt er. „Im ersten Museum Berlins über den Kalten Krieg.“
Als ich die VR-Brille abnehme, befinde ich mich wieder im Cold War Museum, das seit November 2022 an Unter den Linden steht – nur wenige Meter von den einstigen Schatten der Berliner Mauer entfernt. Überall hängen digitale Bildschirme mit Texten, Bilder und Videomaterial, die die Geschichte dieses weltübergreifenden Konflikts von der Berliner Blockade bis zum Mauerfall erzählen wollen.
Sicher wird der Kalte Krieg bereits in anderen Berliner Museen thematisiert – wie etwa in staatlichen Museen wie der Tränenplast, oder im Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Dem würde vielleicht eine Modernisierung gut tun, schlägt Kollmeier vorsichtig vor. Auch im Deutschen Spionagemuseum am Potsdamer Platz, hinter dessen Konzipierung er auch steckt, kann man über den Kalten Krieg lernen – allerdings nur als Teil der Geschichte der Spionage.

So, sagt Carsten Kollmeier, war er auf die Idee gekommen, ein Museum nur über den Konflikt zu eröffnen – in der ehemaligen „Hauptstadt des Kalten Krieges“. So nennt er Berlin gern. Mit diesem Projekt will er also einem neuen Ziel nachstreben – mit einer „hundertprozentigen“ digitalen Darstellung des Museumsinhalts ein generationsübergreifendes Erlebnis schaffen, das vor allem jungen Menschen den Weg ins Museum erleichtert. „Wir wollen“, sagt er, „dass auch Jugendliche sagen: Komm Opa, wir gehen am Wochenende ins Museum – statt unbedingt immer umgekehrt.“
Am Anfang liegt der Fokus des Museums vor allem auf der Geschichte des Kalten Krieges in Berlin – ansonsten beschäftigt sich die Ausstellung weitgehend mit den übergreifenden und internationalen Themen des Krieges. Erzählt wird die Geschichte des Kalten Krieges nach Themenbereich – von der Blockbildung nach dem Zweiten Weltkrieg über die Stellvertreterkriege in Korea und Vietnam bis zu der Angst um einen Atomkrieg.
Im zweiten Stock kann man gegen einen Partner oder eine Partnerin in einer Wingsuit-Simulation durch die Schweizerischen Alpen um die Wette fliegen. Es gehe hier um das „Wettkampfgefühl des Kalten Krieges“. Das macht Spaß, aber der Bezug zur Geschichte wird nicht ganz deutlich. Die VR-Brillen allerdings bieten ein wirklich interessantes Erlebnis. Es fühlt sich wirklich an, als wäre man dabei gewesen. Etwa, wie die Ost-Berliner Grenzsoldaten von West-Berliner beschimpft werden, oder wie ein Ost-Berliner Vater seine schwangere Tochter im Westen an der Grenze trifft. Sie bringt ihm seine Medikamente; er bedauert, dass er sein Enkelkind wohl nicht treffen können wird.
Eine originale Fernschreibmaschine aus den 70er-Jahren
Für einen Moment verstehe ich das Trauma der Trennung von Familie und Freunden durch den Bau der Mauer. „Genau so sollte dieser Teil der Ausstellung auf die Besucher wirken“, sagt Peter Ridder, leitender Kurator im Museum. Er nennt das den Aha-Effekt. „Wir wollen es den Besuchern ermöglichen, direkt in diese Welt einzutauchen, in der das Foto zustande kam und von der heute kein Spur mehr zu finden ist.“

Auf jedem Schirm gibt es einen Zeitstrahl, auf dem ich verschiedenen Ereignisse antippen und dazu Text, Archivbilder und Videomaterial anschauen kann. Durch Titelseiten von Zeitschriften wie Spiegel, Time oder der sowjetischen Ogonjok bekomme ich ein Gefühl für die Popkultur und den Zeitgeist aus historischen Momenten wie der Kubakrise oder Atomkatastrophe von Tschernobyl. Ziemlich praktisch – gerade für jüngere Besucher.
Auch bei den „echten“ Museumsexponaten werden wieder die digitalen Möglichkeiten des Museums genutzt: An jedem Schaukasten ist ein QR-Code zu finden, den man mit dem Handy einscannen und so auf Texte zu dem Exponat zugreifen kann. Dafür, wie viel Platz im Museum durch die großen Bildschirme gespart wird, gibt es von den Exponaten verhältnismäßig wenig zu finden. Aber die, die es gibt, haben es wirklich an sich, den Besucher zu beeindrucken: Unter anderem gibt es originale Selbstschussanlagen, die einmal an der innerdeutschen Grenze verwendet wurden, eine fast elf Meter lange sowjetische Flugabwehrrakete oder eine Fernschreibmaschine aus den 70er-Jahren, wie sie für die direkte Kommunikation zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus verwendet wurde.
Um dieses Angebot jedoch nutzen zu können, muss man ein Handy dabeihaben, sich am Empfang im Museumsinternet anmelden und die nötige Technikkenntnis haben. Und, wie Carsten Kollmeier rät, sollte man dabei auch einen möglichst vollen Akku und Kopfhörer dabei haben, damit man auch die Videointerviews mit Zeitzeugen hören kann. Vielleicht für Teenager selbstverständlich – eher nicht für die Generation, die den Kalten Krieg vom Anfang an miterlebte.

Am Ende steht die Friedensbewegung
Dass die Geschichte des Kalten Krieges im Museum Großteils durch Bilder und Videomaterial erzählt wird, sei wegen der „bildgewaltigen“ Art des Krieges ganz angemessen, findet Peter Ridder. „Das waren Bilder, deren Einfluss am Anfang des Informationszeitalters in die ganze Welt hinausging.“ Er redet zum Beispiel von den Bildern des breit lächelnden Juri Gagarin, der sowjetische Kosmonaut und erste Mann im Weltraum – oder auch von den brutalen Bildern aus dem Vietnamkrieg mit Kindern, die in einem amerikanischen Napalm-Angriff schreckliche Verbrennungen erlitten. „Ohne diese Bilder hätte es vielleicht keine Friedensbewegung gegeben“, so Ridder. Man wolle den Krieg auch nicht verharmlosen, sagt er.
Sein Argument ist überzeugend – doch bleiben manche Texte zu den Exponaten noch etwas oberflächlich; bei Titelseiten fehlt zum Teil eine Erklärung des geschichtlichen Hintergrunds. Carsten Kollmeier sagt, einige Bereiche des Museums seien noch ein „Work in Progress“. Aber das sei eben auch ein Vorteil des Bildschirmkonzepts: Man könne jederzeit die Information erweitern oder neue Themen hinzufügen.
Die Ausstellung endet mit Informationen über die Friedensbewegung – auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Dann ist, sozusagen, das Ende der Geschichte erreicht. Die unmittelbaren Folgen der deutschen Wiedervereinigung oder Themen wie die Dominanz Chinas oder der russische Angriffskrieg in der Ukraine werden nicht thematisiert. Das war eine bewusste Entscheidung des Museums, sagt Peter Ridder. Zwischen aktuellen Konflikten und dem Kalten Krieg gebe es ja Ähnlichkeiten. „Aber wir erzählen hier eine andere Geschichte.“