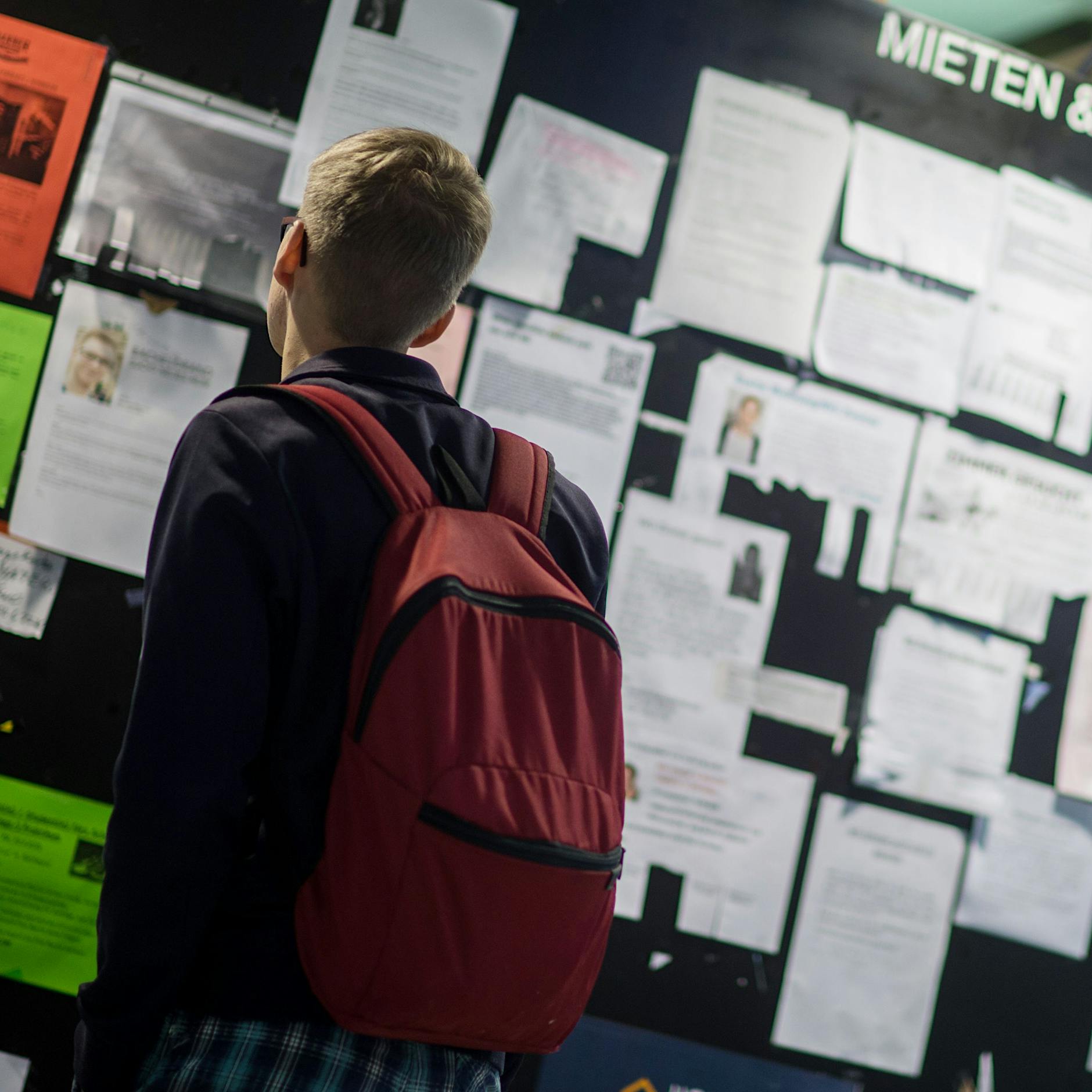Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
„Berliner Mietenwahnsinn“, las ich neulich in der Berliner Zeitung und musste zurückdenken an die Zeit, als ich 1994 mit 17 Jahren in die Stadt kam. Ich habe zweimal in der Woche eine lange Schicht im Tresor gemacht. Das hat gereicht zum Leben ohne Auto, Kind und größeren Schnickschnack. Ich konnte mir auch ohne Probleme eine Wohnungsrundreise leisten, die im Untergrund des Undergrounds begann.
Die erste Wohnung hatte sich mein damaliger Freund in der Alten Schönhauser in Mitte genommen, innen schwarz angestrichen, das Klo mit Bauschaum ausgesprüht und dann golden lackiert. Ein Schloss gab es nicht, auf dem Herd köchelte Tag und Nacht eine 100-jährige Suppe, das Dach war ein beliebter Ort zum Chillen, und Australier aus dem Umfeld von Nick Cave hatten sich dazugesellt. Niemand scherte sich darum, was wir da trieben.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Genauso „genommen“ hatte sich ein befreundeter südafrikanischer Architekt eine Wohnung schräg gegenüber, er stellte dort (lebende) Geschlechtsteile aus. Keine Anmeldung, kein Ordnungsamt, alles war möglich. Und all die Bürokratie und Anstrengungen, um einfach da zu sein – gab es nicht.
Ein paar Monate später war in der Alten Schönhauser Schluss und wir fanden unkompliziert Unterschlupf in einer WG in Prenzlauer Berg. Ein bürgerliches Haus und doch im Vergleich zu heute eine komplett andere Welt: keine verschlossene Haustür. Fahrräder stellte man hin, wo es einem passte oder wofür man noch fähig war. Alles nicht so schnieke wie heute.
Ich arbeitete inzwischen im Tresor als Lightjockey, während ich mein Abi machte und mit 17 eigentlich noch nicht einmal reingedurft hätte. Tanith & Ellen Alien am Sonntag mit meinem Licht – magisch. Für die ersten Stunden in der Schule schrieb ich mir selbst einen Entschuldigungszettel: Zum x-ten Mal behauptete ich, der Klempner würde kommen. Interessierte eh keinen, was da draufstand. Ich schaffte genau die 50 Prozent der Stunden, um nicht vom Gymnasium zu fliegen.

Eine Ausbildung hatte ich für meinen Job im Tresor nicht, wie auch für meine anderen Einsatzorte an der Bar, an der Kasse oder im Nachtmanagement. Es hieß einfach: „Du kannst morgen anfangen.“ – „Alles klar. Krieg ich schon hin.“ Die Haupttugenden wie pünktlich sein, die Nerven behalten und auch früh um 9 Uhr noch Knöpfchen drücken oder Geld zählen können, reichten aus. Der Rest ließ sich lernen. Geld verdienen für die Wohnung rangierte ganz weit unten auf der nicht vorhandenen To-do-Liste. Wir lebten ein wildes Leben ohne Datenschutzbestimmungen und Gendersternchen.
Niemals machte ich mir einen Kopf um meine Sicherheit
In Sachen Wohnung ging es für mich nach einem halben Jahr und einem Rausschmiss wegen einer Flohinvasion durch meine Katze weiter in die erste eigene Wohnung nach Friedrichshain. In einem heruntergekommenen Haus, aber mit dem schicksten, spiegelndsten Bad meines ganzen Lebens mit Waschmaschine und Trockner – sagenhaft. Friedrichshain hatte zu dieser Zeit noch voll den DDR-Arbeiterviertel-„Charme“. Nix mit Szenekiez. Weder Kneipen noch Bars noch Clubs. Das Potenzial der Leere starrte einen aus allen Ecken an. Ladengeschäfte ohne Ladeninhaber, kaputte Häuser ohne Investoren, Zonen, die niemandem gehörten und niemanden interessierten. Platz für uns. In welchem Stadtteil ich auch lebte, immer konnte ich tief in der Nacht durch die stillen Straßen spazieren. Niemals machte ich mir einen Kopf um meine Sicherheit.

Als Friedrichshain doch zu öde wurde, war ein Abenteuer dran. In den Zeitungsanzeigen fand ich eine riesige Wohnung in einem alten Industriebau auf der Insel Eiswerder zwischen Haselhorst und Spandau. Damit ging es zum ersten Mal in den alten Westteil. Die 120 Quadratmeter mit vier mal vier Meter großen Fenstern für 600 Mark konnten wir uns zu zweit locker leisten. Mein damaliger Freund und ich waren die einzigen Bewohner der Insel, auf der es neben einem riesigen Speichergebäude auch Filmstudios gab. Wir konnten in der Havel baden und draußen Badminton spielen. Nice.
Auf meiner Wohnungsrundreise folgten nach der Insel das nette, gesittete Friedenau, über dem noch der Flugverkehr nach Tempelhof zu erleben war, später Pankow. Dann blätterte ich während einer Fahrt – Ersatzverkehr mit dem Bus – durch drei verwaiste Seiten der Berliner Zeitung und las eine Wohnungsanzeige: Forsthaus zu vermieten. Das wollte ich doch schon immer, ich Stadtkind. Meine ganze Familie hatte in Städten gelebt, nicht mal eine Oma kannte ich auf dem Dorf.
Seit die Insel in der Havel mit Wasser, Licht, Grün und Weite mein Herz berührt hatte, hegte ich einen Wunsch nach dem Ländlichen. Das Stadtleben hatte ich nach neun Jahren satt. Langeweile und Alltagstrott hatten sich eingeschlichen. Zudem begann Berlin enger zu werden, die Hürden für vieles höher.

Konnte ich mir 1996 mit einem Notendurchschnitt von 1,8 noch die meisten Studiengänge aussuchen, war das um 2000 schon nicht mehr so. Zuzug veränderte die Lage, Menschen mit Kapital kauften sich ein, und die Behörden hatten sich langsam in jeden Winkel hineingearbeitet.
Mit meinem nächsten Freund machte ich mich 2003 auf in die Ostprignitz. Ein Landstrich zwischen Berlin und Hamburg – ein Downgrade von rund 4000 Einwohnern pro Quadratkilometer auf 40 Einwohner pro Quadratkilometer. Wir landeten in einem wunderschönen Acht-Häuser-Dorf an der Alten Jäglitz, zu dem ein romantischer LPG-Plattenweg führte. Wir waren die einzigen Bewerber und sagten sofort zu. Keiner meiner Freunde verstand, wie ich Berlin verlassen konnte. Wir wohnten nun fernab von allem, in der Freiheit der Wiesen und Wälder.
„Du hast es geschafft“, sagen plötzlich die Städter
Glücklicherweise hatten wir beide eine Arbeit, die wir von überall machen konnten: Drehbuchschreiben – für „Bernd das Brot“. Wir gehörten zu den frühen digitalen Nomaden. Die ersten Monate waren durchaus hart. Unser Umzug fiel in den grauen November. Und die Energie, die mich in der Stadt von außen mitnahm, musste ich jetzt in mir selber finden. Einmal in der Woche fuhr ich nach Berlin zum Aufladen. Irgendwann fand ich heraus, dass es gar nicht Berlin sein musste, sondern das Prinzip „rausgehen und nach einer Weile wieder reinkommen“. Das Berlin-Bedürfnis wurde schwächer und schwächer. Eines Tages vermisste ich nichts mehr. Ich war angekommen. Wenn auch noch nicht am richtigen Platz.
Nach weiteren Zwischenstationen kaufte ich für einen Apfel und ein Ei ein Haus in einem kleinen Dorf im Neißetal, in dem ich seit 2009 wohne.
Hier könnte die Geschichte enden. Doch plötzlich sahen auch meine Freunde die Sache anders: „Du hast es geschafft“, hörte ich sie anerkennend sagen. In der enger werdenden Stadt hatte sich ihr Blick geändert.

Gleichzeitig standen in der Oberlausitz viele Häuser leer und waren günstig zu haben. Der Strukturbruch der Wende hatte krasse Löcher gerissen. Eine ganze Generation zwischen 30 und 40 fehlte. Und ein Großteil der Abi-Jahrgänge verschwand noch immer Richtung Westen.
Das passt doch wie Schloss und Schlüssel zusammen, dachte ich. Ich wollte die Brücke sein, anderen aus der Stadt heraushelfen, und schrieb auf unserer Website: „Wir sind Raumpioniere und sind aus der Stadt aufs Land gezogen. Wer auch immer diesen Wunsch in sich spürt, der komme gern vorbei, wir teilen unsere Erfahrungen.“
Kurze Zeit später meldete sich der Berliner Drehbuchautor und Regisseur Jens Becker bei uns, und wir verbrachten zusammen mit ihm und seiner Frau einen wunderbaren Nachmittag in unserem Garten und vermittelten sie anschließend in unser Netzwerk weiter. Damit war klar: Das funktioniert. So gründeten Jan Hufenbach und ich das Projekt Raumpionierstation Oberlausitz.
Die drängendste Frage, die uns gestellt wird, ist: Werde ich da einsam sein? Wir schmunzeln und lassen es die Leute selbst erfahren: Einmal im Jahr laden wir zu unserer „Landebahn für Landlustige“ ein. Hier treffen sich Großstadtmüde mit Leuten, die schon angekommen sind, und können erleben: Da sind ja schon viele, da muss ich nicht meinen halben Kiez mitbringen.
Wir schauen jetzt aus der Ferne auf Berlin und leiden ein bisschen mit. Berlin ist verkauft, das wilde Leben dort vorbei. Abenteuer gibt es anderswo.
Arielle Kohlschmidt ist Kreative mit Lust auf gesellschaftliches Wirken und regionale Entwicklung und einem großen Herzen für Meditation und Kundalini-Yoga. Die nächste „Landebahn für Landlustige“ findet am 14. September 2024 in Mittelherwigsdorf im Zittauer Gebirge statt.