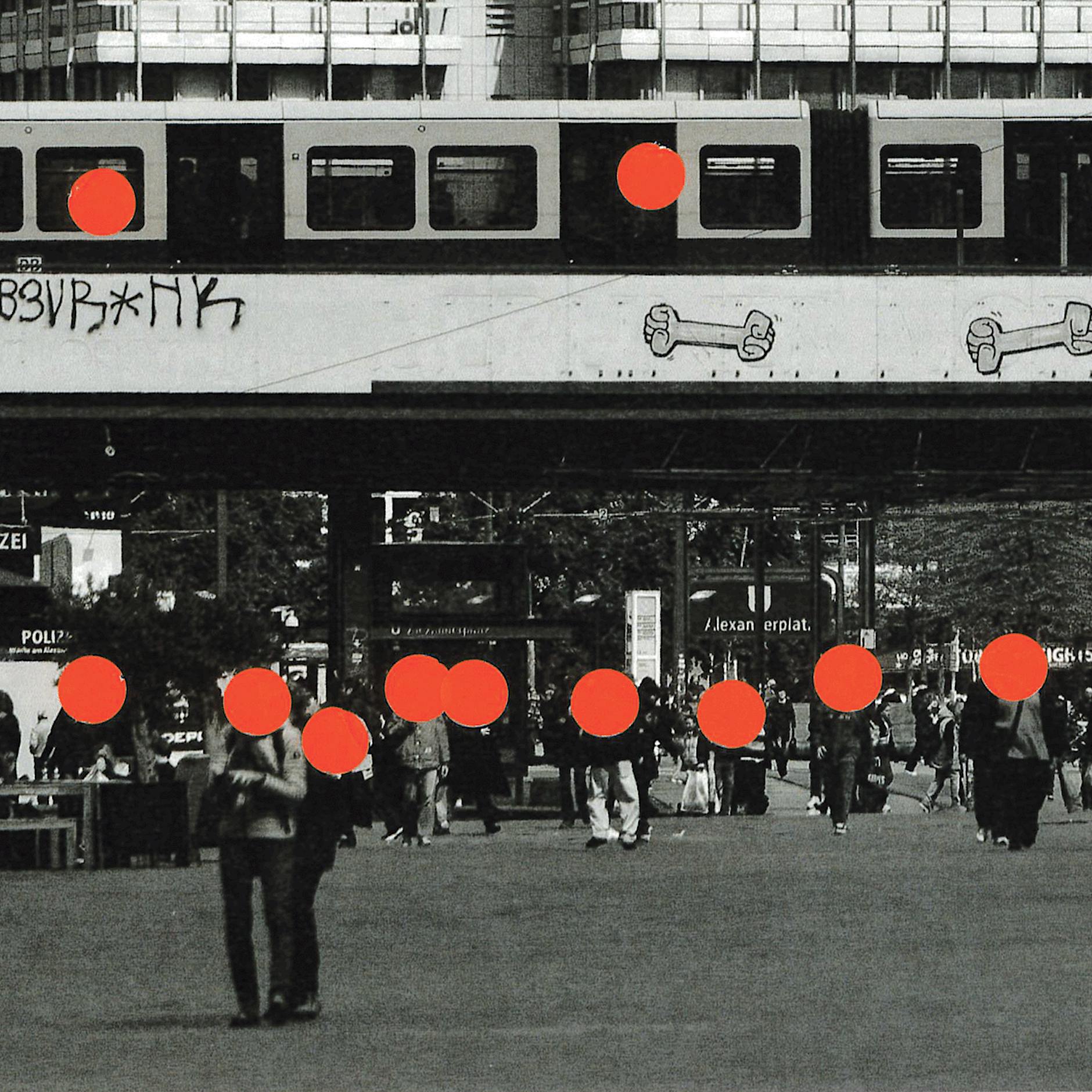Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
„Hab auf der Welt die schönsten Stunden doch nur im eignen Heim gefunden“, stickte einst die Großtante meiner Mutter auf einen Leinenbehang. Eine Kreuzsticharbeit, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts in Mode war. Haushalte aller Couleur schmückten sich mit solchen Überhängen, deren poetische, moralische oder religiöse Sprüche Wertvorstellungen zitierten, etwa von klar verteilten Geschlechterrollen.
Der Behang über dem Kinderbett meiner Mutter brannte ihr die Worte in umgekehrter Reihenfolge in den Kopf. So sagt die inzwischen 84-Jährige diesen Spruch bis heute rückwärts daher: „Gefunden Heim eignen im nur doch Stunden schönsten die Welt der auf hab.“
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Liegt in dieser Verkehrung ein Sinn? Wir werden sehen.
Kürzlich hat sich meine Mutter ein Gemälde über ihr Sideboard gehängt: ihr Elternhaus im Sujet der Landschaftsmalerei, voll Schönheit und Harmonie. Neugierig schaute die damals Sechsjährige über die Schulter des Künstlers, als dieser im Jahr 1946 mit feinen Pinselstrichen den Frühherbst um das Haus zauberte.
Das Verstörende: Es ist jenes Haus im thüringischen Bornhagen, das gut 70 Jahre später in die Schlagzeilen geriet, als das Zentrum für Politische Schönheit 2017 dort das Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden Europas nachbaute. Die umstrittene Aktion hatte ihren Grund in der Geisteshaltung des heutigen Hausherrn – Björn Höcke, AfD-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl.
Vor Jahren schon hatte die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) dieses Haus – das einstige Pfarrhaus des Ortes – verkauft. Es ist ein schönes Haus, in dem sich heute Abgründiges abspielt.
Allerdings hat auch schon meine Mutter in dem „trauten Heim“ nicht sehr viele schöne Stunden erlebt. Der Vater, Pfarrer Jobst Begrich, war fünf lange Jahre im Krieg und kam nur hin und wieder zu Besuch. Die Mutter war trotz der Hilfe von Genovefa, einer zugeteilten polnischen Zwangsarbeiterin, überfordert. Alle zwei Jahre etwa wurde ein weiteres Kind geboren. Kurz nach Beginn des Krieges zog die Tante, junge Witwe mit zwei Kindern, in die obere Etage ein. Am Ende des Krieges folgte eine weitere Tante mit drei Kindern, ausgebombt in Schlesien. Platz fand sich nur noch im Badezimmer.
Heller sind die Erinnerungen meiner Mutter an das Draußen, wie auf dem Bild über ihrem Sideboard. Im Gedächtnis geblieben sind ihr die Spiele in der dörflichen Natur, die Besuche bei der Nachbarschaft. Und das Beet, das ihr ein „Fräulein Braune“ anvertraut hatte, auf dem sie Gemüse und Blumen in aller Stille gedeihen sah.
Nach dem Krieg lag Bornhagen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Zonengrenze, wie sie das Ende des Krieges heraufbeschworen hatte. Eine Zeit, in der meine Großmutter Fluchtwilligen heimlich über die grüne Grenze des Eichsfeldes half: vom thüringischen Bornhagen ins hessische Werleshausen im amerikanischen Sektor. Im Winter lag diese Grenze im tiefen Schnee und weiße Laken tarnten die Flüchtigen.
Es war die Zeit, als ihr Mann, Pfarrer Jobst Begrich, zurück aus dem Krieg versuchte im Amt wieder Fuß zu fassen. Möglichst keinen Gedanken galt es zu verschwenden an das Davor: 1934 war er unter den 15 Theologiekandidaten, die der Reichskirchenleitung die Gefolgschaft verweigerten und vom Wittenberger Predigerseminar verbannt wurden.
Vier Jahre später war er einer von jenen jungen Pfarrern, die den Treueeid auf Hitler verweigert hatten. Er lebte in diesem Haus, im Pfarrhaus Bornhagen, in dem heute Björn Höcke wohnt. Zu entnehmen ist das den Akten des Evangelischen Konsistoriums der damaligen Kirchenprovinz Sachsen. Es ließ meinen renitenten Großvater bei der Anerkennung seiner Dienststellung monatelang zappeln. Im Frühjahr 1939 erhielt er dennoch seine Zulassung. Ein Jahr darauf wurde er zum Kriegsdienst eingezogen.
„Aktion Ungeziefer“
Doch auch die Nachkriegszeit hatte es in sich. Am Tag der Konfirmation von Ruth, der älteren Schwester meiner Mutter, brach im Pfarrhaus Unruhe aus. Angereiste Gäste hatten der Gegend umgehend den Rücken zu kehren. Der Grund dafür lag in der Verordnung der DDR-Regierung vom 26. Mai 1952 bezüglich der „Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen der DDR und den westlichen Besatzungszonen Deutschlands“. Angelegt wurde eine fünf Kilometer breite Sperrzone; Grundlage für den Ausbau der innerdeutschen Grenze.
Das war zugleich der Auftakt für die generalstabsmäßig geplante Zwangsaussiedlung jener Personen, die dem System nicht loyal genug erschienen. Zu den Unerwünschten, die unter dem Tarnnamen „Aktion Ungeziefer“ angehalten waren, die Grenzregion zu verlassen, gehörten auch die Begrichs. Nie mehr wurde dem Ehepaar ein Besuch des Ortes gestattet.
Keines der Kinder wurde zum Abitur zugelassen, Ruth gar 1958 mitsamt ihrer kirchlichen Ausbildungsstätte, dem Evangelischen Diakonieverein Zehlendorf, aus dem Stadtkrankenhaus Arnstadt verwiesen. Sie und ihre Mitschwestern blieben ein Leben lang in einer persönlich gestalteten Schwesternschaft, den sogenannten Kursgeschwistern, brieflich verbunden. Nachzulesen in den beiden Bänden „Bekenntnis und Aufbruch“ (2021).
Viel später erst begann mein Großvater über sein widerständiges Verhalten zu reden. Aus seinen Geschichten schöpfte ich Kraft, mich den politischen Massenorganisationen der DDR und später der Waffe zu verweigern. Ich wurde dann Bausoldat in Prora.
Dem einstigen Pfarrhaus sieht man die Schrecken zweier diktatorischer Systeme nicht an. Auch nicht, dass seine Bewohner teilweise Widerstand leisteten. Was sich heute dort abspielt, scheint die Geschichte auf seltsame Weise gleichzeitig zu wiederholen und zu verkehren. So, wie meine Mutter diesen fein gestickten Spruch dahersagt: „Gefunden Heim eignen im nur doch Stunden schönsten die Welt der auf hab.“
Stefan Stadtherr Wolter ist Historiker.