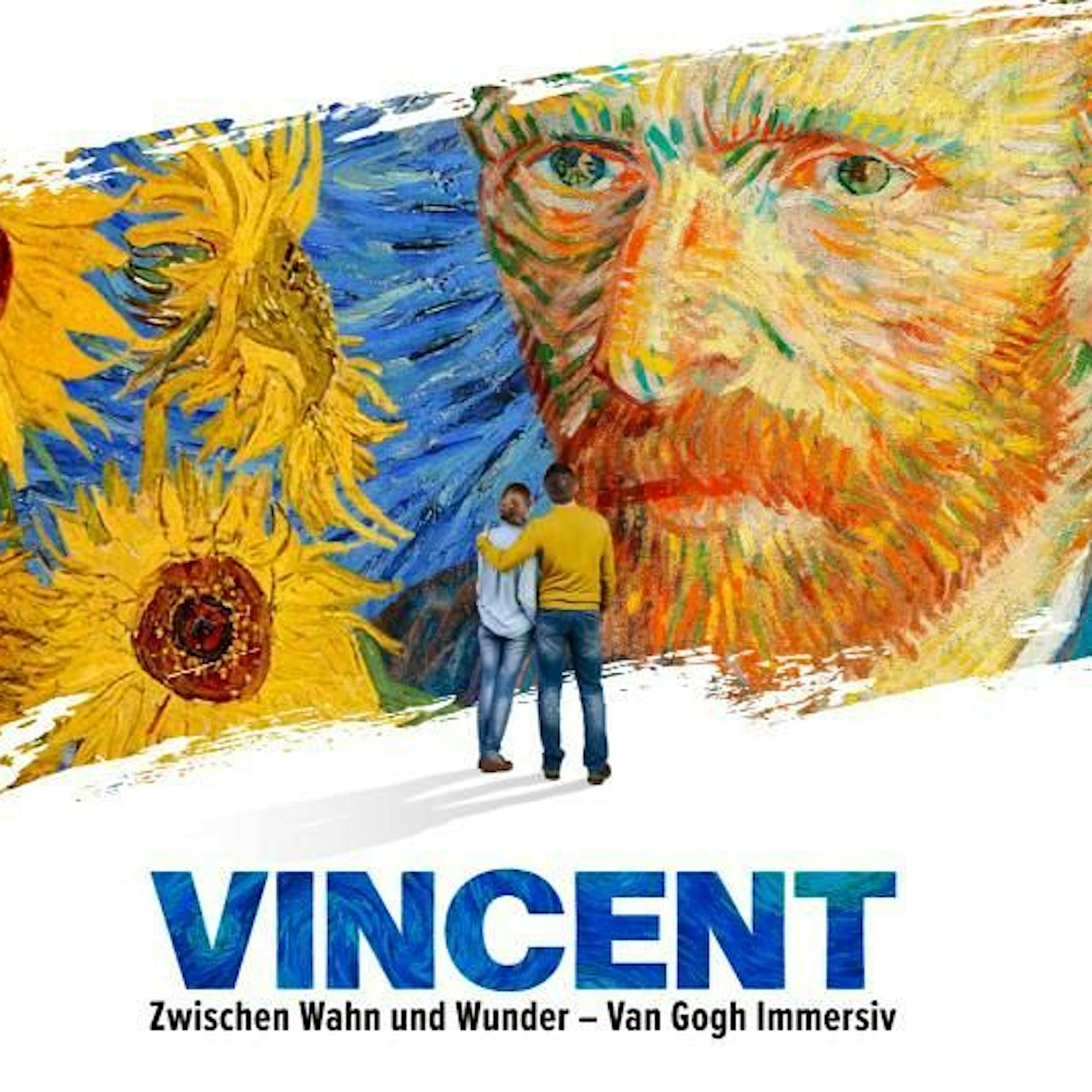Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Im Schloss Schönhausen ist die DDR-Geschichte nicht abgeräumt worden, sondern wieder auferstanden. Zu besichtigen sind Gästeappartements der Regierung und das Arbeitszimmer des ersten und einzigen Präsidenten Wilhelm Pieck. Es musste wieder eingerichtet werden, weil Erich Honecker das Mobiliar in den Siebzigerjahren für einen nie zustande gekommenen Staatsbesuch des Schahs von Persien auslagern ließ.
Das ehemalige Hohenzollern-Schloss im Pankower Ortsteil Niederschönhausen hatte dem Arbeiter- und Bauernstaat bis 1990 als Repräsentationskulisse gedient. Nach der Eröffnung des Schlosses als Museum im Jahr 2009 hielt ich dort einen Vortrag über Pieck. In der anschließenden Diskussion meldete sich ein älterer Herr zu Wort und konstatierte: Pieck sei „einseitig negativ“ dargestellt worden. Aber es sei ja auch „typisch für einen Westler“ (der ich nicht bin), „uns Ostdeutschen“ zu erklären, wie das in der DDR „wirklich war“. Er lasse sich jedoch das Bild vom „guten Menschen Pieck“ nicht kaputtmachen.
An dieses Erlebnis musste ich denken, als ich den Artikel anlässlich des 150. Geburtstages von Pieck in der Berliner Zeitung vom 3./4. Januar 2026 las. Darin wird Pieck als „das freundliche Gesicht der frühen DDR“ präsentiert – frei nach der Devise: Nicht Pieck, sondern Walter Ulbricht ist es gewesen.
Die Legende von „Papa Pieck“, die unmittelbar nach der Gründung der DDR in die sozialistische Welt gesetzt wurde, ist offenbar noch immer lebendig. Der Autor Frank Schumann erinnert an die Publikation „Darf ich Wilhelm zu dir sagen“, eines der „populärsten Kinderbücher der DDR“, in dem „erhellende wie amüsante Anekdoten von und über Pieck“ erzählt werden. Das Bild vom „gütigen Großvater“, das auch Brecht mit seinem Kinderlied „Willem hat ein Schloss“ aufgegriffen hat, propagierte vor allem die SED-Presse, in der Pieck als „Vertrauensmann des Volkes“ präsentiert wurde.
Mit Zeitungsartikeln wie „Genosse Pieck, was macht meine Rente?“ wurde die Bevölkerung aufgefordert, dem Präsidenten zu schreiben. Für Piecks Post wurde auf dem Schlossgelände eine Korrespondenzabteilung eingerichtet, welche die Eingaben bearbeiten und so den Präsidenten „popularisieren“ sollte. Dass die monatliche Anzahl der Briefe von circa 1000 auf nahezu 21.000 anstieg, führte man selbstkritisch auf die fehlende „Initiative und Beweglichkeit“ örtlicher Verwaltungsorgane sowie auf „das seelen- und herzlose Verhalten mancher Staatsfunktionäre“ zurück.
Die Furcht vor Wahlen
Die Mär vom guten Pieck wird von Schumann nun erweitert, indem er ihn mit seinem westdeutschen Pendant auf eine historische Stufe stellt. Wie Pieck sähe auch der erste Bundespräsident, Theodor Heuss, „wie ein gütiger Großvater“ aus. Beide seien „würdige Repräsentanten zweier Staaten“ gewesen, weil – so ein Argument – ihnen etwas entgegengebracht wurde, „was heutigen Politikern fremd ist: Zuneigung“. Kurzum: Heuss und Pieck seien „Glücksfälle für Nachkriegsdeutschland“.
Anzumerken gilt, dass die beiden Präsidenten nie zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen waren und sich auch sonst nicht viel zu sagen hatten. In ihrem einzigen Briefwechsel von 1951 sprachen sie sich zwar höflich an, standen sich aber letztlich unversöhnlich gegenüber. Obwohl sich die DDR-Führung jegliche Einmischung aus dem Westen verbeten hatte, rief Pieck Heuss dazu auf, er möge die Bundestagsabgeordneten auffordern, der Gründung einer Europäischen Verteidigungsbereitschaft nicht zuzustimmen. Heuss erklärte daraufhin, es gehöre nicht zu den Aufgaben des Bundespräsidenten, Einfluss auf die Entscheidungen des Parlaments zu nehmen. Außerdem sei Pieck kein legitimierter Präsident, weil Regierung und Abgeordnete nicht aus freien Wahlen hervorgegangen waren.
Pieck fürchtete Wahlen ebenso wie Ulbricht. Dass sie in einer pluralistischen Demokratie keine Chance auf eine Mehrheit hatten, war sowohl der KPD- als auch später der SED-Führung bewusst. Freie Wahlen – eine zentrale Forderung auf den Demonstrationen 1953 und 1989 – wurden in der DDR gezielt verhindert, weil sie das uneingeschränkte Machtmonopol der SED gefährdet hätten. Und für die Unterdrückung und Verfolgung der politischen Opposition war auch „das freundliche Gesicht der frühen DDR“ verantwortlich.
Ein Jahr nach der DDR-Gründung forderte Pieck, „die ständige Wachsamkeit der breiten Massen und aller Parteimitglieder zur Entlarvung der Schädlinge zu entwickeln sowie die Tätigkeit der Staatssicherheitsorgane zu verbessern“.

Selbst für die Kommunisten zu radikal
Pieck hat schon immer polarisiert. Während der deutschen Teilung wurde er von SED-Historikern „zu einem der hervorragendsten Führer der deutschen Arbeiterbewegung“ verklärt und als „Staatsmann neuen Typs“ bezeichnet. Die westliche Forschung charakterisierte ihn hingegen als „typischen Parteibeamten“, der sich durch kritiklose Gefolgschaftstreue gegenüber Stalin auszeichne. In der DDR hätte Pieck angeblich keine Rolle mehr gespielt und im Rahmen seines völlig unbedeutenden Amtes lediglich als Dekoration von Ulbrichts Macht gedient. Zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen hat Pieck allerdings selbst beigetragen. Fast ein ganzes Jahrhundert. Seine Politik ist eine Chronik permanenter Widersprüche.
Pieck ist einer der wenigen Politiker des 20. Jahrhunderts, die in allen Epochen – vom Kaiserreich über die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus bis zum Kalten Krieg – politische Ämter innehatten. So gehörte Pieck in der 1918/19 von ihm mitbegründeten KPD permanent zum Führungskern. Anfangs war er selbst den Kommunisten zu radikal.
Als Pieck 1921 als Generalsekretär vorgeschlagen wurde, sprach sich seine spätere Parteifreundin Clara Zetkin dagegen aus, weil Pieck „jeder politische Sinn“ fehle und er „so fanatisch eingestellt“ sei. Pieck wurde nicht Generalsekretär, blieb aber in der KPD-Führung. Während der heftigen innerparteilichen Konflikte in den 1920er-Jahren legte er sich fraktionell nicht fest, sondern erklärte 1924, Gruppierungen in der KPD zu bekämpfen und „die widerstrebenden Elemente zusammenzubringen“. Das sicherte ihm ein parteipolitisches Überleben.
Nachdem Parteichef Ernst Thälmann 1928 kurzzeitig sein Amt verloren hatte, weil er die Unterschlagung eines Hamburger Parteifreundes gedeckt hatte (Wittorf-Affäre), positionierte sich Pieck zunächst gegen Thälmann. Infolge eines Gespräches mit Stalin, der ihm erklärte, die KPD käme ohne Pieck aus, dieser aber nicht ohne die Partei, schwenkte er um.
Während er sich als Abgeordneter im Preußischen Landtag und im Reichstag für die Interessen der Arbeiterschaft einsetzte, trug er als Parteifunktionär mit seiner uneingeschränkten Loyalität gegenüber der Kommunistischen Internationale (Komintern) zur Stalinisierung der KPD bei. So stellte er einerseits die Sozialfaschismus-Doktrin nicht infrage, wonach die Sozialdemokratie ein Zwillingsbruder der Nationalsozialisten sei – und vertiefte so die Spaltung der Arbeiterparteien. Andererseits unterstützte er angesichts der drohenden Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1932 für kurze Zeit die von der Komintern angeordnete flexiblere Auslegung der „Einheitsfront“-Politik gegenüber der Sozialdemokratie, indem er über die Moskauer Vorgaben hinausgehend der SPD und dem Zentrum im Preußischen Landtag eine punktuelle Zusammenarbeit ohne Vorbedingungen anbot.
Piecks widersprüchliches Agieren setzte sich nach 1933 fort. Hautnah erlebte er im Moskauer Exil die Stalinschen Säuberungen mit, denen auch zahlreiche KPD-Funktionäre zum Opfer fielen. Da den Hinrichtungen häufig Parteiausschlüsse vorausgegangen waren, trägt Pieck, der im Herbst 1935 offiziell zum Interims-Vorsitzenden für den verhafteten Thälmann bestimmt worden war, die politische Verantwortung. Als der Aderlass deutscher Kommunisten jedoch immer größer wurde, setzte er sich zögerlich dann doch für einige verhaftete Parteigenossen ein.
Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sich Pieck in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) für eine Vereinigung von KPD und SPD. Im Gegensatz zu Ulbricht setzte er in den Verhandlungen mit den Sozialdemokraten auf Überzeugung und Konsens, war sich jedoch mit seinem Parteifreund darüber einig, dass den Kommunisten letztendlich die uneingeschränkte Führungsrolle zukommen sollte.
Bereits 1944 hatte Pieck im Moskauer Exil notiert: „Einheit ist die Frage der SPD – sie wird dadurch ausgeschaltet.“ Mithilfe der sowjetischen Besatzungsmacht erzwang die KPD in der SBZ die Vereinigung beider Parteien und entledigte sich so ihres wichtigsten politischen Konkurrenten. Auf dem Gründungsparteitag der SED im April 1946 wurden Pieck und der ostdeutsche SPD-Vorsitzende Otto Grotewohl zu formal gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Von da an sorgte Pieck zusammen mit Ulbricht dafür, dass in der SED die kommunistischen Führungskader ihre Vormachtstellung ausbauen konnten und der Partei in der SBZ das unangefochtene Macht- und Meinungsmonopol garantiert wurde.

In Ulbrichts Schatten
Die Wahl zum Präsidenten der DDR im Oktober 1949 stellte schließlich den Höhepunkt von Piecks politischer Karriere dar. Außenpolitisch waren Präsident und Regierung, bedingt durch die Abhängigkeit von der Sowjetunion, allerdings enge Grenzen gesetzt. Wie die Bundesrepublik erhob auch die DDR den Alleinvertretungsanspruch.
Pieck betonte in seiner Antrittsrede, die DDR-Regierung besitze die Legitimation, „für das ganze deutsche Volk zu sprechen“, und behauptete ein Jahr später, „die Bonner Marionettenregierung“ habe selbstverständlich „keinerlei diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern“. Tatsächlich war die DDR bis zur zweiten Hälfte der Sechzigerjahre international isoliert.
Aufgrund einer ersten schweren Erkrankung im Frühjahr 1953 war Pieck nicht mehr in der Lage, seine Amtsgeschäfte als Präsident und Parteivorsitzender in vollem Umfang auszuüben. Während der Ereignisse um den 17. Juni 1953 hielt er sich zu einer Kur in der Sowjetunion auf. Mit der Rückendeckung der sowjetischen Führung, die intern bereits 1947 eingeschätzt hatte, dass Pieck die politische Linie in der SED Grotewohl und Ulbricht überlassen habe, begann Ulbricht sukzessive, seine Machtstellung auszubauen.
Nach Piecks Tod 1960 wurde Ulbricht auch dessen Nachfolger auf staatlicher Ebene und konzentrierte bis zu seinem Sturz 1971 die gesamte politische Macht auf seine Person. Im Unterschied zu Pieck erreichte er in der Bevölkerung keine Popularität. Der Kult um „Papa Pieck“, den Ulbricht tolerierte, ließ – auch nach dem kurzzeitigen Tauwetter 1956 – keine kritische Aufarbeitung von Piecks Rolle in der KPD zu.
Ungeachtet dessen muss das Wirken Wilhelm Piecks differenziert beurteilt werden. Er ist weder das „freundliche Gesicht der DDR“ noch ein Funktionär von Stalins Gnaden. Er ist vielmehr ein personifiziertes Beispiel für die Ambivalenz der kommunistischen Bewegung in Deutschland im 20. Jahrhundert.
Robert Rauh, Historiker und Publizist, hat in Schloss Schönhausen die Dauerausstellung zur DDR-Geschichte kuratiert.
Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.
Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: