Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Am 8. März 2025 ging ich in Berlin mit einer Temperatur von fast 40 Grad Fieber ins Bett. Am nächsten Tag wachte ich unter einem durchnässten Laken auf und es roch furchtbar. Ich hatte schrecklichen Durst. Danach habe ich zwei Tage lang nichts gegessen, nur geschlafen und getrunken. In der dritten Nacht stürzte ich. Da beschloss ich, meinen Sohn anzurufen, der den ersten Flug von Paris nach Berlin nahm und hier, noch mitten in der Nacht, sofort eine Notärztin rief. Sie diagnostizierte etwas Schwerwiegenderes als eine Grippe. Fünfzehn Minuten später brachte uns der Krankenwagen in die Park-Klinik Weißensee.
Jeder, der schon einmal in einer Notaufnahme war, weiß, wie viel Angst das hervorruft. Das Leid, das sich in diesem riesigen Hangar in Weißensee bot, erinnerte an ein Feldlazarett. Man maß meine Temperatur und meinen Blutdruck, bis ein Krankenpfleger fragte, was ich vor meiner Erkrankung gegessen und gemacht hatte.
Bevor das Fieber kam, hatte ich in der Staatsbibliothek recherchiert und mich bereits unwohl gefühlt, weil ich ein Knie mit einem Gel behandelt hatte. Als ich in einem engen Raum der Bibliothek gearbeitet hatte, hatte mich der Geruch des Gels bedrückt. Noch am Abend hatte ich meine Schwester angerufen, die Ärztin ist. Sie bezweifelte eine Vergiftung durch das Gel. Da ich ein russisches Buch über einen Agenten des NKWD — der Vorgänger des Geheimdienstes KGB — gelesen hatte, meinte sie lachend, dass dieses vielleicht vergiftet war. Ich teilte dem Mann in der Park-Klinik, der mich abfragte, diese eher wackelige Vermutung mit.
Das Fieber sinkt auch im Krankenhaus nicht
Ich bat um ein Einzelzimmer. Es erschien mir so komfortabel, dass ich mir sagte, es ist besser, reich zu sein als arm, und ich hätte das nicht besser ausdrücken können. Der Preis für ein Einzelzimmer in dieser Privatklinik übersteigt bei weitem das, was in Frankreich verlangt wird. Ansonsten habe ich in der Klinik in Weißensee zwar einige unangenehme Erfahrungen gemacht, aber insgesamt war das Pflegepersonal anständig. Der Pfleger, der mir regelmäßig Blut abnahm und den ich Dracula nannte, weil er aus den Karpaten stammte, hatte sogar einen Sinn für Humor, der in dieser Welt guttat.

Fast zehn Tage lang dachten sie, dass mit mir „alles passieren könnte“, so sagte es der Oberarzt. Ich selbst dachte an nichts. Mein Kopf war wie benebelt, ich langweilte mich nicht, ich schlief. Da ich keine Schmerzen hatte, war mir die Schwere meines Zustands nicht bewusst. Obwohl ich kaum sprechen konnte, fantasierte ich laut meinem Sohn auf Russisch.
Ich erinnere mich auch, dass ich in Gedanken mein „Testament“ verfasste. Ich beschloss, einen Staat zu gründen, der weder Israel noch Palästina heißen sollte, säkular und demokratisch sein und eine Verfassung und ein Parlament haben sollte, das einen Rat als gemeinsames Organ akzeptieren würde, der die verschiedenen Religionen in diesem neuen Staat vertreten sollte. Das Rückkehrrecht sollte sowohl für die einst vertriebenen Palästinenser gelten als auch für alle Juden, die als solche bedroht wären. Dass ich auf Russisch fantasierte und dieses Testament verfasste, ist nicht verwunderlich: Ich bin von den beiden genannten Konflikten persönlich betroffen.
Ich war nicht die Einzige, die sich im Nebel befand. Die Ärzte der Klinik konnten sich nicht erklären, woher das Fieber kam. Obwohl ich mit Breitband-Antibiotika bombardiert wurde, hatte ich immer noch eine hohe Temperatur und war extrem geschwächt. Da alle Hypothesen in Betracht gezogen wurden, kam schließlich auch eine Vergiftung in Frage. Gibt es dafür nicht Beispiele in „Die Königin Margot“ oder „Der Name der Rose“? Natürlich neige ich nicht dazu, meinen Zeigefinger abzulecken, um die Seiten eines Bibliotheksbuches umzublättern, aber das Riechen an einem solchem Gift hätte ausreichen können.
Um ernst genommen zu werden, musste die Sache jedoch bei der Polizei gemeldet werden, erklärte der Oberarzt. Mein Sohn begab sich also zur Polizeiwache. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt in der Intensivstation der Privatklinik Weißensee, einer Art düsteren Tiefgarage.
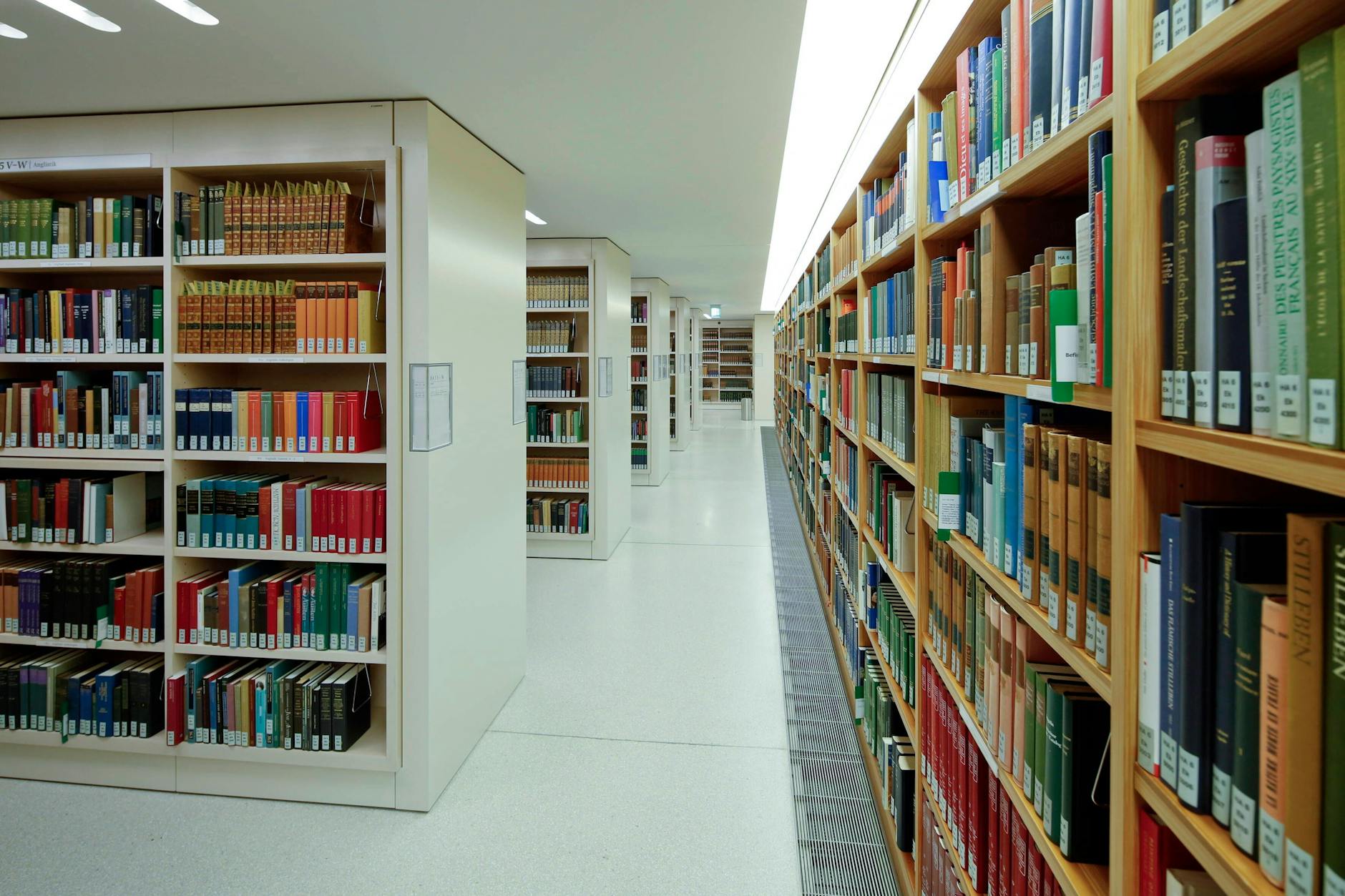
„Eine Reihe von Zufällen ist noch kein Beweis.“ Mit einem Satz, den ich selbst hätte sagen können, wurde ich mitten in der Nacht in dieser Berliner Klinik geweckt. In meinen Vorlesungen habe ich oft den Unterschied zwischen polizeilichen Ermittlungen und der Arbeit eines Historikers erklärt. Der Polizist sucht einen Schuldigen, der Historiker will wissen, was wirklich passiert ist — wie es eigentlich gewesen ist — und ich fügte hinzu, dass der Polizist in der Regel nicht an Zufälle glaubt.
Plötzlich stand ein Polizist vor mir
Doch nun stand ein Polizist vor mir. Er war mitten in der Nacht in die Intensivstation gebracht worden, um eine Patientin in sehr schlechtem Zustand um die Titel der Bücher zu bitten, die sie gelesen hatte! Ein Szenario wie aus einem Krimi! Der Polizist erklärte mir, dass angesichts dieser Reihe von Zufällen (Übelkeit, Konsultation eines in Russland umstrittenen Buches, hohes Fieber) zwar nicht unbedingt die Hypothese einer Vergiftung belegt sei. Aber es sei dennoch gerechtfertigt, das Buch zu untersuchen. Kurz gesagt, zwischen dem Fieber und der ansteckenden Angst vor den Russen fragte ich mich allmählich, ob ich bereit war, im Namen eines Fragments historischer Wahrheit mein Leben zu riskieren – bevor ich mich wieder fasste und mir klar wurde, dass ich für Putin sicherlich keine Bedrohung darstellte.
Wie zu erwarten war, fiel das Ergebnis, das später den Ärzten mitgeteilt wurde, negativ aus. Der französische Arzt, dem ich später die Geschichte erzählte, sagte mir, dass auch er, ohne daran zu glauben, geraten hätte, das Buch untersuchen zu lassen: Da man nach mehreren Wochen Krankenhausaufenthalt keine Erklärung für das antibiotikaresistente Fieber finden konnte, durfte man keinen Hinweis außer Acht lassen. Ich streckte tapfer meinen Arm für die unzähligen Blutabnahmen aus, doch die Kulturen zeigten weiterhin einen erhöhten Entzündungswert.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Da sich alle Bemühungen als vergeblich erwiesen, überwies mich die Klinik an das Universitätsklinikum Charité. Diese verfügte insbesondere über einen PET-Scanner, ein hochentwickeltes Gerät zur Krebserkennung, das die private Klinik mit ihren hohen Preisen (und ihren furchtbaren Betten) nicht hatte. Das spielte für die Ärzte sicherlich keine Rolle, aber jeder zusätzliche Tag in einem Einzelzimmer in der Park-Klinik Weißensee bedeutet einen nicht unerheblichen finanziellen Gewinn.
Auch wenn meine Erinnerung an den Transfer von einer Einrichtung zur anderen etwas lückenhaft ist, ist mir der Tag des PET-Scans noch gut in Erinnerung. Ich sollte um sechs Uhr morgens abgeholt werden. Ich wurde jeden Tag um diese Zeit durch das plötzliche Aufleuchten der Deckenlampe und ein donnerndes „Guten Morgen, Frau Combe!” geweckt. An diesem Tag hoben mich zwei Krankenträger in den Krankenwagen. Einer von ihnen roch stark nach einer Mischung aus Knoblauch und Zahnpasta.
Die Charité ließ mich all ihre modernen Geräte probieren
Wir fuhren quer durch Berlin. Meine Transporteure hatten entweder die falsche Adresse oder sie verfuhren sich. Zuletzt fuhren sie in einen Nebenbau des Krankenhauses, schoben mich in einen Flur und verließen mich, um sich zu erkundigen. Ich hatte Angst, dass sie mich vergessen würden. Das für die Untersuchung benötigte Produkt befand sich in Leipzig und musste abgeholt werden. Ich wurde wieder in einen verlassenen Flur geschoben und wieder der Angst überlassen, vergessen zu werden. Ich wartete vier Stunden in diesem Flur. Der PET-Scan ergab nichts.

Die Atmosphäre in der Charité war viel besser als in Weißensee, vor allem auf meiner Station. Die wurde von Krankenschwestern geleitet, die Vertrauen erweckten und gute Laune verbreiteten. Die Ärzte waren alle freundlich und sogar sympathisch. Ihre tägliche Visite durchbrach die Monotonie des Tages. Sie stellten einander abwechselnd meinen Fall vor. Einen Sonderfall. Schließlich fragte ich mich, wie lange das Krankenhaus mich noch hier behalten würde, um nach etwas zu suchen, das sie nicht finden konnten. Ich war zwar immer noch ans Bett gefesselt, gewann aber langsam wieder Kraft. Und obwohl ich noch nicht richtig laufen, geschweige denn lesen oder schreiben konnte, war ich nun in der Lage, zu sprechen.
Da die Charité mit den modernsten Geräten ausgestattet war, habe ich sie alle ausprobiert, mal unter örtlicher Betäubung, mal unter Vollnarkose, ganz zu schweigen von den zahlreichen Röntgenaufnahmen. Ich muss zugeben, dass die Charité keine Kosten scheute, aber ich machte mir Sorgen über die Auswirkungen von so vielen Narkosen auf mein Gedächtnis.
Ich musste unweigerlich an den Vortrag denken, den Christa Wolf 1984 in der DDR, in Magdeburg, vor psychosomatisch tätigen Gynäkologen gehalten hatte, und zu dem Dr. Paul Franke sie eingeladen hatte. „Je leistungsfähiger Ihre Instrumente sind, desto weiter entfernen Sie sich vom Körper und von der Psyche der Patienten“, hatte sie sinngemäß gesagt.
Wie der französische Arzt und Philosoph Georges Canguilhem plädierte auch die Schriftstellerin für eine „ Rückkehr zur Klinik “. Das sollte ich in Paris erleben, nachdem die Ärzte der Charité mich aus dem Krankenhaus entlassen haben, da mein Fieber endlich gesunken war. Sie hatten mir das Leben gerettet, aber die Ursache immer noch nicht gefunden und schienen aufrichtig frustriert zu sein.
Zurück in Paris stellen Ärzte viele Fragen: Ist es eine Brucellose?
Am Osterwochenende 2025 verließ ich die Charité und kehrte nach Paris zurück, wo ich auf die Abteilung für Allgemeinmedizin des Krankenhauses La Croix Saint-Simon eingewiesen wurde. Ich verstand, dass man dort letztendlich die ungeklärten Fälle, die „Cold Cases“ des Gesundheitswesens, behandelte. Hier arbeiten Internisten, die ihre Behandlung so praktizierten, wie es Georges Canguilhem empfahl, entsprechend den Wünschen, die Christa Wolf in ihrem Vortrag geäußert hatte.

Der erste Arzt, der zu mir kam, sagte, er werde mir eine Reihe von Fragen stellen. Nach seinen Fragebögen und einer gründlichen Untersuchung meines Körpers wurde die Hypothese einer Brucellose aufgestellt, eine Krankheit, die auf Käseverzehr zurückgeht. Der sicherste Hinweis war der Schweißgeruch, der meinen Körper überzog, der Geruch von „nassem Stroh”, verursacht durch das Fieber. Ich hatte zwar den Ärzten in Berlin nichts davon gesagt, aber sie hatten mir auch nur wenige Fragen gestellt. Und obwohl sie, wie ich bereits sagte, nicht zögerten, alle Geräte zu benutzen, kann ich mich wenig an eine körperliche Untersuchung erinnern.
Im Krankenhaus La Croix Saint-Simon „erlitt“ ich zwei, vielleicht drei separate Verhöre, immer gefolgt von einer körperlichen Untersuchung. Natürlich hatten die Ärzte alle Ergebnisse der Untersuchungen ihrer Kollegen aus der Charité, was ihnen viel Zeit sparte, aber wer weiß, ob ein Verhör und eine körperliche Untersuchung bei meiner Ankunft in der Notaufnahme – oder der Tag danach - in Berlin ihnen nicht zumindest einige davon erspart hätten? Aber übrigens, hört man in Deutschland so viel über diese Krankheit wie in Frankreich, dem Land des Käses?
Christa Wolf erwähnte ein Gespräch mit einem jüdischen Arzt, der kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 Deutschland verlassen hatte. Er hatte einst ihre Tante behandelt, von der in der Familie der Schriftstellerin gesagt wurde, sie sei depressiv gewesen. Er hatte Christa Wolf davon erzählt, wie man früher Medizin praktiziert habe, als man nicht so viele Instrumente zur Verfügung gehabt habe. Dieser Arzt erklärte, er habe den Patienten immer so lange reden lassen, bis er selbst einen Namen für seine Krankheit gefunden habe.
Es war nur so eine Redewendung. Man muss vor allem verstehen, dass es wichtig war, dem Patienten zuzuhören. Ich hätte übrigens selbst kaum Brucellose diagnostizieren können. Aber bis zum Beweis des Gegenteils halte ich mich daher, bestärkt durch den Rat des Arztes, den Christa Wolf getroffen hat, an diese Diagnose.
Sonia Combe ist Historikern, spezialisiert auf die osteuropäischen Gesellschaften unter dem Kommunismus. Sie ist assoziierte Forscherin am Centre Marc Bloch (Berlin, Humboldt-Universität) und befasst sich derzeit mit der Geschichtsschreibung des kommunistischen Experiments. Sie ist wieder genesen, isst aber nicht mehr so unbesorgt Käse.






