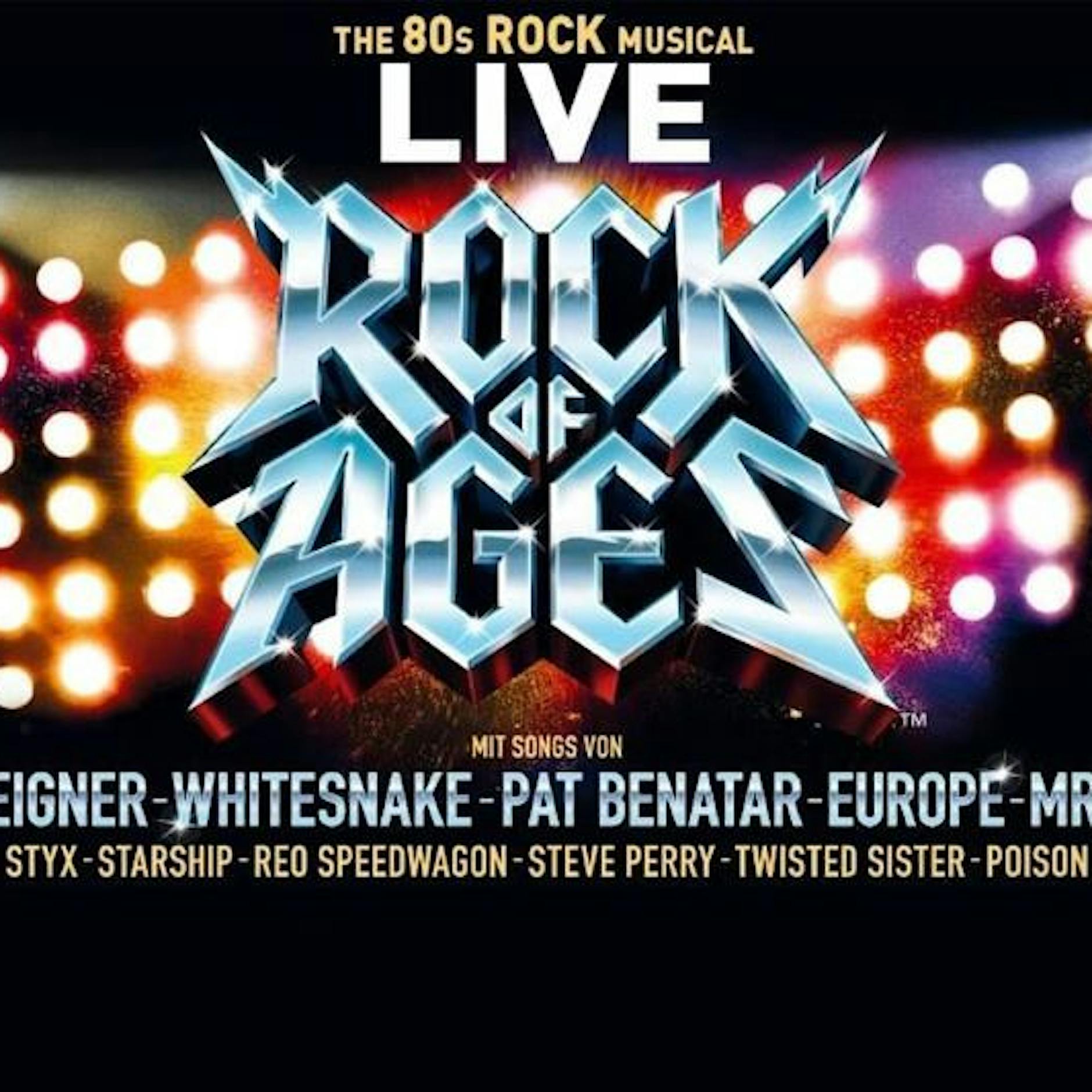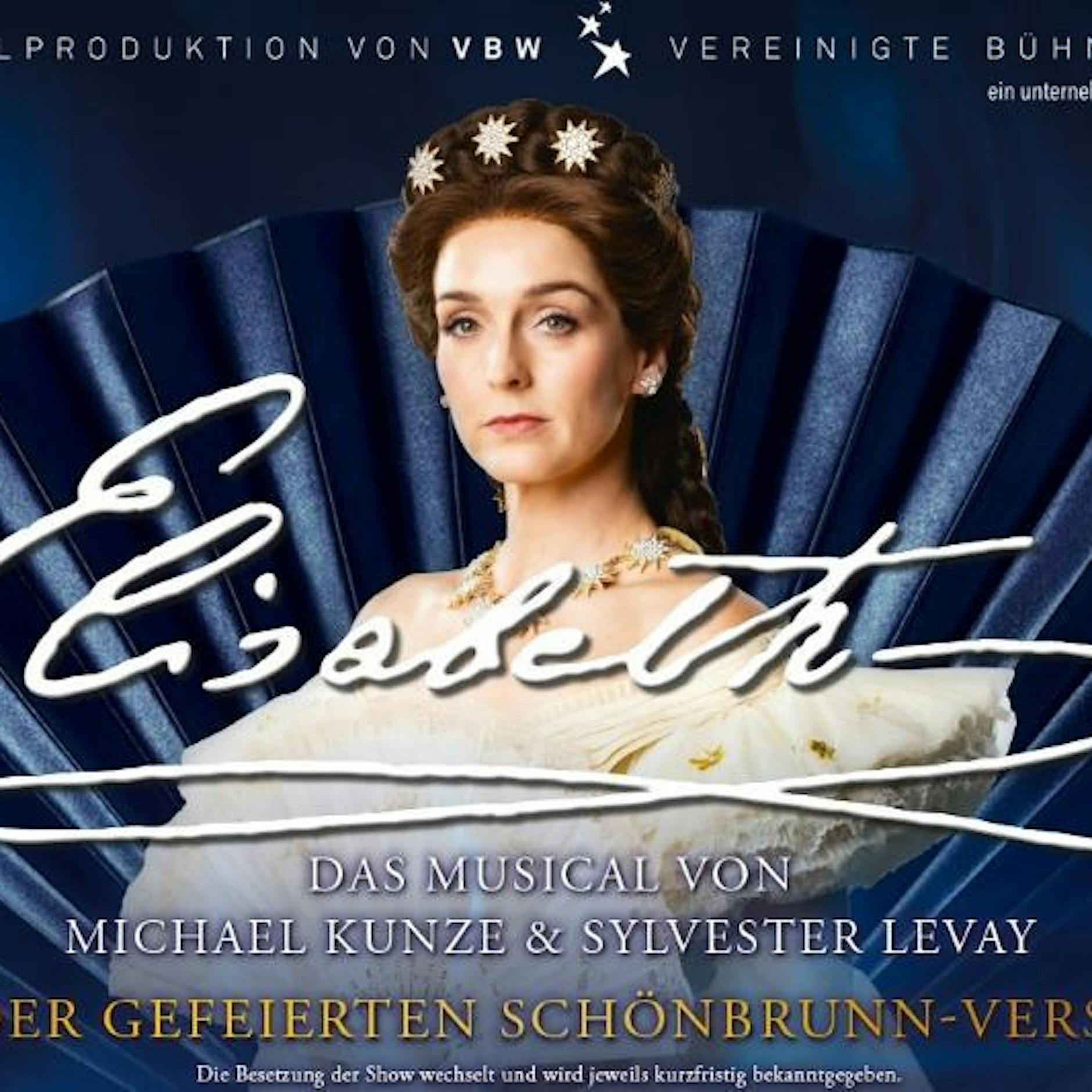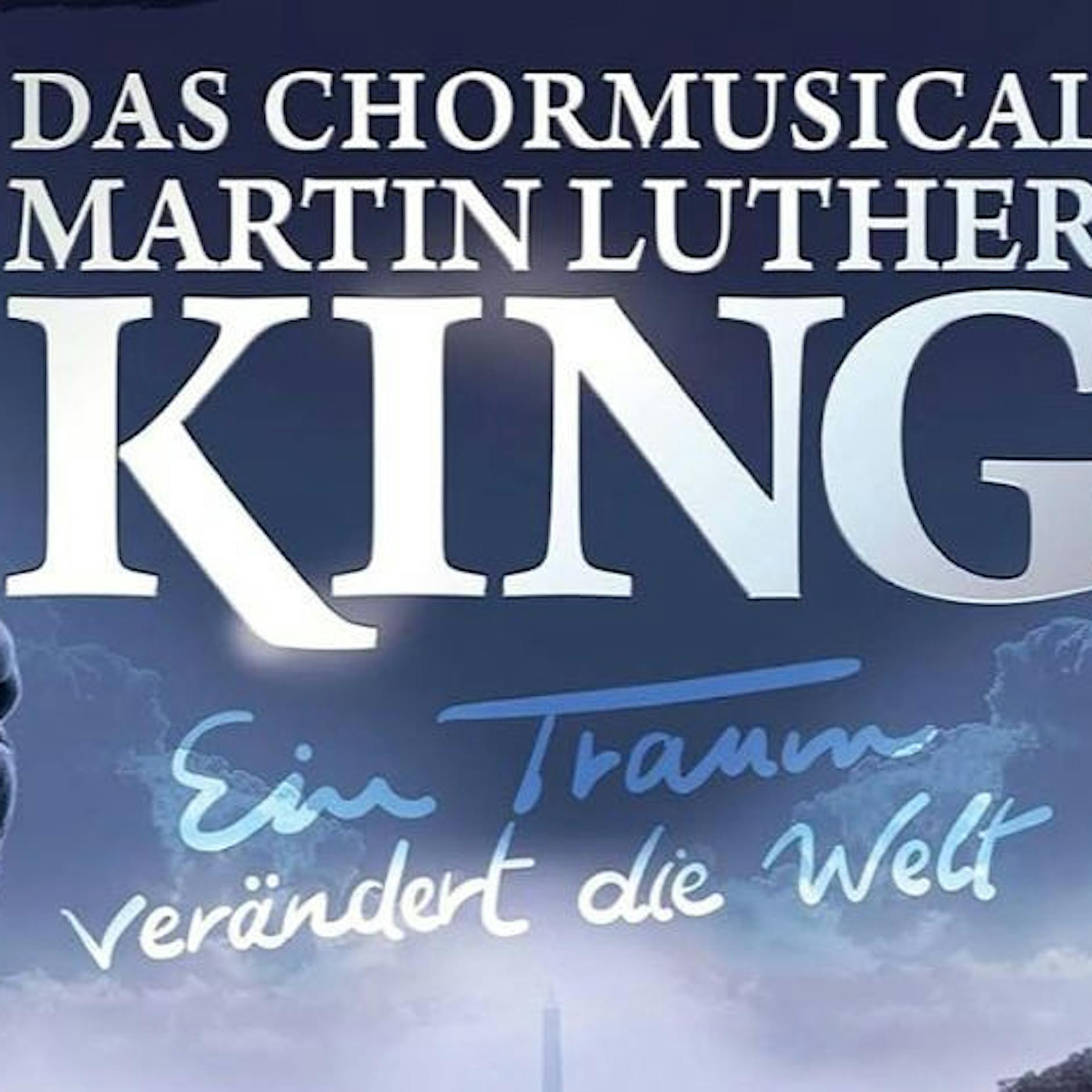Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Es heißt, neue Wohnungen müssten irgendwohin, aber überall fühlten sich Leute gestört. Gestört? Mindestens betrogen könnten sie sich fühlen. Nicht überall, denn wo Versäumnislücken gefüllt werden, ergibt sich bisweilen ein gutes Gefühl für die Menschen, fühlt sich ein Wohnviertel durchdacht und harmonisch an. Flächiges Auffüllen bestehender Komplexe vergangener Epochen anderer gesellschaftlicher Visionen jedoch stört das fühl- und sichtbare Gefüge.
Der Staat, der umfassend und langfristig geplante Wohnsiedlungen wie jene in Berlin-Hellersdorf auf Fertigteilbasis hat entstehen lassen, kann sein Versprechen heute nicht mehr verteidigen. Gegen Marktbegehren kann sich in unserem gesellschaftlichen Rahmen niemand wehren, und der Senat kann seine Bürger offenbar nicht schützen. Anwohnerproteste, auch von Bezirkspolitikern methodisch aufgegriffene, bleiben wirkungslos. Dieser Tage erzwingt sich die Schließung eines Tagebaues durch links-grün romantisierenden Nachwuchs des Bildungsbürgertums leichter als die Sicherung des elementarsten Bausteins menschlicher Daseinsfürsorge: dem adäquaten Wohnen.

Nachverdichtung passt nicht ins Konzept der Wohnkomplexe
Berliner aus bestandsgeschützten Gründerzeitkiezen mögen die Bedenken der Hellersdorfer belächeln, geht es doch lediglich um wenig pittoreskes Grün zwischen Wohnkomplexen, denen 1990 ohnehin eine Halbwertszeit von lediglich 20 Jahren vorausgesagt wurde. Das Zusammenspiel monoton erscheinender Wohnkomplexe mit lichten, grünen Innenhöfen und vorgelagertem Gelände ist eine Notwendigkeit der Fertigteilbauweise. Flächige Nachverdichtung wirkt entgegen der Logik solcher Siedlungen, denn diese sind durch die Abwechslung von Masse, Höhe und Lichte gekennzeichnet, nicht aber durch eine Staffelung niedriger Geschosse auf der Fläche.
Schonungslos wirkt auch die Gangart in Berlin-Mitte. Die aktuellen baulichen Aktivitäten rund um den Alexanderplatz verhöhnen nahezu die Bemühung der 60er-Jahre, eine gesellschaftliche Vision in Fläche, Raum und Volumen zu verewigen.
Nicht weniger rücksichts-, dafür heldenhaft selbstlos mutet hingegen die Handhabe einer Berliner Wohnungsgesellschaft unweit des Schlossparks Niederschönhausen an. Unter humanem Leitsatz wird der ohnehin bescheiden bemessene Innenhof eines Wohnkomplexes der 50er-Jahre um eine Unterkunft für Geflüchtete aufgefüllt. Kalkül dahinter ist der Nachweis von zwei Jahren Zwischennutzung als Voraussetzung für die Bebauung zu privaten Wohnzwecken, deren Genehmigung der Bezirk der Wohnungsgesellschaft vorab verweigerte.
Der Innenhof mit altem Baumbestand bietet die Möglichkeit nahe gelegener Erholung der mehrheitlich betagten Mieter außerhalb der minimal bemessenen Wohneinheiten. In der geplanten Unterkunft sollen auf etwa 25 mal 25 Meter wahrscheinlich 300 Menschen untergebracht werden. Den Gang in den nahen, lebhaften Schlosspark mit dem überschaubaren Angebot an sauberen, intakten Bänken werden die Mieter so leicht nicht bewältigen können, um der Geräuschkulisse zu entkommen.

Wer profitiert wirklich vom Allgemeinwohl?
Der Haltung der ehemaligen Bürgermeister Berlins entsprechend geschehe Nachverdichtung stets im Sinne des Allgemeinwohls. Wer die Allgemeinheit ausmacht, zu deren Wohle alles passiert, bleibt unklar und muss nicht unbedingt logisch beantwortet werden. Im Gegenteil, die Rolle der Allgemeinheit wird im Hergang von Enteignungen oder Vergesellschaftungen zugunsten oder auch zulasten von natürlichen Personen, dem Staat und privaten Unternehmen nicht eindeutig beschrieben.
Generell proklamiert die Politik allerorten „dringend benötigten Wohnraum“, während die plump anmutenden Talkrunden-Forderungen nach „Bauen, bauen, bauen“ noch unangenehm nachhallen. Dabei war es der Senat, der das Berlin der frühen 90er infolge ökonomischer und strategischer Zwänge kurzsichtig und servil den Interessen der Immobilienwirtschaft preisgab. Kommunales Eigentum wurde umfassend in hochpreisigen (meist un- oder selten genutzten) Wohnraum, Büro- und Gewerbefläche umgewandelt. Gerade vor dem Hintergrund des absehbaren Anstiegs des Bodenpreises als Folge der Nachverdichtung im hochpreisigen Segment wirkt die heutige Forderung nach bezahlbarem Wohnraum aberwitzig.
Fairerweise sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass neben der offiziellen auch die inoffizielle Immobilienwirtschaft für unbezahlbaren Wohnraum verantwortlich zeichnet. So erwirtschaften zig Jahre alte Mietverträge mittels mehrfacher Untervermietung oft das Mehrfache des einstigen und offiziellen Mietpreises. Derart findig und geschäftstüchtig ist man übrigens unabhängig der politischen oder gesellschaftlichen Überzeugung.
Um diese Schieflage auszugleichen, bedarf es offenbar einer neutralen, regulierenden Instanz, mit anderen Worten: mehr Staat. Doch der soll sich, so die öffentlichen Forderungen, immer weiter zurückziehen. Jener Rückzug schlösse dann zumindest den Kreis um den Zustand fehlenden Ausbaus logistischer, sozialer Infrastruktur und öffentlicher Daseinsvorsorge durch die Kommunen bzw. den Senat.

Auch die soziale Infrastruktur verkommt
Die Situation kommunaler Angebote zum Bürgerwohl umschreibt sich wie folgt: Im Rahmen einer Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik beklagen von 300 Kommunen 60 Prozent gravierende Mängel bei Sportstätten und Bädern. Würde nicht alsbald saniert, stehe 15 Prozent der öffentlichen Sportstätten eine unmittelbare Schließung bevor. Nachdem seit 1990 ohnehin ein Großteil öffentlicher Bäder und Sporthallen hat schließen müssen, mutet die Prognose freilich wenig erbauend an. Der Mangel tritt vorrangig in Ballungsgebieten strukturschwacher Regionen im Nordwesten und Nordosten der Republik auf.
Der von der Vernachlässigung sozialer Infrastruktur ausgehende Nierenhieb Richtung Gesellschaft trifft im Schwerpunkt Kinder prekären Milieus. In strukturschwachen Ballungsgebieten der BRD leiden bereits 40 Prozent der Kinder an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind.
So viel zum Nachwuchs, der allenthalben auf den Plan gebracht wird, wenn es darum geht, die Emotionen zu bemühen. Wie aber steht es um die Bedürfnisse betagter Menschen unserer Gesellschaft, jenen, die Wohlstand erarbeitet, Freiheit erstritten und Frieden gesichert haben? Auch sie würden sich über das Angebot kommunal betriebener Sportstätten mit fairen Eintrittspreisen freuen.
In der Gangart, integre Wohngebiete lediglich mit Wohnraum aufzufüllen, ohne logistische und soziale Bausteine sowie das menschliche Ansinnen nach Sichtachsen und Freifläche zu berücksichtigen, liegt die Verbindung zur Makroebene: dem Senat, der Landes-, vor allem aber der Bundesregierung.

Letztere rechtfertigt ihre Ignoranz gegenüber nationalen und regionalen Umständen soziokultureller Natur mit der Verpflichtung zum Humanismus. Verordnete Bevölkerungsverdichtung steht demnach über der Sicherung des geplanten und gelebten Standards. Etablierte und erarbeitete Lebensumstände der Bürger zu erhalten ist demnach inhuman, während planloses Wachsen der Ballungszentren grün-liberaler Logik nach human sei. In urbanen Strukturen mit einst liberaler Haltung gegenüber hoher Bevölkerungsdichte, wie etwa dem Ruhrgebiet, schwindet die Zustimmung gegenüber der einst akzeptierten Handhabe staatlich verordneter Nachverdichtung.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Spätestens wenn der demografische Zustand seinen Ausdruck in politisch unpopulärem Ansinnen ausdrückt, stellt sich die Frage nach der Akzeptanz des Allgemeinwohls erneut. Dann wird es heißen, die Bürger verstünden nicht, man müsse sie an die Hand nehmen, besser erklären, sie mitnehmen. Dass eine extreme oder auch gar keine politische Haltung nicht selten das Ergebnis eines sich verschlechternden Wohn- und Lebensumfelds ist, findet im politischen Diskurs kaum Beachtung.
Abschließend lässt sich feststellen: Wenn Nachverdichtung im Bestand funktionierende und eigens für die vorherrschenden Umstände geplante Gefüge stört, scheint das Allgemeinwohl politischer Ideologie hintanzustehen. Fehlen im Zuge der Nachverdichtung zudem Bausteine öffentlicher Daseinsfürsorge, resultiert das Gefühl von Bedrängnis, Unzufriedenheit, Verbitterung und daraus schlimmstenfalls eine extremistische Haltung – Entwicklungen, die mit politischer Weit- und Einsicht vermeidbar wären.
Jan-Sebastian Wetjen lebt seit 2008 in Berlin und arbeitet als Produktdesigner mit Fokus auf Möbel und Blech. Morgens liest er gerne Zeitung und schreibt abends seine Eindrücke vor sich hin. Er ist viel im Oderbruch unterwegs und mag Austausch mit und Eindrücke von Menschen.
Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.
Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.
Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: