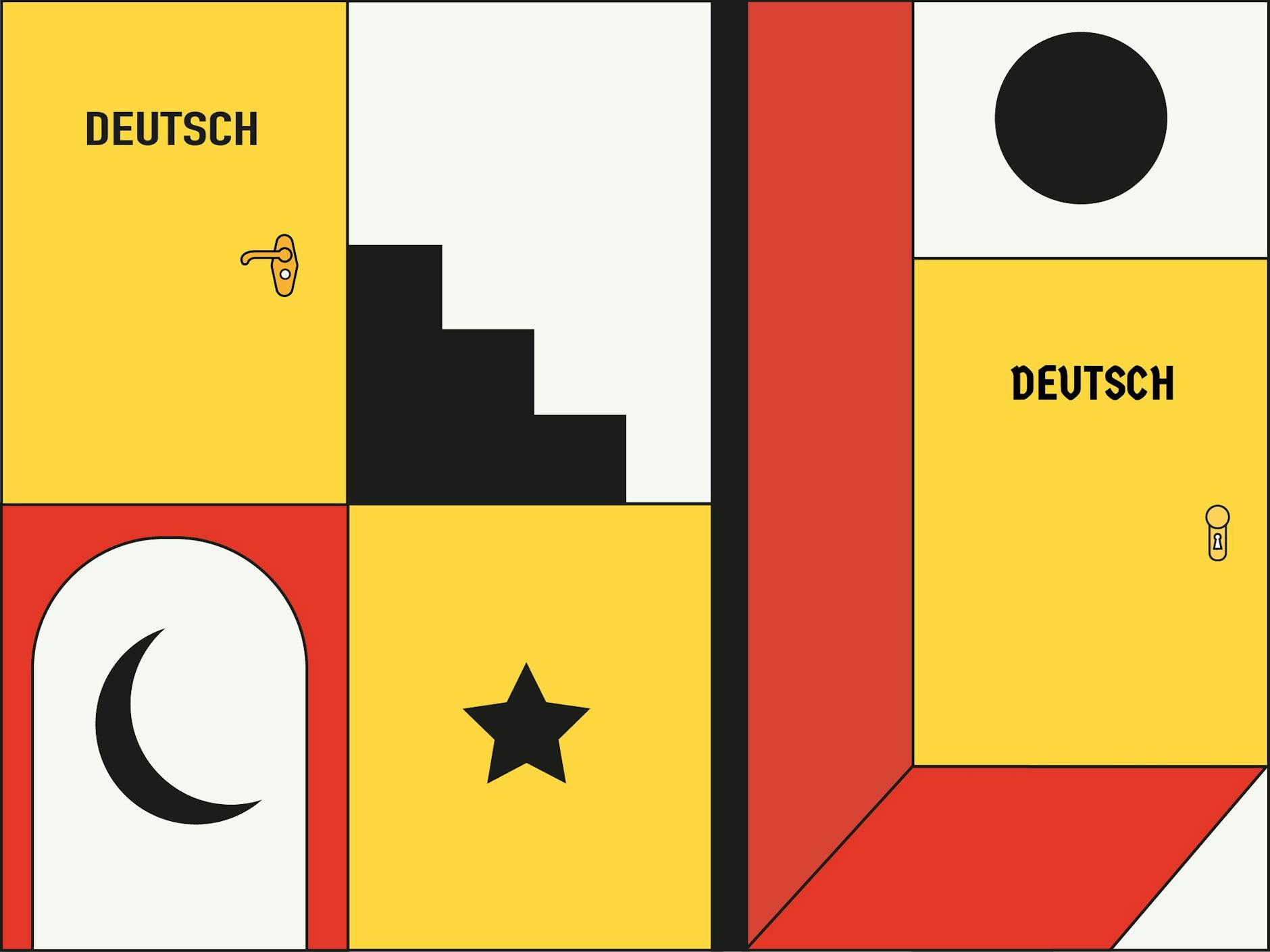Kaum zu ertragende Bilder jagen seit Wochen durch die Medien: Bilder Geflüchteter aus der Ukraine, Bilder von Nicht-Europäer:innen, die auf der Flucht über das Mittelmeer aus dem Wasser gerettet oder gar tot geborgen werden. Anstatt „echte“ gegen vermeintlich „unechte“ Geflüchtete auszuspielen, steht Europa heute erneut vor der Aufgabe, sich seinem historischen Erbe zu stellen.
Genau das hat Emine Sevgi Özdamar in „Ein von Schatten begrenzter Raum“ nun in Angriff genommen: einen Europa-Roman zu schreiben, der auf den Faschismus des 20. Jahrhunderts zurückblickt, um davon ausgehend auf die Frage zuzusteuern, welche Gegenwart und welches Zusammenleben heute vorstellbar sind.
Deutsch-jüdisch-türkische Geschichten
Es gibt nur wenige literarische Werke von nicht-jüdischen Autor:innen of Colour in Deutschland, die sich auf diese Weise mit dem Holocaust befassen. Einige Jahre nach dem Mauerfall und der Öffnung der Grenzen zwischen West- und Ostdeutschland erschien 1998 etwa Zafer Şenocaks Roman „Gefährliche Verwandtschaft“, in dem sich deutsch-jüdisch-türkische Geschichten verschränken. Im Prozess der Aufarbeitung werden dabei Berührungspunkte mit dem Genozid an Armenier:innen aufgedeckt. Im englischsprachigen Raum erlangte der Autor samt Werk einiges an Aufmerksamkeit. In Deutschland hingegen führen seine Texte weiterhin ein Schattendasein.
Aktuell fällt auf, dass der Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“, der jüngst auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, von der Literaturkritik zwar positiv rezipiert wird. Jedoch wird dabei meist genau jener Erzählstrang ignoriert, wo der Roman aus marginalisierter Perspektive an den Holocaust erinnert. Essenzielle Fragen tun sich hier auf: Wessen Erinnern schreibt sich ins kollektive Gedächtnis ein? Und: Welche Rolle und welcher Raum wird Geflüchteten, Eingewanderten und ihren Nachkommen im Prozess des kollektiven Erinnerns zugestanden?
Als „double-bind“ – als doppelte Erwartungshaltung – haben Michael Rothberg und Yasemin Yildiz die Paradoxie bezeichnet, die rassifizierte Menschen in Deutschland aushalten müssen: Auf der einen Seite wird von ihnen erwartet, dass sie am Erinnern an die Massenvernichtung jüdischer Menschen teilhaben, um somit als Deutsche zu gelten. Andererseits wird ihnen das Mitgestalten des kollektiven Erinnerns abgesprochen. Der Holocaust, so heißt es von Teilen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sei weder Teil ihrer Geschichte – noch die ihrer Väter.
Erinnern sollte aber nicht dem Prinzip des jus sanguinis, dem Abstammungsprinzip, gehorchen. Denn die Intervention marginalisierter Personen, deren Familiengeschichte nicht ins nationalsozialistische Deutschland zurückreicht – sprich, in ein hegemonial-weißes Erinnern –, hat das Potenzial, unsere Vorstellung von einem kollektiven hin zu einem globalen Gedächtnis zu erweitern. Als „undoing dominance“ hat die Soziologin Sabine Hark so einen Denkansatz bezeichnet, bei dem sich Machtverhältnisse aus intersektionaler Perspektive von den Rändern her neu definieren und beschreiben lassen.
Genau dieses Programm scheint mit Blick auf Özdamars Roman zu greifen. Was es bedeutet, „in Richtung Europa zu laufen“, ist die Frage, die sich die Erzählerin zu Beginn ihrer Flucht stellt. Eine vor dem Militärputsch 1971 aus der Türkei nach Deutschland geflüchtete Frau mit prekärem Aufenthaltsstatus ist darin die namenlose Ich-Erzählerin. Sie trägt autofiktionale Züge, schreibt über das Erinnern an die Schuld der Naziväter im Westberlin der 60er und 70er Jahre und weitet den Gedächtnisraum in einer Form aus, die das postkoloniale Europa – etwa Frankreich oder Belgien der 70er Jahre nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien – umfasst.
Gastarbeiter:innenmigration und Post-Holocaust Deutschland
Wie lebt es sich als nicht-weiße Geflüchtete im Deutschland der 70er Jahre? Die Geschichte der Flucht oder der sogenannten Gastarbeit, die auf den Holocaust und das Ende des Nazi-Regimes folgte, wird selten in diesem historischen Kontext gelesen. Es handelt sich um die Zeit, in der sich durch Anwerbeabkommen, Gastarbeiter:innen-Migration und die Ankunft Geflüchteter aus der Türkei, dem Iran, aus arabischen und anderen Ländern zum ersten Mal so etwas wie eine multiethnische Gesellschaft im westlichen Nachkriegsdeutschland herausbildete.
Doch welche Geschichten über Gastarbeit und Flucht in den 70er Jahren werden erzählbar und hörbar, wenn die Erinnerung der ersten Generation Eingewanderter und Geflüchteter an die Zeit nach dem dritten Reich Teil eines kollektiven Gedächtnisses wird? Oft handelt es sich um Erinnerungen, die viele Autor:innen der ersten Generation – etwa Aras Ören, Güney Dal, Aysel Özakın oder Doğan Akhanlı – nicht in deutscher Sprache aufzeichneten, weshalb sie auch kaum Beachtung erfuhren.
Hinzu kommt, dass im Nachkriegsdeutschland, wo sich eine Schuldgesellschaft gerade neu zu organisieren versuchte, „Gastarbeiter“ einfach undifferenziert zu einem Sammelbegriff für Menschen fremder Herkunft wurde, also vor allem für „Südländer“, die in den 60er und 70er Jahren in Deutschland eintrafen. Diese Bezeichnung kehrte nicht nur die Leistung hervor, die den Aufenthalt rechtfertigen sollte, sondern verwischte auch die diversen Fluchtgeschichten. Sogar die Autorin Özdamar selbst samt ihrem Werk wurde bisher als Akteurin in der Geschichte der Gastarbeit wahrgenommen – nicht der Flucht.
Westdeutschland erschwerte das Ankommen für viele Geflüchtete
Gerade für Geflüchtete bedeutete die Ankunft im damaligen Westdeutschland ein Leben zwischen einem Faschismus, der ihre Vertreibung aus ihren Herkunftsländern veranlasst hatte und einem Faschismus, der jedes wirkliche Ankommen verhinderte: „Ich habe mich vor türkischen Faschisten nach Europa gerettet, aber, wie man sagt, indem man mit einem Schiff immer nach Westen fährt, kommt man im Osten an“ – so blickt die Erzählerin auf ihre Flucht und Ankunft in Westdeutschland zurück.
Wenn in den Alltag von Vertriebenen und Eingewanderten im Post-Holocaust-Deutschland Nachrichten über Ausschreitungen des Militärs in der Türkei einfließen, so schreiben sich das Pogrom von Maraş oder die Ermordung von Kurd:innen, Alevit:innen und Oppositionellen, die faschistischen und nationalistischen Gesinnungen zum Opfer fallen, in das Leben der Geflüchteten sowie in den Alltag in Deutschland mit ein.
Immer wieder wird uns im Roman vor Augen geführt, inwieweit nicht abgeschlossene Prozesse des Erinnerns ihren Schatten auf die Gegenwart werfen. Etwa wenn Geflüchtete geschichtslos gemacht und ihre Vergangenheit, Vertreibung oder die Gründe hinter ihrer Verfolgung aus einem deutschen oder europäischen Archiv geräumt werden. „So werden sie versuchen, dir dein Gedächtnis auszulöschen, weil sie keines haben“, bekommt etwa die Protagonistin zu hören. Und nimmt demgegenüber mit ihrer Erzählung einen Raum für das Erinnern ein. Somit entsteht eine Collage-Technik, die zwischen Zeitebenen und Orten hin und her schaltet und das Erinnern dahingehend auffächert, dass etwa auch an Syrien, Ruanda, Srebrenica und den Irak oder an die Revolution im Iran erinnert wird.
Die rassistischen Morde des NSU oder in Hanau finden im Buch hingegen keine explizite Erwähnung. Dabei wären sie eine mögliche Fortschreibung eines Buchs über Europa, das für die Autorin kein fertiges, kein abgeschlossenes Ende bereitstellen kann. Denn „die Vernichtungsmaschine durfte so weiter machen, […] weil keiner sie zur Rede gestellt hatte.“
Eine neue deutsche Geschichte des Vergessens zwischen Ost und West
Am Streifzug durch die Geschichte des Nachkriegsdeutschlands der 70er Jahre zeichnet sich rückblickend der Wandel eines weißen Erinnerns ab. Erzählt wird diese Geschichte aus der Sicht einer geflüchteten Schauspielerin, die in Westberlin lebt und im Theater in Ostberlin ausgerechnet eine „stumme Rolle“ spielen darf. „Man hörte entweder die Stimmen der Schuldgefühle oder die Stimmen des Schweigens. Die Jüngeren waren die Stimmen der Schuldgefühle, die Älteren waren die Stimmen des Schweigens.“
Während also in Westberlin geschwiegen wird oder ein „Schuldgefühlchor“ ertönt, trotzt die Erzählung der Geflüchteten dem Ausschluss von Stimmen im Ensemble der Geschichtserinnernden sowie dem damit einhergehenden Geschichtsschwund. Die Erzählerin öffnet damit allerdings auch ein Archiv europäischer Geschichte. Die nicht-weiße Zugewanderte und Außenseiterin rekonstruiert die ihr zunächst unvertraute Geschichte. Sie dokumentiert Gespräche und Reflexionen von Theaterregisseuren, Schriftstellern und Intellektuellen, hinterfragt Räume und sucht nach Antworten auf Fragen über die Aneignung von jüdischem Besitz.
Sie unterbricht zudem auch das ritualisierte Erinnern der westdeutschen Gesellschaft, das die Schuld der Naziväter zu büßen versucht – und sich an einer Erinnerungspraxis festklammert, die ausschließlich die Vernichtungsmaschinerie und die Täter fokussiert und weniger die Geschichten der Opfer. Wohl kaum überraschend schreibt sich dies von einer Generation auf die nächste fort. Ereignisse werden verschwiegen, Geschichte wird teils sogar verfälscht. Auf das Schweigen und die Schuld kann nämlich nur – so eine jüdische Stimme im Buch – eine „neue deutsche Geschichte“ folgen: eine neue deutsche Geschichte des Vergessens.
Erinnerungskultur bei den europäischen Nachbarländern?
„Deutschland erholt sich nicht so schnell von Hitler“ – so lauten im Buch Fazit und Warnung vor einer wachsenden Gefahr faschistischer Gesinnungen und treiben die Geflüchtete erneut in die Ferne, diesmal in die französische Hauptstadt. Von dort aus wird der Blick vom Post-Holocaust Deutschland hin auf das Nachkriegseuropa erweitert.
Ohne einen historischen Exkurs auf die koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart in den europäischen Nachbarländern lässt sich die Frage nach der Zukunft einer europäischen Gemeinschaft, in der „einige ihre Toten leichter begraben dürfen als andere“, nicht vollständig beantworten.
Erholten sich die westeuropäischen Metropolen schneller von den Gräueltaten der Kolonialzeit? Der Kritik an der Schweige- oder der Schuldgesellschaft der 70er Jahre in Deutschland, die mehr die Täter als die Opfer zentrierte, soll nicht zwangsläufig ein Lob der Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit in den benachbarten europäischen Ländern bedeuten. Denn mit dieser Geschichte hadern die westeuropäischen Mächte, auch in den 70er Jahren, auf eigene Art. Die Krisenrhetorik etwa in Großbritannien, die vor einer „Gefahr von außen“ warnte, um den Austritt aus der EU herbeizuführen, oder die jüngste Wahlrhetorik in Frankreich, die dezidiert gegen „Fremde“ aufhetzte und eine „Festung Europa“ propagierte, stellt jedoch ebenfalls kein Modell für eine gelungene Vergangenheitsaufarbeitung bereit.
Özdamars Buch zeichnet zwar ein Bild von einem multiethnischen Paris der 70er Jahre. Es handelt sich jedoch um eine Gesellschaft, in der die aus den ehemaligen Kolonien stammenden Personen in eine eindeutige Rangordnung gedrängt werden. Klassistische Praktiken verstärken die bestehenden Hierarchien unter den Ethnien noch weiter. Wohl kaum zufällig gelten das silencing und die Unsichtbarkeit jenen Personengruppen aus den ehemaligen Kolonien, deren Präsenz die Erinnerung an die Gräueltaten in ihren eroberten Ländern auf Dauer wachzuhalten droht.
Ob Europa mit der eigenen Kolonialvergangenheit wirklich gründlich abrechnete? In Belgien, einer weiteren Station im Roman, wird in einem Café der Unabhängigkeit des Kongo und der Ermordung Lumumbas gedacht. Hier melden sich zwar europäische Exilant:innen und Außenseiter:innen, aber keine Betroffenen aus den ehemaligen Kolonien in Afrika zu Wort. Die Erzählerin von Özdamars Roman scheint hier an einigen Stellen nicht genügend Abstand von Praktiken der Exklusion zu nehmen. Und zwar nicht nur, weil die Erzählung geflüchtete europäische Intellektuelle gegen arabische Taxifahrer ausspielt. Sondern auch, weil rassistische Klischees gegen diese – oder gegen Schwarze Personen – unhinterfragt Erwähnung im Buch finden.
Europa ist, wo Lesbos beginnt
Das Denken der Gemeinschaft ist letztlich ein Denken ihrer Grenze. Egal aus welchem Blickwinkel man das Wesen der Gemeinschaft untersucht – Theorien und Praktiken der Vergemeinschaftung kreisen direkt oder indirekt um Grenzen sowie um Verfahren der Grenzziehung.
Viele Vorstellungen von Gemeinschaft sind bemüht, poröse Grenzen zu verriegeln, unterstützen Praktiken der Grenzziehung, Verfahren des Ein- und Ausschlusses. Sie drängen Personen als Außenseiter:innen eines Gemeinwesens an den Rand. Dem stellt Sabine Hark eine Gemeinschaft der Ungewählten gegenüber. Sie bezeichnet damit Formen der Zugehörigkeit, die sich durch Differenz auszeichnen.
Bezeichnenderweise spielen Prolog und Epilog von Özdamars Erinnerungsroman über die Geschichte des Faschismus in Europa auf einer türkischen Insel in der Ägäis, von der aus man auf Lesbos blicken kann. Von dort aus stellt sich die Geflüchtete die bereits erwähnte Frage, was es bedeutet, nach Europa zu laufen. Und sie erinnert sich. Auch an die Überquerung Jugoslawiens in den 70er Jahren, um zum Schluss noch einmal darauf zurückzukommen und so auch an den Genozid in Srebrenica zu erinnern.
Vor wenigen Wochen gedachte man des Beginns des serbischen Krieges gegen Bosnien und der Belagerung Sarajevos, während das Trauma der Kriegsverbrechen gegen muslimische Menschen in Srebrenica durch die Kriegsbilder in der Ukraine reaktiviert wird. „Das Schweigen über die Toten, die keine Gräber haben, erzeugt nur neue Gewalt.“ Das Erinnern steuert damit auf die bis ins Detail erzählte, wuchtvolle Szene am Ende des Buches zu, in der ein Schwarzer Mann tot aus dem Wasser geborgen, von einer Küstenwache zur nächsten weitergereicht wird und selbst als Leiche nirgendwo Aufnahme findet. „Ihr müsst den Toten nehmen“, ist der Satz, mit dem das Buch schließt. Er lässt die Leser:innen mit der drängenden Frage zurück, wo Europa letztlich seine Grenzen zieht.