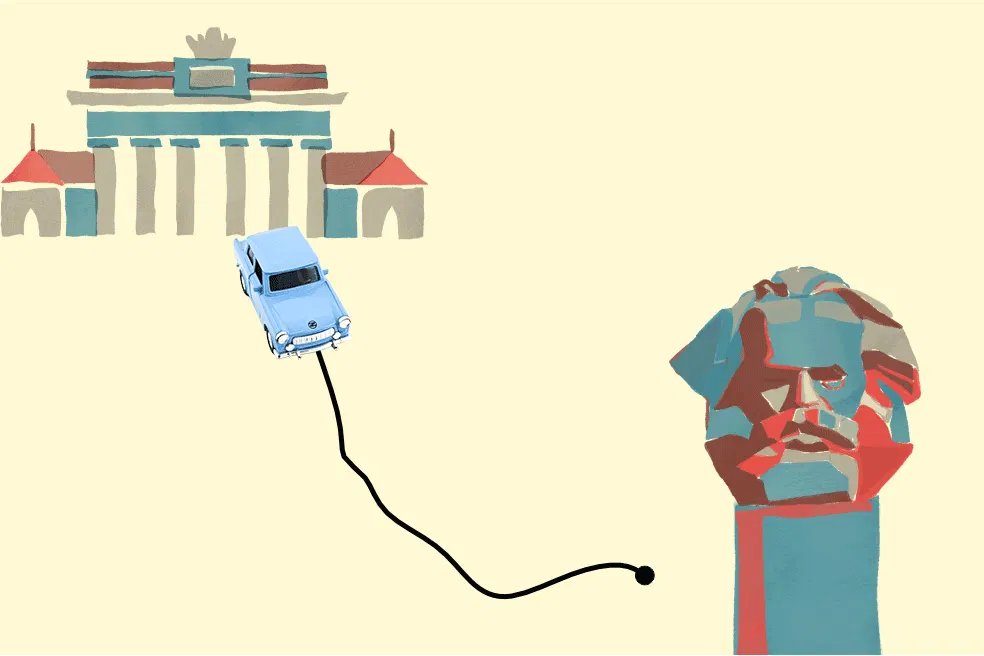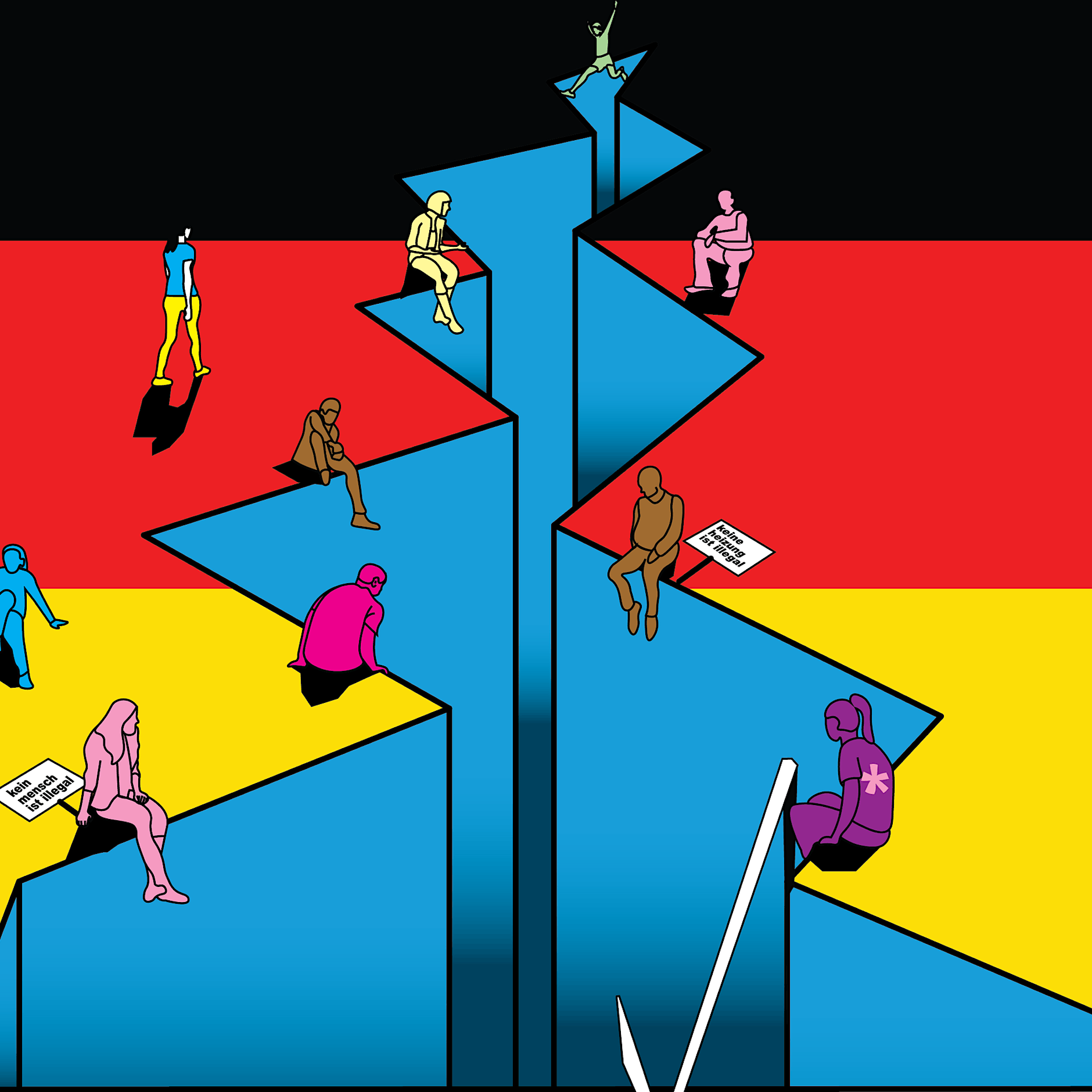Mit sieben Jahren zog ich gegen die Wehrmacht in den Kampf. Ich erinnere mich noch an die kargen Berglandschaften, die ich damals an diesen langen Nachmittagen im Schulhort malte. Zwischen den Gipfeln rollten Panzer durchs Tal, flogen Raketen, landeten Fallschirmspringer und in den Sprechblasen der bewaffneten Soldaten stand in wackeligen Erstklässlerbuchstaben: „Do Broni! Huraa! Atak!“ Zu den Waffen! Hurra! Angriff!
Ich war die polnische Armee, wir waren Befreier, die Guten. Und die bösen Hakenkreuzfahnen schwingenden Besatzerdeutschen mussten sterben. Keine Ahnung, woher ich das hatte. Aus der Serie „Vier Panzersoldaten und ein Hund“ vielleicht. Jedenfalls war es Sommer 1988, und bald sollten wir aus Niederschlesien in die Pfalz spätaussiedeln.
So böse waren diese Deutschen dann doch nicht. Die allermeisten trugen ja auch keine Hakenkreuzfahnen. Rasch eignete ich mir ihre landestypische Leitkultur an, malte keine Soldaten mehr, sondern Autos, spielte Fußball und nicht Krieg. Und wie alle anderen wollte auch ich nicht mit Chokri sprechen, einem Jungen aus Tunesien, der uns eines Tages als neuer Mitschüler vorgestellt worden war. Ich hatte die Außenseiterrolle an ihn abgegeben.
Als ich neulich, über dreißig Jahre später, mal wieder in der Pfalz war, musste ich an Chokri denken. Warum er wohl nach Deutschland gekommen war? Was aus ihm geworden ist nach der vierten Klasse? Ob er sich erinnert, wie gemein wir damals zu ihm waren? Und während ich so beschämt darüber nachdachte, fiel mir ein mit lila Farbe gespraytes Wort auf einem Spielplatz auf: „Adolf“. Und darüber, schon halb überschmiert, aber immer noch gut erkennbar: ein Hakenkreuz. Waren das Kinder?
Seit einem Jahr wohne ich in Chemnitz, und Hakenkreuze im Stadtbild sind keine Seltenheit. Sie werden an Hausfassaden oder Brückenpfeiler geschmiert oder in die Fensterscheiben von Bussen und Trams geritzt. Mal sind es zu einem Hakenkreuz formierte Bauzäune, die als Meldung in der Lokalpresse landen. Mal soll ein Bauarbeiter ein Hakenkreuz an ein Kitagebäude geklebt haben. Mal besteht das Hakenkreuz aus Speiseeis oder Tetra Paks, und im Winter sieht man Hakenkreuze auf Schwibbogen oder in den Schnee gestampft. Drei mal drei Meter groß war es auf einem Parkdeck vor vier Jahren. Die Antihakenkreuzaktivistin Irmela Mensah-Schramm hätte in Chemnitz viel zu tun.
Die größte Aufregung um ein Hakenkreuz gab es im vergangenen Januar, als Tom Roding vor Gericht stand und mit ihm Die Partei. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte Roding, dem sächsischen Landesvorsitzenden der Satirepartei, das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen vorgeworfen, nachdem auf einer Parkbank in Lugau ein Parteisticker entdeckt worden war. „So geht sächsisch“, stand da drauf und: „Ein Volk zieht’s durch.“ Dazwischen ein Hakenkreuz aus weißem Pulver, das Berliner als Kokain identifizieren würden, Sachsen als Crystal Meth. Vor ein paar Wochen wurde das Verfahren endgültig eingestellt.
Dass Gerichte keinen Spaß verstehen, wenn es um Hakenkreuze geht, ist natürlich richtig. Dass sie Satire nicht erkennen, eher seltsam. Genauso, dass sich strafbar macht, wer rechte Schmierereien überschmiert. Mal schauen, wie lange es dauert, bis das Hakenkreuz verschwindet, das ich gerade auf einer Parkbank entdeckt habe. Am besten, ich ziehe noch einmal selbst in den Kampf.