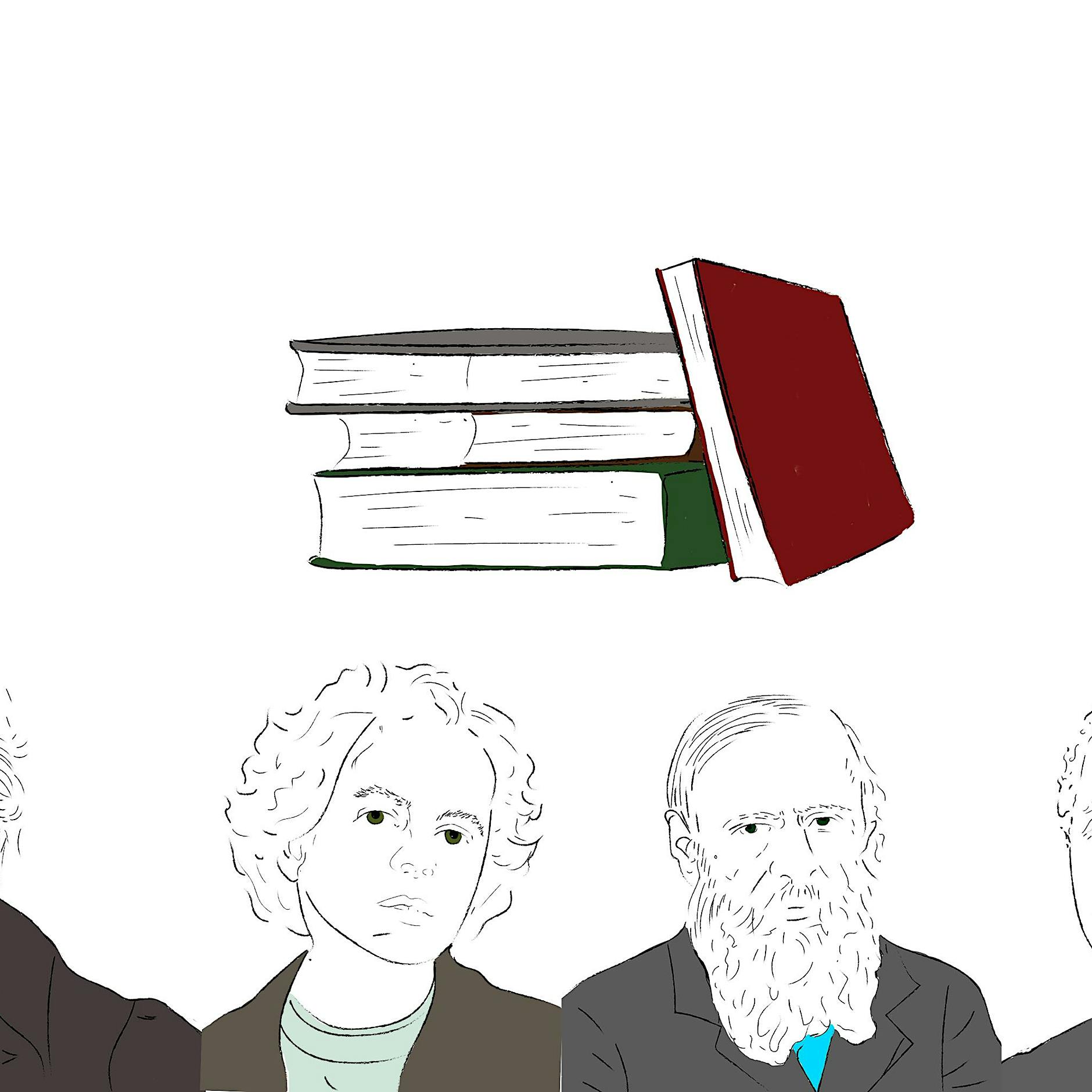Kornblumenblaue Dielen in Berlin
Hinterhof, Hochparterre, schwer vermietbar, Blick in wilde Sträucher. Eineinhalb Zimmer, Innentoilette – mehr konnte man nicht verlangen, Judy und Henri waren glücklich mit ihrer ersten Wohnung. Sie besorgten sich eine gebrauchte Liege, die sie Sumpfgondel nannten, weil sich in ihrer Mitte eine tiefe Kuhle abzeichnete, die davon zeugte, dass auf dieser Liege schon vor ihnen gelebt und geliebt worden war.
Die kornblumenblauen Dielen waren das Beste. Aus ihnen leuchtete der lichte Traum von einer eigenen Wohnung, die anders aussehen sollte, als Wohnungen derzeit aussahen: braune Möbel, braune Fußböden, braune Fransenlampen, düstere Gemütlichkeit. Auch anders als die lächerlich modernistische Wohnung der Eltern.
Das Bücherregal – es existiert noch heute – ließen sie von einem gelernten Tischler bauen, die Speisekammer nutzten sie als Badezimmer. Zum Waschen diente eine schwere alte Schüssel aus geblümtem englischem Porzellan und eine dazugehörige Wasserkanne.
Wollt ihr mir das Ensemble nicht verkaufen?, fragte der Freund, der genauso leidenschaftlich als Antiquitätensammler unterwegs war wie als Schauspieler. Du musst nicht alles haben, Manfred, beschied Judy, du hast ein Badezimmer, wir haben eine Waschschüssel.
Ein Stahlschmelzer wie sein Vater sollte Manfred Krug werden. Was er wurde, war ein Schauspieler, der erst in zweiter Linie Schauspieler war. Erstens nämlich war er ein mutiger Mann, der sagte, was er für richtig hielt. Ein Mann, der eine Weile im Stahlwerk gearbeitet hatte, also glaubwürdig die Arbeiterklasse darstellen konnte: unerschrocken und schlagfertig, besserwisserisch und diktatorisch. „Spur der Steine“, der Defa-Film, von dem sich die Partei beleidigt fühlte und den das 11. Plenum der Partei verbot, sagt alles über die Fehler der DDR.
Manfred Krug sah auf eine proletarische Art aus wie Marlon Brando. Singen konnte er auch, mit einer verlässlich tiefen Stimme, die zwischen Jazz und Chanson bemerkenswert zärtliche Höhen erklomm. „Es steht ein Haus in New Orleans“ und „Niemand liebt dich so wie ich“ – große Gesänge, denen noch eine Menge Großes folgte.
Judy und Krug hatten in jungen Zeiten mal einen gemeinsamen Heimweg, sie liefen am späten Abend die Schönhauser Allee entlang, und Krug trug eine Art Kofferradio bei sich – oder war es ein tragbarer Plattenspieler? –, auf dem er „My Rosetta“ sang, er stellte das Gerät so laut es ging, die Nachtgestalten der Schönhauser Allee zeigten Interesse. Judy fand seine Angeberei ein bisschen peinlich, aber schön war es doch.
Nicht so schön fand sie, wie Krug bei einem Essen im Ganymed in die blütenweiß gestärkten Servietten schnäuzte. Henri tat so, als hätte er es nicht gesehen, Judy lachte ein Übersprungslachen.
Es war eine lebenslange Freundschaft mit Unterbrechungen, denn Krug war wegen der Biermann-Affäre in den Westen getrieben worden.
Meine beste Zeit hatte ich in der DDR, sagte er mal leise vor sich hin, während eines der gemütlichen Nachwende-Treffen in der Rankestraße, zu denen seine Frau Ottilie und er regelmäßig alte Freunde einluden. Manfred Krug war das Idol einer Gesellschaft, die anders sein wollte, anders werden wollte, ganz anders.
Auch Judy und Henri wollten anders sein, wollten anders leben. Mit weißen Wänden und Plakaten der russischen Avantgarde. Daj katschestwo! – Liefere Qualität! Übernimm du die Verantwortung!
Henri liebte die Russen, ihre Filme, ihre Revolution. Leben mit Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin, den Gedichten von Majakowski – und den Stieren von Picasso. Und mit einer weißen Stehlampe, die ein Student der Kunsthochschule Weißensee entworfen hatte und die das Fanal der Moderne an und für sich war. Unter dem sonnigen Licht dieser Lampe tranken sie Nordhäuser Doppelkorn und hörten den Linken Marsch: Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten / Gaul Geschichte, du hinkst/ Woll’n den Schinder zu Schanden reiten / Links! Links! Links!

Sonntagmorgen, der 13. August 1961. Es klingelt. Judy öffnet im Flatterhemd die Wohnungstür. Da stehen Margit und Willi, ihre Eltern. Mit einem nicht deutbaren Lächeln.
Die Grenzen sind zu, sagen sie und wiederholen: Die Grenzen sind zu. Fassungslos, ungläubig. Alles abgeriegelt, alles zu.
Kann nicht sein, sagt Judy, wir waren gestern Abend noch drüben in der Galerie Bremer, wir sind nachts noch mit der S-Bahn zurückgefahren, das kann nicht sein.
Ihr könnt uns glauben, sagt Willi, seht es euch doch an! Und er lächelt wie die Mona Lisa von da Vinci.
Judy und Henri hocken verkatert auf der Sumpfgondel. Es verschlägt ihnen die Sprache. Sie wissen noch nicht, dass sich ihr Leben radikal ändern wird, auch nicht, ob die unerhörte Nachricht gut oder schlecht ist. Judy und Henri ziehen sich an, dann fahren sie alle mit der Straßenbahn zur Friedrichstraße und laufen zum Brandenburger Tor, um die Sensation mit eigenen Augen zu sehen.
Hier gibt es nichts zu gucken, bemerkt ein Kampfgruppenkommandeur in eisigem Ton.
Alles abgeriegelt. Alles zu. Berlin ist geteilt, sie können nicht raus und nicht rüber, nicht hin und nicht her. Sie schweigen. Am Horizont aber sehen sie neue Möglichkeiten für den Sozialismus. Und sie sind sicher, dass die Mauer in spätestens fünf Jahren wieder verschwindet.
Nicht wenige begrüßten den Mauerbau. Endlich würden sie ungestört den Sozialismus aufbauen können, es würden keine Hamsterkäufe mehr stattfinden, auch keine Massenflucht gut ausgebildeter junger Ärzte und Wissenschaftler in den Westen.
Es werden achtundzwanzig Mauerjahre. Mehrere Generationen werden mit der Mauer alt und grau. Judy war zwanzig, als die Mauer gebaut wurde, sie war achtundvierzig, als sie fiel. Sie sah sich die Mauer niemals an. Nicht einmal das nachbarschaftliche Stück in der Oderberger Straße im Prenzlauer Berg. Die Mauer war da, aber Judy sah sie nicht, also war sie nicht da.
Und doch lebten sie mit der Mauer, und sie lebten ohne sie. Sie hörten Billie Holiday, sie liebten die sanften Beatles und die wilden Rolling Stones gleichermaßen, es war, als wären sie für ihre Generation erfunden worden. In dieser Musik lebten Sinn und Verstand, Wut und Frust, Rebellion und Revolution, Liebe und Empathie. Sie waren jung, sie wollten die Welt verändern, sie fühlten die Leerstellen.
Wir nannten sie die Mississippi-Post
Nach dem Studium landete Judy beim „Sonntag“, der Wochenzeitung des Kulturbundes, kleine Auflage, große Geschichte. Gestattete Nische für gemäßigten Individualismus. Judy brachte Fotografen mit: Arno Fischer, Sibylle Bergemann, Bernd Heyden.

Sie versuchte, beim „Sonntag“ jene Auffassung von Fotografie durchzusetzen, die die Antithese der herrschenden war: Realismus gegen Phrase. Nicht platte Illustration, sondern Bilder mit einer zweiten Dimension. Arno Fischer ging es weder um die eigene Karriere noch um das Honorar, es ging ihm tatsächlich um die „Dritte Sache“ und deren Schutz vor Verflachung und Kunstgewerbe, es ging ihm um die Fotografie, um deren Rettung vor der Agitation, vor der Knipserei, vor dem Geschäft und vor der Schönfärberei. Judy hatte viel von Fischer zu lernen, über die Ästhetik hinaus, Henri ebenfalls. Freunde zu haben, von denen man lernen kann, ist eine Prämie des Zufalls.
Die Redaktion residierte in einem alleinstehenden gelben Haus am Hausvogteiplatz, gleich neben dem kahlen Gebäude des Zentralkomitees der SED. Die Einrichtung bestand aus Fundstücken von vor dem Krieg. Aus den durchgesessenen Klubsesseln der Redaktionsstuben stiegen Staubwolken auf, sobald einer darin Platz nahm. Die Schreibtische hatten die Patina der Dreißigerjahre. Alte Cognacflecken auf mürbem Holz, schwarze Telefonapparate aus Friedenszeiten, klapprige Schreibmaschinen namens Erika. Wer seine Arbeit so gern machte wie die Redakteurinnen und Redakteure vom „Sonntag“, brauchte keinen Gittertüll. Ausgeleierte Drehstühle, schwarze Telefonapparate, die aus Hitchcock-Filmen stammen könnten, sowie flackernde Tischlampen mit Bauhaus-Flair.
Die Redaktion ähnelte einem ungemachten Bett, in dem viel Freude herrschte. Die Mehrheit der Redaktion stellten junge Frauen mit stolzen Gesichtern, die Germanistik, Romanistik oder Kulturwissenschaft studiert hatten, ihre Jugend stand in einem fast perversen Verhältnis zu dem Trödel um sie herum.
Das alleinstehende gelbe Haus gegenüber dem U-Bahnhof Hausvogteiplatz, so sagten sie am Telefon, wenn ein Autor auf dem Weg zu ihnen war. Sie können gleich durchgehen, es ist kein Pförtner da. Schwere Holztür, verwahrlostes Treppenhaus, mit Schränken vollgestellte Korridore, das Chefsekretariat ganz hinten, wo niemand es vermutete, es war das kleinste Büro von allen, mit einer großen blonden Sekretärin drin.
Das Haus, in festem Bündnis mit dem Zahn der Zeit, triumphierte gelassen über alle Neuerungen. Es blieb, was es war: ironisiertes und geliebtes Domizil für Arbeit, die man gerne tut. Mark Twains Mississippi-Post, so hatte Henri die Redaktion am Hausvogteiplatz genannt. Irgendwann hat dort mal die Hausvogtei residiert: „Wer die Wahrheit saget und bleibet dabei, der kommt nach Berlin in die Hausvogtei.“
Darauf waren die Absolventinnen stolz. Zwanzigtausend Auflage, dabei hätten sie eine Million verkaufen können, dachten sie, aber sie durften ja nicht, die Leser konnten ein „Sonntag“-Abo nicht erwerben, nur erben.
Von Kügelgen, der seinen Kaffee mit dicker, süßer, sowjetischer Sahne trank, erlaubte der Anfängerin Judy, gut zu schreiben, obwohl er linientreu war. Er ermutigte sie, einen eigenen Stil zu entwickeln, was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich, ja, kaum möglich gewesen ist. Dieser Chefredakteur forderte keinen Parteijargon, er ließ sogar die Ich-Form durchgehen, selbst den gefürchteten Individualismus fürchtete Herr von Kügelgen nicht.
Es gibt nichts Schöneres, als Texten die Redundanz auszutreiben, die Langeweile der Wiederholung sozialistischen Vokabulars. Aus langen Texten können gute werden, wenn sie nur kurz genug sind, aus mittelmäßigen Schreiberlingen werden Autoren. Die Redakteurinnen und Redakteure gaben sich mit niedrigen Gehältern zufrieden, solange sie schreiben durften, was sie für richtig hielten, und das fiel eine Spur realistischer aus als in anderen Zeitungen des Landes.
Die Redaktion war ein Eldorado junger Frauen, die es sich leisteten, wenig zu verdienen, und für Männer mit Lebenserfahrung, die lieber mit attraktiven Absolventinnen zusammenarbeiteten, als Karriere zu machen.
Man siezte sich beim „Sonntag“, das forsche Genossen-Du passte nicht zu ihnen; sie wollten anders links sein. Ab und an konnten sie sich sogar als Helden fühlen, wenn zwischen den Zeilen die Realität aufschien und ausgehungerte Leser Solidaritätsadressen sandten.
Eines Tages wurde Bernt von Kügelgen ins Zentralkomitee der SED bestellt. Er nahm Judy mit, weil sie den Text über „Jugendgemäße Tanzmusik“ zu verantworten hatte, inklusive einer Reportage über die Modern Soul Band, deren Musik der zuständigen Genossin nicht gefiel. Im ZK-Gebäude fuhren der Chefredakteur und die Anfängerin im Paternoster hoch zu Genossin Dörte. Die nahm sie beide an die Kandare, den Chefredakteur wie die Anfängerin, damit sie parierten wie brave Pferdchen. Es war das einzige Mal, dass Judy Paternoster fuhr. Wäre sie – Vater unser! – öfter Paternoster gefahren und öfter an die Kandare genommen worden, hätte sie kein Wort mehr schreiben können, jedenfalls kein gutes.
Das Erlebnis im Zentralkomitee war so prägend, dass Judy von einem wiederkehrenden Traum verfolgt wurde: Er spielt in einer Art Hotel-Lobby, es ist ein Interhotel. Sie steht in einer Schlange von Männern mit Aktentaschen. Jeder dieser Männer sagt, wenn er dran ist, den Satz: Ich möchte einsitzen. Judy spricht nach: Ich möchte einsitzen. Auch Nikolai Bucharin, sowjetischer Ökonom, zeitweise Chefredakteur der Zeitung „Prawda“, steht an und sagt, als er dran ist: Ich bekenne mich schuldig … ich betrachte mich als verantwortlich für das größte und ungeheuerlichste Verbrechen an der sozialistischen Heimat …
Lenin hatte Bucharin das goldene Kind der Revolution genannt, den Liebling der Partei. Bucharin wurde hingerichtet. Er war damit einverstanden. Nicht nur in Judys Traum.
Als Herr von Kügelgen in Anwesenheit seines Nachfolgers feierlich abgelöst wurde, erschien die gesamte Redaktion in Schwarz, wie auf einer Trauerfeier, was die Funktionäre mächtig irritierte, aber schließlich war es eine Feier, also darf man sich festlich anziehen, und Schwarz ist festlich, allerdings nicht in jedem Fall. Subversion bleibt Subversion, auch wenn der Umsturz ausbleibt.
Die Funktionäre waren irritiert, der neue Chef auch. Der „Sonntag“ erschien weiter Woche für Woche, Jahr für Jahr, auch wenn die Auflage immer kleiner wurde. Nur größer durfte er nicht werden, die Leserschaft musste überschaubar sein, das kulturpolitische Ventil für Künstler und Intellektuelle sollte ein feines Steuerungsinstrument bleiben, damit der Wind nicht zum Sturm wurde.
Als der neue Chefredakteur in seiner ersten Redaktionssitzung erklärte, dass die Demokratie in der DDR immer stärker werde, meldete sich die Kollegin mit dem Namen Ina Kanonier zu Wort: Demokratie? Uns hat keiner gefragt, ob wir Sie als Chefredakteur haben wollen.
Die Mitarbeiter feierten gern die Geburtstage der Kollegen mit Wein und Musik. Judy legte eine Platte auf mit Manfred Krugs „Niemand liebt dich so wie ich“, er hatte gerade die DDR verlassen, der „Verräter“, trotzdem summte der neue Chefredakteur fröhlich mit: „Niemand liebt dich so wie ich …“ Er tat, als würde er die Stimme des „Verräters“ nicht erkennen und hörte mit Hingabe das Original der Operette von Franz Lehár; er verließ aufgeräumt das feiernde Büro. Judy legte dieselbe Platte noch einmal auf, und noch einmal: „Niemand liebt dich so wie ich“.
Utopien sind größenwahnsinnig
Judy glaubte noch immer an die Utopie einer neuen Gesellschaft, an das Glück eines Zusammenlebens ohne Konkurrenz und Karrieredruck. Daran, dass die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen für immer vorbei sein könnte. Ein Glaube, der sich auflöste, aus dieser Kirche traten viele aus, sie wechselten zur Teilnahmslosigkeit.
Widersprüche ohne Lösung: Während in Prag sowjetische Panzer gegen den Sozialismus mit menschlichem Antlitz rollen und alle Hoffnung auf Bewegung, Reform und Veränderung niederwalzen, dem marxistischen Weltbild zum Hohn, brandet aus dem Westen eine unerwartete Renaissance des Marxismus gegen den Eisernen Vorhang. Jugend will die Welt verändern, Jugend steht auf, Jugend fordert die Aufklärung der Vergangenheit ihrer Väter. Sie heben die Fäuste und singen die Internationale. Sie tragen die Porträts von Liebknecht und Luxemburg, Marx und Lenin, Che Guevara und Ho Chi Minh durch die Straßen und verteidigen sie gegen Polizei und Wasserwerfer.
Einer ist da, der schreit Judy aus dem Herzen – Rudi Dutschke, der in Luckenwalde aufwuchs. Die Worte, die er heiser in die Menge schreit, sind ihr nicht fremd. Sie kennt sein Denken, es ist dialektisch. Er haucht dem Sozialismus Frische und Zeitgeist ein. Achtundsechzig ist die vorübergehende Sanierung der sozialistischen Utopie.
„Was ist revolutionär?“, wird zum Thema in der Redaktion des „Sonntag“. In einem ihrer Texte stellt Judy die Frage, ob es richtig sei, dass die Bequemlichkeit des Denkens zur Gewohnheit und das Mittelmaß zum Maß aller Dinge werde. Der Text erschien vorsichtshalber als Leserbrief, weil in ihm „nicht alles zu Ende gedacht“ sei.
Judy glaubte an ein sozialistisches Land mit Jazz und Rock ‘n‘ Roll, grandiosen Filmen, genialen Büchern, revolutionärem Theater. Mit Männern, die sich nicht nur als Ehemänner, sondern auch als Gefährten bewährten, mit selbstbewussten, fröhlichen Frauen und lernlustigen Kindern. Und dass die Mauer wieder verschwindet.
Hört sich übertrieben an, Utopien sind und bleiben größenwahnsinnig.
Mit den Sechzigerjahren ging die Aufbruchsphase der DDR zu Ende, für immer. Stillstand hier, Revolution im Westen. Die Beatles singen „All you need is love“, die Rolling Stones „Sympathy for the devil“. Rote Fahnen wehen auf dem Kurfürstendamm. „Jünglinge stehn in Universitäten/ und Söhne auf, die ihre Väter hassen.“
Die sozialistische Utopie hatte sich nicht erfüllt, und doch war Judy froh, zwanzig Jahre lang mit einer Utopie gelebt zu haben. Der Glaube an Fortschritt, Sozialismus und eine bessere Welt, „ein Traumbild ohne die Chance, ins Wirkliche überzutreten“ (Friedrich Dieckmann). Judy vertraute der Chance des Traumbildes, dafür nahm sie die Enttäuschung durch das Wirkliche in Kauf, denn eine Jugend ohne Utopie ist verloren. Das Paradies ist ein Puzzle aus Momenten. Man muss sie erkennen und festhalten. Im Gedächtnis der Gesellschaft und in seinem eigenen.
Irgendetwas fehlt immer an der Vollständigkeit eines Puzzles, das auf Rätsel und Verwirrung baut. Eine Frage der Zeit, wann das fehlende Stück vermisst wurde – die Südfrucht, die Meinungsfreiheit, die Welt? Zweifel greifen Raum, leise rumort der Stillstand. Die Jugend im Osten fühlt sich alt, trotz Jugendmode, Jugendkommuniqué, trotz jugendgemäßer Tanzmusik, Singeklub und Lyrikbewegung
Gekürzter Auszug aus: Jutta Voigt: Wilde Mutter, ferner Vater. Aufbau, Berlin 2022. 256 Seiten, 22 Euro