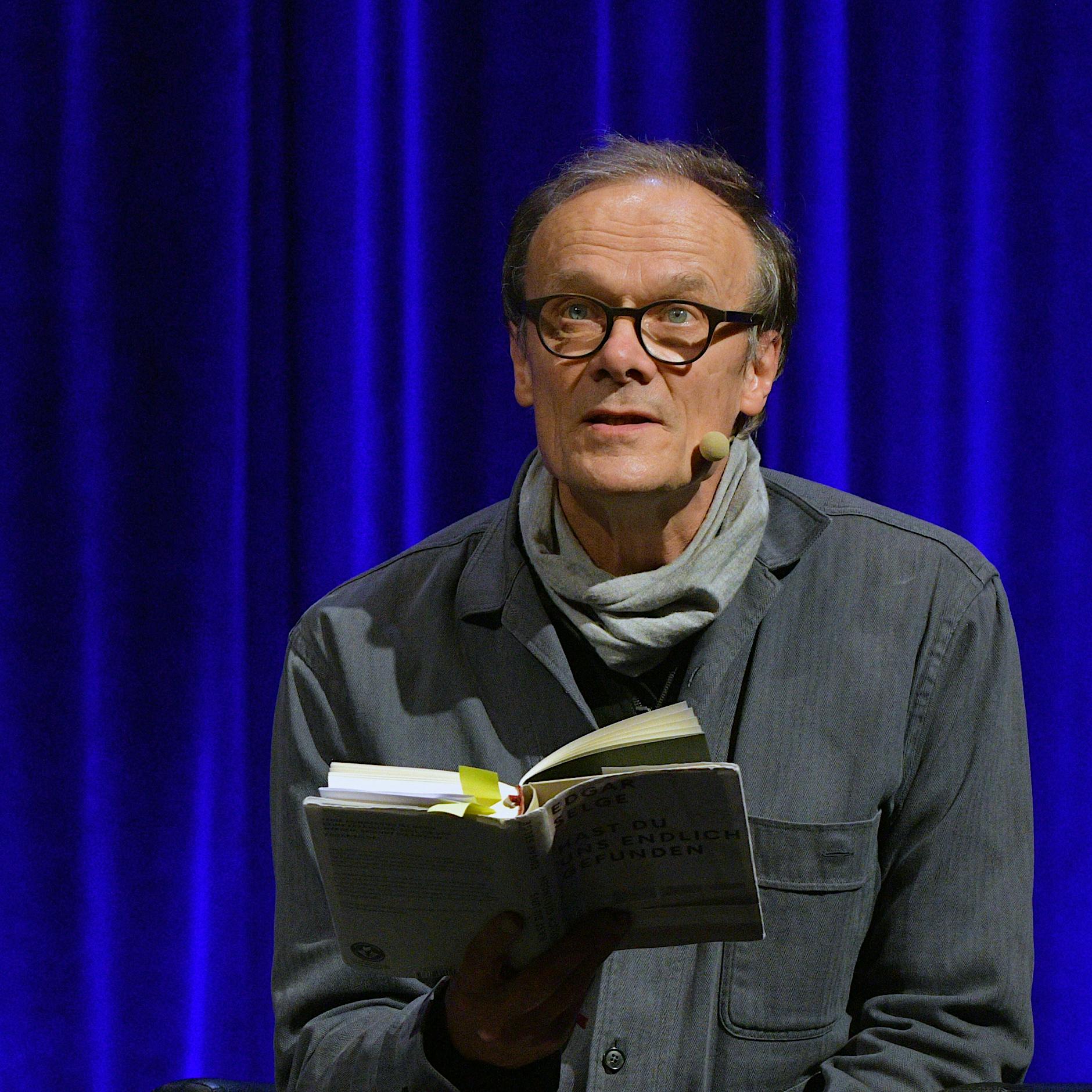Valery Tscheplanowa arbeitet schon immer mit Sprache, bisher aber als Schauspielerin. Sie fühlt sich dazu berufen, Texte von Dichtern gedanklich und seelisch zu durchdringen und die darin steckende Poesie mit der Zunge zu befreien. Ja, nicht nur mit der Seele, sondern auch mit der Zunge. Bei ihr ist es ein auch materieller Vorgang, bei dem man den Strom fließen sieht. Ihre Virtuosität hat sie besonders mit Heiner-Müller-Texten in Dimiter-Gotscheff-Inszenierungen und zuletzt in der Titelrolle in Ulrich Rasches Salzburger „Nathan der Weise“ unter Beweis gestellt.
Nun hat sie eigene Texte verfasst. Autobiografisch inspirierte Erinnerungssplitter, die sie zu einem Roman angeordnet hat: „Das Pferd im Brunnen“. Auch diesem literarischen Debüt merkt man das Körperliche an, das Benetzte, Bewegte, Geformte, Geküsste, Umarmte, Sinnliche – wobei es überhaupt nicht um Sex oder irgendwelche Schwelgereien geht, sondern um die Lebendigkeit von Erinnerungen und die Lebendigkeit von Toten.
Auf die Chronologie pfeift sie dabei, die Splitter schieben sich nach einer anderen, tieferen Ordnung übereinander, gleiten weg und haken sich ein, spiegeln und beißen einander. Wir springen von der Psychiatrie in eine Schlange an einem Eierverkauf, in eine Dreizimmerwohnung mit herausgerissenem Fischgrätparkett, zur Heiligen Mutter von Kasan, ans Ufer der Wolga, an den Rand einer Bundesstraße, in die Weite Russlands, in die Enge des Sterbebetts.
Geliehene Nasen, die geliehene Luft atmen
Die Texte umfassen vier matrilineare Generationen: Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und Tochter. Das urgroßmütterliche Holzhaus bei Kasan, mit dem Brunnen, auf dessen Grund das wie ein Kartenhaus zusammengefallene Skelett eines Pferdes liegen soll, versinkt langsam im Moor. Gehen mit ihm die Geschichten und die Gedanken verloren? Oder werden sie von der Erde einverleibt wie in einen weichen, warmen Speicher, der sich nicht um Formen und Grenzen des Vergangenen kümmert? Der Tod wird ein bisschen unwichtiger, wenn man so denkt. „Vielleicht sind wir alle geliehen, Leihobjekte, geliehene Haut, Knochen, Fleisch und Zähne. Nasen, die geliehene Luft atmen, Zähne, die geliehenes Essen kauen, und irgendwann in einem unvorhersehbaren Moment gibt es einen Riss, und das geliehene Material fällt auseinander und verwandelt sich in übelriechende Reste, die dann zu Erde werden.“

Valery Tscheplanowa lässt ihre so junge wie reife Ich-Erzählerin am Ende des Buches in den Spiegel blicken und ihre Großmutter in sich wohnen: „Ich erkenne unter meiner Haut ihre Haut. Sie hat sich in mich verwandelt, ich erzähle sie weiter, bin ihr Echo. Unsere Haut ist eine Geschichte, die wir fortschreiben.“ Die Augen der Toten blicken der Lebenden etwas runder ins Gesicht, der Hals und die Glieder sind dieselben, nur etwas in die Länge gezogen, die Nase ist kürzer, die Haare sind heller. „Ihre Hände haben in meinen ihre Kantigkeit verloren, und meine Lippen sind verwischt, während ihre scharfe Konturen hatten. Der Blick aber, unser Blick, bleibt gleich.“
Die 1980 geborene Tscheplanowa hat ihre Biografie in dieser Zeitung selbst einmal als einen Groschenroman bezeichnet, der mit Erinnerungen an eine Kindheit in dem besagten Holzhäuschen an der Wolga begann, 800 Kilometer östlich von Moskau. Ihr Vater war Mathematiker, die Mutter Übersetzerin an der Kasaner Universität, der ältesten Russlands. Der Vater starb früh, die Mutter lernte auf einer Kreuzfahrt einen Alleinunterhalter kennen, der sie nach Deutschland mitnahm, nach Remmels, einer Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein. Sie wohnten in einem Haus an der Bundesstraße 77, wo es nach Schweinestall roch. Die entwurzelte, hochbegabte Tochter wurde zur Außenseiterin, sie riss sich los, büxte aus, geriet aus einem impulsiven Moment heraus an die Palucca-Schule nach Dresden und legte damit den Grundstein ihrer Bühnenkünstlerinnenkarriere.
Aber kann man wirklich von Entwurzelung und Losreißen sprechen? Die Aura der Lebensorte, der verlassenen und der wieder aufgesuchten, ist in wenigen Strichen präsent. Und die Toten kehren verjüngt und lebendig in den Augenblick der Lesegegenwart zurück. Es ist, als würden die Säfte der Erzählung durch die Wurzelfäden und Nabelschnüre strömen, die die Mütter und Töchter über eine zufällig bleibende, lediglich örtliche und terminliche Trennung hinweg miteinander verbinden. Die Individualität verliert ihre Grenzen, die Erzählung ihre Kapiteleinteilung, alles geht auseinander hervor und miteinander unter, im Schoß des Moores, wo es sich auflöst und weiterlebt.