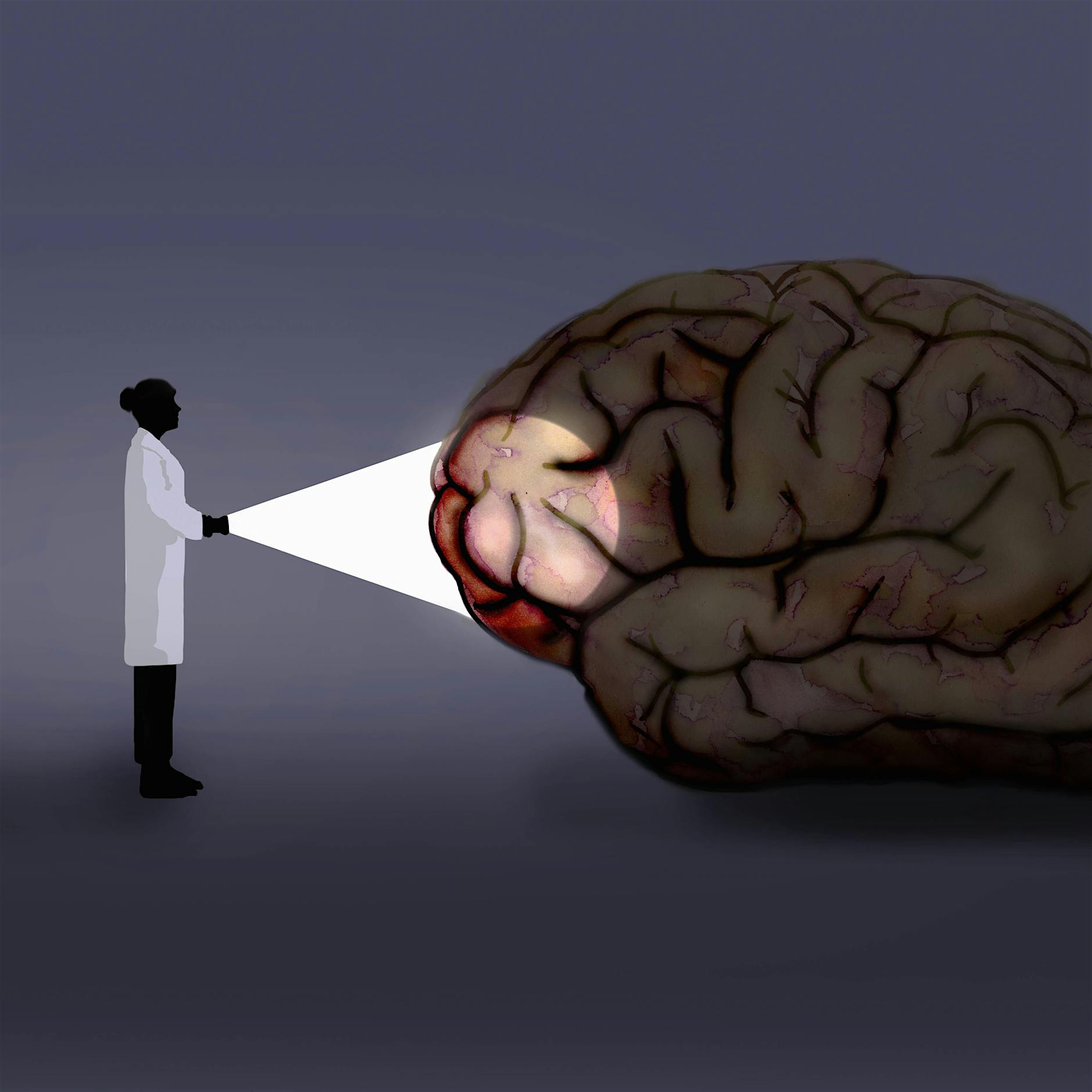Berlin-Eine starke Immunreaktion auf die Corona-Infektion scheint die Ursache vieler neurologischer Symptome zu sein. Doch spielt der Verlauf an sich eine Rolle? Wieso entwickeln manche Menschen lang anhaltende Long-Covid-Symptome und andere nicht? Warum ist es so kompliziert, Long Covid zu messen? Und kann eine Corona-Infektion langfristig zu anderen Hirnerkrankungen wie Demenz führen? Ein Gespräch mit dem Direktor des Instituts für Neuropathologie an der Charité, Frank Heppner, und dem Assistenzarzt Tom Aschman.
Herr Heppner, Herr Aschman, schon fast seit Anbeginn der Pandemie vermuten Forschende eine Verbindung zwischen einer Corona-Infektion und neurologischen Problemen. Kann Sars-CoV-2 tatsächlich ins Hirn eindringen?
Frank Heppner: Nach vielen Untersuchungen, die uns bekannt sind, die wir zum Teil auch an der Charité selbst durchgeführt haben, gibt es keinen klaren Hinweis darauf, dass das Coronavirus das Hirn direkt befallen kann. Das Virus befällt zwar die Nervenzellen in der Riechschleimhaut, aber im Gehirn selbst hat man es noch nicht in überzeugender Weise – damit meine ich nicht nur RNA-Moleküle per PCR-Nachweis, sondern das Viruseiweiß selbst – gefunden. Wenn überhaupt, findet es sich in den Hirnhäuten oder in den Gefäßwänden dort.
Wie haben Sie das nachgewiesen?
Heppner: Wir haben in der ersten Corona-Welle etwa 100 Menschen obduziert, die an oder mit Corona auf der Intensivstation verstorben sind. Das heißt, wir haben es mit Extremverläufen zu tun gehabt, der Spitze des Eisbergs. Als Neuropathologen schauen wir uns das Hirn der Verstorbenen an. Genauer noch, die Hirnflüssigkeit und das Gewebe. Bei manchen wenigen Patienten haben wir durch das Virus geschädigte Nervenzellen in der Riechschleimhaut entdeckt. Was aber viel wichtiger ist als die Frage, ob man nun ganz vereinzelt das Virus im Gehirn entdeckt oder auch nicht entdeckt – da streiten sich die Gelehrten trefflich aktuell, wobei allen klar ist: einen starken Virusbefall des Gehirns gibt es nicht –, und worauf der eigentliche Fokus liegen muss: die sehr starke Immunreaktion, die durch die Corona-Infektion im Gehirn ausgelöst wird.

Können Sie das ausführen?
Heppner: Wir gehen davon aus, dass eine starke Immunreaktion auf die Corona-Infektion die Ursache von vielen neurologischen Symptomen ist. Bei heftigen Verläufen kann es zu einem sogenannten Zytokinsturm kommen, einer gefährlichen Überreaktion des Immunsystems, die starke Entzündungsreaktionen auslöst. Diese Immunreaktion konnten wir nicht nur im Plasma, also im Blut nachweisen, sondern eben auch im Hirnwasser. Dort haben wir entdeckt, dass Mikrogliazellen – also Immunzellen, die über das Hirn wachen, eine Art Immun-Polizei im Gehirn – durch den Zytokinsturm aktiviert wurden und umgekehrt auch einen Effekt auf die überschießende Entzündungsreaktion im restlichen Körper hatten.
Was wir außerdem entdeckt haben: Auch die Blutgerinnung kann durch eine akute und schwere Corona-Infektion beeinflusst werden. Es kann in einzelnen Gefäßen zu Thrombosen kommen, also zu Blutpfröpfen, die zu einem Infarkt führen können – im Gehirn selbst, aber auch im restlichen Körper.
Ist die Blut-Hirn-Schranke nicht dafür da, derartige Attacken abzuwehren?
Heppner: Die Blut-Hirn-Schranke ist keine Schranke im Sinne einer Mauer, sondern sie ist ein Verbindungssystem, in dem ein Austausch in beide Richtungen stattfindet. Deswegen haben systemische Reaktionen, die im Körper stattfinden, einen Effekt auf das Hirn – und die Immunreaktionen im Hirn einen Effekt auf den restlichen Körper. In dem Sinne: Die Folgen im und für das Gehirn sind nicht zwingend welche, die direkt durch das Coronavirus bedingt sind, sondern sie werden getriggert durch die Immunantwort.

Gibt es Faktoren, die einen schweren Covid-Verlauf begünstigen? Alter, Gene, Vorerkrankungen?
Tom Aschman: Bei jungen Patienten ist festgestellt worden, dass genetische Prädispositionen eine Rolle spielen, welche die Abwehr von Viren beeinträchtigen können. Das kann man als eine Art Immundefekt sehen, der sich aber noch nicht wirklich manifestiert hat und jetzt erst durch diese Infektion relevant wird. Bei älteren Menschen sind es vor allem Zivilisationskrankheiten wie Herz- und Gefäßerkrankungen, Übergewicht, Diabetes.
Heppner: Diese jungen Menschen haben ein völlig normales Leben geführt, weil ihr Immunsystem bis dato nicht gefordert wurde. Durch die Corona-Infektion werden dann solche Reaktionen provoziert. Das kennen wir von anderen viralen Erkrankungen, bei denen als Folge beispielsweise Asthma auftritt. Wir reden aber über eine sehr kleine Population.
Infarkte, also auch Schlaganfälle, sind als mögliche Spätfolgen einer Corona-Infektion bekannt, aber auch chronische Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Depressionen oder Kopfschmerzen. Gibt es Erkenntnisse, warum bestimmte Symptome milder sind oder schneller auslaufen als andere?
Heppner: Zu den dezidierten Symptomatiken sind keine guten Studien bekannt. Eine der im Neurobereich angesiedelten Frühsymptome von Long Covid sind die Geschmacks- und Geruchsverluste. Das Virus kann die Nervenzellen in der Riechschleimhaut befallen, ohne dass es notwendigerweise ins Hirn „hochwandert“. Dann kommt es zur Störung der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Meist regenerieren sich die Zellen nach einer gewissen Zeit, die Missempfindungen legen sich – zumindest dann, wenn nicht zu viele dieser Sinneszellen im Rahmen der Infektion „untergegangen“ sind. Wenn es zu viele Untergänge dieser Nervenzellen gegeben hat, kann die Störung der Geschmacks- und Geruchssensationen andauern. In solchen Fällen muss man überprüfen, ob die Missempfindungen auch in zwei oder drei Jahren anhalten – das lässt sich noch nicht abschließend sagen; auch lässt sich nicht sagen, wer ein solches Langzeitrisiko trägt, dafür gibt es keine harten diagnostisch nutzbaren Kriterien.
Werden lang anhaltende Symptome verstärkt nach schweren Covid-Verläufen beobachtet?
Heppner: Jede Form der Infektion, egal wie stark ausgeprägt sie ist, führt zu einer Immunreaktion. Wir unterscheiden zwischen der Akutsituation und der chronischen Situation. Es gibt sowohl Berichte von Long-Covid-Problematiken nach schweren Verläufen – aber auch nach milden. Das Problem sind die fehlenden harten, das heißt messbaren Paramater.
Aschman: Man kann die meisten Long-Covid-Symptome, wie eine lang anhaltende Müdigkeit, nicht wie Blut- oder Zuckerwerte messen, quantifizieren und objektivieren. Müdigkeit im Rahmen einer Infektion ist an sich auch eine ganz normale Reaktion des Körpers. Evolutionsbiologisch ist es sogar gewollt, dass ein Mensch, wenn er sich mit einem Virus angesteckt hat, müde und schlapp wird, sich zurückzieht und nicht viel bewegt, damit er das Virus nicht verbreiten kann. Jetzt haben wir Patienten, wo diese Art von Symptomen noch Monate nach der akuten Infektionsphase bestehen bleibt. Evolutionär betrachtet macht es keinen Sinn, weil das Virus ja aus dem Körper ist und nicht mehr übertragen werden kann.
Wenn der Grund nicht evolutionär bedingt ist – wie dann?
Aschman: Es kann viele unterschiedliche Ursachen haben, wieso es zu Long Covid kommt. Vielleicht ist die Person schon vor der Ansteckung mit Corona körperlich oder psychisch angeschlagen gewesen, weil sie über ihre Ressourcen hinausgelebt hat. Die Corona-Infektion könnte also der Kipppunkt gewesen sein, wo sich das Angeschlagensein chronifiziert. Gewissen Menschen fällt es zudem leichter, nach der durchgestandenen Infektion auf das Niveau von zuvor zu kommen. Anderen fällt es schwerer. Da kommt es sicherlich auch drauf an, ob Personen Vorerkrankungen oder Prädispositionen haben oder nicht.
Gilt das auch für andere Infektionen?
Heppner: Neurologische Probleme, die postviral, also nach einer Infektion auftreten, kennen wir auch von anderen Viruserkrankungen. Auch dort konnten wir beobachten, dass zwar das Hirn nicht direkt befallen wird, aber die Immunreaktion im Körper auch das Hirn beeinträchtigt und eben zu neurologischen Komplikationen führen kann. Wir wissen aber nicht, ob die Folgeerscheinungen nach einer Sars-CoV-2-Infektion schlimmer ausfallen als nach anderen Viruserkrankungen.
Aschman: Ich komme aus der Rheumatologie, wo ich mich viel mit Autoimmunerkrankungen beschäftigt habe. Schon lange gibt es die Hypothese, dass Viren eine wichtige Komponente in der Entstehung solcher Erkrankungen darstellen. Quasi als Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das Immunsystem hat viele verschiedene Bestandteile. Gene, Proteine und vieles mehr greifen ineinander und im Immunprozess selbst gibt es viele Schritte, die schieflaufen können. Es gibt also eine gewisse Fehleranfälligkeit. Im Nachgang einer Infektion können – bei bestimmten Menschen – Dinge in Bewegung gesetzt werden, die nicht – oder nicht sofort – wieder rückgängig gemacht werden können. Das ist der Preis dafür, dass wir so ein ausgefeiltes komplexes Immunsystem haben.
Wenn wir von Autoimmunerkrankungen und Virusinfektionen sprechen: Zuletzt haben Forschende herausgefunden, dass Multiple Sklerose (MS), eine chronische Erkrankung des Nervensystems, durch eine Infektion mit dem Herpesvirus Epstein-Barr (EBV) ausgelöst werden könnte. Könnte auch eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu langfristigen neurologischen Schäden führen?
Heppner: Bei der MS gibt es eine Schädigung des Hirngewebes, die aufgrund der Immunprozesse zunehmen kann. Eine substanzielle Schädigung des Hirngewebes durch das Virus sehen wir bei Long Covid nicht. Zumindest gibt es bislang keine Evidenz dafür – Infarkte beziehungsweise Schlaganfälle durch die Blutgerinnungsstörung in der Akutphase der Erkrankung bei wenigen Covid-Patienten sind hier explizit ausgenommen, da sie quasi ein anderes Krankheitsbild sind. Die Frage, ob eine Corona-Infektion langfristig zu anderen klassischen Hirnerkrankungen führen kann, ob also eine MS oder Demenz dadurch provoziert werden, das können wir an dieser Stelle nicht abschließend sagen. Da müssen wir in fünf, zehn oder 20 Jahren Studien durchführen und rückblickend analysieren, ob und wie viele Long-Covid-Patienten etwa eine Alzheimer-Demenz entwickelt haben. Die Hoffnung ist, dass wir auch die hierfür wichtigen Vergleiche ziehen können zu anderen Patienten mit durchlebten Virusinfektionen wie beispielsweise Hepatitis B, Influenza oder auch Epstein-Barr-Erkrankten.
Der Vergleich mit MS und dem Epstein-Barr-Virus zeigt aber einmal mehr, dass eine Viruserkrankung, egal ob im Gehirn oder außerhalb, zu einer unsortierten Immunreaktion führen kann, die dann kurz- oder langfristig Effekte aufs Gehirn haben kann. Für Covid kann das heißen: Das normalerweise fein abgestimmte Orchester des Immunsystems ist in Folge der Viruserkrankung wild geworden, läuft aus dem Ruder und sorgt möglicherweise in gewissen Fällen für Long-Covid-Symptome.
Welche Probleme ergeben sich, wenn man Long Covid messen will?
Heppner: Wenn ich den Herzschlag messe, habe ich eine Zahl, eine messbare Größe. Wenn ich eine Patienten-Befragung zu Chronischem Fatigue-Syndrom durchführe, also Patienten mit einer lang anhaltenden, krankhaften Müdigkeit, ist eine gewisse Subjektivität in der Beurteilung unvermeidlich. Wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass wir in einer Zeit leben, in der aufgrund der Corona-Präsenz und Informationsflut, medial, im Privaten, überall, eine erhöhte Alarmiertheit bezüglich etwaiger Symptome bei Covid-19-Erkrankten vorherrscht. Man horcht viel mehr in sich hinein. Psychosoziale Faktoren können solche Befragungs-Ergebnisse zudem verzerren. Andererseits haben wir bei keiner anderen Infektionskrankheit so dezidierte Untersuchungs-Parameter etabliert wie jetzt bei einer Corona-Infektion.
Aschman: Es gibt bereits große Studien zu Long Covid mit Tausenden Studienteilnehmern, aber das Problem bleibt: Wir reden zwar von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, befassen uns jedoch nach wie vor mit einer relativ jungen Erkrankung. Wir haben theoretisch Untersuchungsergebnisse von Menschen, die sich im März 2020 angesteckt und Symptome entwickelt haben, die noch heute anhalten. Die Zeitspanne reicht aber nicht aus, um klar sagen zu können, wie sich Langzeitfolgen entwickeln werden. Denn: Es ist nichts zu Ende beobachtet.
Heppner: Außerdem: Wenn ein Mensch für sich eine Problematik spürt, egal ob körperlich, also von der Schulmedizin nachweisbar, oder psychosomatisch, dann muss man trotzdem ganz klar festhalten, dass die Problematik da ist. Wir können sie nur nicht bemessen.
Welchen Schwerpunkt werden Studien aus der Pathologie in Hinblick auf Corona verfolgen?
Heppner: Die meisten Obduktionsstudien laufen weiter. Vordergründig will man verstehen, wie die Immunprozesse im Körper – so auch im Hirn – ablaufen. Wenn wir herausfinden, welche Faktoren es sind, die das Immunsystem aus dem Ruder laufen lassen, und welche Immunfaktoren es sind, die Ausschläge zeigen, dann können wir vorbeugende Medikamente entwickeln, um genau diese auslösenden Faktoren oder abweichenden oder überschießenden Immunfaktoren gezielt zu blockieren. Andererseits können wir anhand dieser Faktoren – körperlicher, immunologischer, psychosozialer und psychischer Art – Patientenkohorten definieren, die ein höheres Risiko für überschießende Immunreaktionen haben, und so prognostische Aussagen treffen, wer ein höheres Risiko für beispielsweise Long Covid hat.
In den Obduktionsstudien wurden Patienten untersucht, die den schlimmstmöglichen Verlauf hatten. Können die Erkenntnisse, die bislang gewonnen werden konnten, auf alle übertragen werden, also auch auf Patienten, die milde erkrankt sind?
Heppner: Die Frage ist berechtigt und wichtig, eine klare Antwort darauf kann ich jedoch leider nicht geben außer anzumerken, dass diese Art von Studien weiterbetrieben werden müssen, teils auch umfassender sein müssen, denn diese Art von Obduktionsstudien, so hilfreich sie auch ist, bringt intrinsische Probleme mit sich: Die obduzierten Patientinnen lagen vor Ihrem Tod teils sechs bis acht Wochen auf der Intensivstation und wurden invasiv beatmet. Wir müssen folglich coronavirusspezifische Effekte differenzieren von dem, was durch die Beatmungs- und Intensivsituation hinzukommt – all dies sind massiv auch das Immunsystem beeinflussende Faktoren. Dazu bräuchte man Patienten-Kohorten als Vergleich, die ebenfalls auf einer Intensivstation beatmet wurden, die auch eine virale Erkrankung hatten, die die Lunge betrifft, zum Beispiel Influenza oder RS-Virus. Das wäre aus rein wissenschaftlicher Sicht die Notwendigkeit, um sauber wissenschaftlich vergleichen zu können. Dass man das Zustandekommen solcher Kohorten aus rein emotionaler Sicht sich eigentlich nicht wünscht, ist klar.
Und was ist mit neurologischen Untersuchungen von Long-Covid-Patienten?