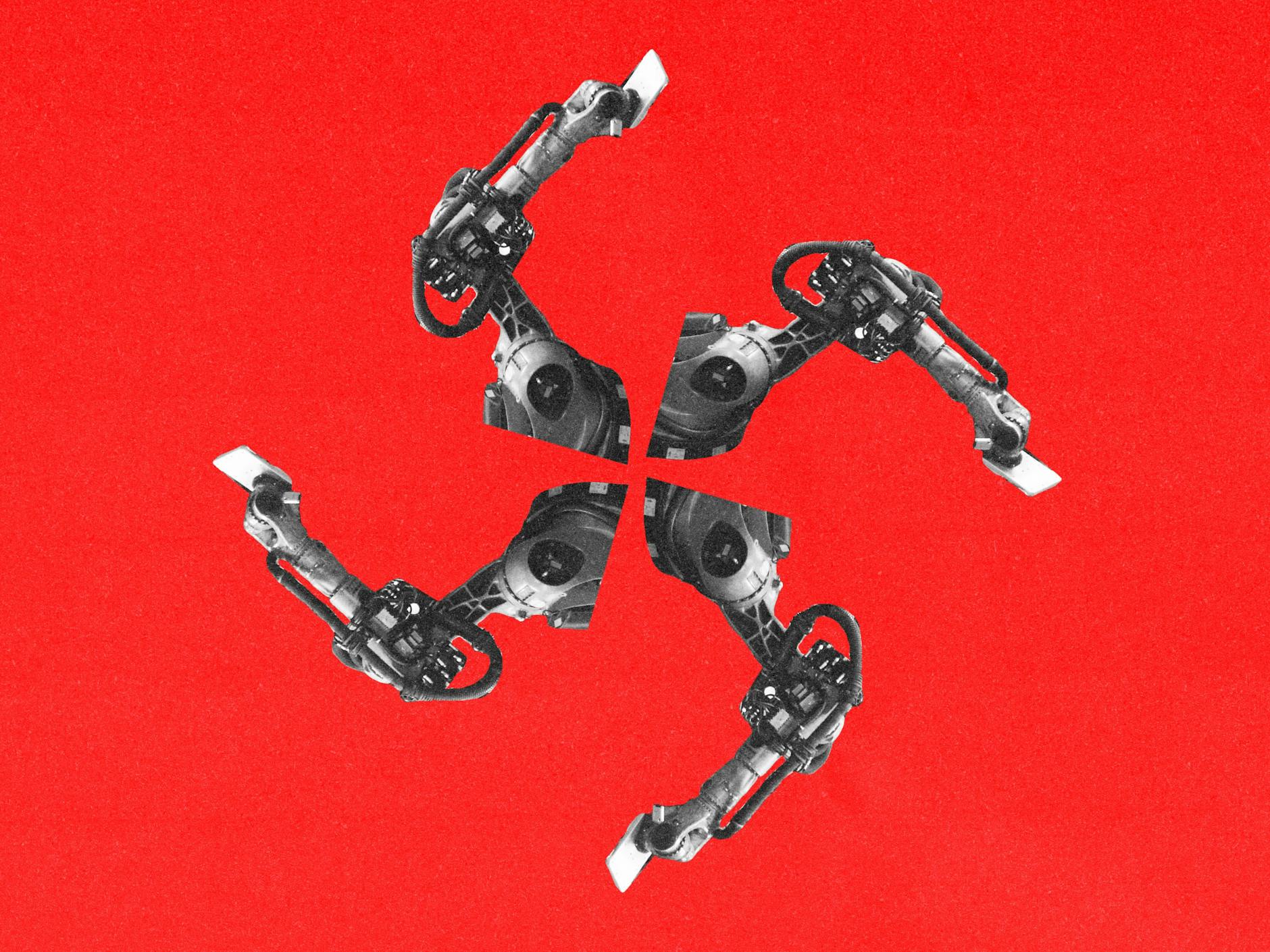Sie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Die Quandts, die Flicks, die von Fincks, die Porsche-Piëchs, die Oetkers und die Reimanns zählen zu den reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Und dennoch ist ihre NS-Vergangenheit bis heute kaum bekannt. In einigen Fällen wird sie von den Familien verschwiegen oder gar aktiv vertuscht. In seinem jüngst auf Deutsch erschienen Buch „Braunes Erbe“ legt der niederländische Journalist David de Jong jetzt auseinander, woher der Wohlstand jener reichsten Deutschen stammt, inwiefern sie von Nationalsozialismus profitiert haben, und wie sie später mit diesem Geschichte umgingen. Wir sprachen mit David de Jong via Zoom.
Berliner Zeitung: David de Jong, Teile Ihrer jüdischen Familie mussten im Holocaust vor den Nazis fliehen. Was brachte Sie dazu, Jahre in die detaillierte Recherche des Nazi-Erbes deutscher Unternehmensdynastien zu investieren?
David de Jong: Ich arbeitete für das Investigativ-Ressort von Bloomberg News in New York, wo ich mich insbesondere mit verborgenem Reichtum beschäftigt habe. Ich habe als Amerika-Reporter für dieses Team begonnen, aber bald wurde ich gebeten, über die deutschsprachigen Länder zu schreiben, weil ich Holländer bin. Worüber ich bald stolperte, war diese massive Vertuschung und Bereinigung der Geschichte deutscher Großkonzerne wie BMW und Porsche, die lediglich den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Patriarchen wie Herbert Quandt oder Ferry Porsche zelebrieren, aber im Kontext ihrer globalen Stiftungen, Medienpreise oder Firmensitze ihre NS-Vergangenheit nicht transparent machen. Dazu kommt, dass sie sagen, sie hätten alles aufgearbeitet. Man muss sich fragen: Mit wem und vor wem soll diese Aufarbeitung stattgefunden haben?
Man merkt Ihrer Frage an, dass Sie die Aufarbeitung für nicht hinreichend halten.
Natürlich. Jährlich stößt ein Journalist oder eine Journalistin in Deutschland auf die dunkle Geschichte eines bekannten Patriarchen während der Zeit des Nationalsozialismus. Und darauf reagiert dann eine Wirtschaftsfamilie oder ein Betrieb, die wie routinemäßig verlautbaren: ‚Wir haben Professor X oder Z beauftragt, um all das gründlich zu recherchieren.‘ In der Regel hört man dann circa vier Jahre nichts, woraufhin eine Studie publiziert wird, womöglich auch einer der Erben von den Medien interviewt wird. Der Punkt ist: Es ändert sich gar nichts.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Die Details der Studie, die etwa im Fall der Quandt-Familie ausgearbeitet wurde, sind auf der Website der BMW Foundation Herbert Quandt oder auch des Herbert-Quandt-Medienpreises schlicht nicht veröffentlicht worden. Da stellt sich tatsächlich die Frage: Mit wem findet Aufarbeitung statt? Bemerkenswert an diesen Studien ist auch, dass sie in der Regel nur auf Deutsch publiziert werden.

Man spricht in Deutschland einerseits gern über die Erfolge der historischen Aufarbeitung – andererseits gibt es ein Zögern, sich mit persönlicher Verstrickung auseinanderzusetzen. Ist es das, was Sie meinen?
Das Hauptargument meines Buches lautet: Dass man sich in Deutschland tatsächlich weigert, die sogenannte Aufarbeitung transparent zu machen. Dabei würde man aus der Geschichte lernen, wenn man nicht nur die guten Seiten beleuchtete. Also etwa nicht nur, dass Herbert Quandt BMW 1959 vor der Pleite rettete, sondern auch, dass er in Polen Ende 1944 ein KZ-Außenlager gegründet und mit aufgebaut hat. Oder dass er in Berlin Batteriefabriken betrieb, wo Tausende Zwangsarbeiter und Sklaven ausgebeutet wurden. Oder dass er in Frankreich von Juden geraubte Betriebe einkaufte. Ja, dass er sogar auf seinem eigenen Gut in Schlesien Kriegsgefangene ausgebeutet hat. Das alles wird eben nicht gezeigt, wobei das Motto der BMW Foundation Herbert Quandt „Inspire Responsible Leadership“ lautet. Das ist in meinen Augen obszön.
Sie haben BMW für Ihre Recherche mit diesen Fragen konfrontiert. Wie lautet deren Antwort?
Da heißt es dann: Herbert Quandt war damals noch kein Eigentümer bei BMW. Wir richten uns nur nach der Eigentümerschaft als BMW-Eigentümer. Dabei gibt es auch noch einen Herbert-Quandt-Medienpreis. Das ist ein Journalistenpreis, bei dem prominente Journalisten wie die ehemalige Bild-Chefredakteurin Tanit Koch, Jan-Eric Peters von der NZZ Deutschland und Horst von Buttlar vom Magazin Capital im Kuratorium sitzen. Ein paar Monate, nachdem ich meine Frage an den Pressesprecher von den BMW-Quandts gerichtet habe – nämlich, ob sie Herbert Quandts reingewaschene Biografie auf deren Homepage für ein Beispiel für Transparenz halten – wurde, ohne dass ich je eine Antwort erhalten hätte, eine etwas transparentere Biografie von Herbert Quandt veröffentlicht. Später hieß es: Wir haben uns für einen holistischeren Blick auf die Biografie von Herbert Quandt entschieden. Dabei wurden die Studienergebnisse mehr als ein Jahrzehnt lang ignoriert.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie manche der Familien mit NS-Hintergrund eigene Historiker engagieren.
Ja, das sind in der Regel auch gute Historiker wie Norbert Frei oder Joachim Scholtyseck. Nur muss es auch für sie beleidigend sein, jahrelang mit ihren wissenschaftlichen Teams in die Archive zu gehen, um dann festzustellen, dass die Familien, die das Ganze in Auftrag geben, teils bis heute mit den gewonnenen Erkenntnissen und Fakten nicht transparent umgehen.
Wenn man beispielsweise in den USA mit Menschen spricht, wird Deutschland oft für seine ausgeprägte Erinnerungskultur gelobt. Inwiefern glauben Sie nach Ihren Recherchen noch daran, dass dieser Eindruck zutrifft?
Ich sehe da eine unglaubliche Dissonanz. Die Mächtigsten und Reichsten in Deutschland scheinen die deutsche Erinnerungskultur jedenfalls nicht sonderlich ernst zu nehmen.
In einem jüngsten Artikel für die New York Times schreiben Sie: „Wie kann es sein, dass drei der mächtigsten deutschen Unternehmerfamilien und Wohltätigkeitsorganisationen so wenig mit der gelobten Erinnerungskultur des Landes zu tun haben?“
Genau!
Haben Sie durch Ihre Recherche eine Antwort gefunden?
Es gibt vor allem zwei Gründe, wobei ich keine festen Belege dafür habe. Einmal ist es so, dass die ganze Identität dieser Erben auf dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer Väter und Großväter fußt. Da wird es sehr schwer, über die dunklen Seiten der Familie zu sprechen. Das Zweite ist, dass die Erben auch riesige wirtschaftliche Interessen verfolgen. Womöglich fürchten die Herbert-Quandt- oder Ferry-Porsche-Erben, dass durch einen transparenten Umgang mit der Vergangenheit die Aktionärspreise ihrer Betriebe Schaden nehmen würden.
Was hat Sie in Ihrer Recherche am meisten schockiert?
In erster Linie das Ausmaß. Die Größe der Rüstungsproduktion, der gigantische Umfang, in dem „Arisierungen“ und Enteignungen stattfanden und Zwangsarbeiter und Sklaven ausgebeutet wurden. Ich habe es einfach unterschätzt, wie stark deutsche Firmen dieses System ausnutzten und wie tief sie involviert waren.
Hätten Sie sich seitens der Erben mehr Offenheit erwartet?
Ja, oder zumindest ein höheres Maß an Selbstreflexion.
In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland mehrere Versuche, Erinnerungskultur etwas anders zu denken. Sinthujan Varatharajah und Moshtari Hilal provozierten via Instagram eine Diskussion über den Begriff „Nazihintergrund“. Haben Sie diese Debatten verfolgt?
Am Rande, ja. Ich finde es wichtig, transparent mit der eigenen Geschichte umzugehen, vor allem, wenn man globale Stiftungen, Medienpreise oder Ähnliches im Namen der in den Holocaust verwickelten Menschen führt. Der Hauptsitz der beiden reichsten Erben Deutschlands, Stefan Quandt und Susanne Klatten, in Bad Homburg ist nach ihrem Großvater Günther Quandt benannt. Er hat Kriegsverbrechen begangen und hätte, wie Friedrich Flick, eigentlich in Nürnberg verurteilt werden müssen. Sie sind auch eine der größten Spenderfamilien der CDU und FDP. Was sagt das über die deutsche Gesellschaft aus, eine Gesellschaft, die ökonomisch und politisch so mächtig ist? Dass sie nach der sogenannten Aufarbeitung noch immer Kriegsverbrecher-Großväter ehren?
Was glauben Sie?
In Amerika nennt man so etwas „gaslighting“.
Was müsste konkret passieren?
Die Familien müssten anfangen, das Gute wie das Schlechte zu zeigen. Kaum jemand weiß, dass Ferry Porsche sich 1938 für die SS beworben hat, dass er 1941 freiwillig eingetreten ist, dass er sich in den 50er- und 60er-Jahren mit SS-Männern umringt hat in den Reihen des Porsche-Konzerns. Und dass er sich letztlich, Ende der 70er-Jahre, auch sehr virulent antisemitisch über den Porsche-Mitgründer Adolf Rosenberger geäußert hat. Die Ferry-Porsche-Stiftung finanzierte 2019 den ersten Lehrstuhl für Corporate History an der Uni Stuttgart. Der Leitspruch dort lautete: „Wenn man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch nicht, wo man hingeht“. Dabei hat die Stiftung selbst nie ein transparentes Wort über Ferry Porsches düstere Geschichte verloren.
Sie sprechen über BMW, Porsche, Volkswagen – den Kern deutscher Autoindustrie. Müsste man vor dem Hintergrund des Nazi-Erbes anders über die deutsche Wirtschaft nachdenken?
Ich halte es eher für Zufall, dass Familien wie Flick und Quandt in der Nachkriegszeit die Großaktionäre von Daimler-Benz und BMW wurden und sehr eng zusammenarbeiteten. Bei Porsche ist das etwas anders. Porsche wurde 1930 mit Adolf Rosenberger gegründet. Später überzeugte Ferdinand Porsche Hitler, die Volkswagen in Produktion zu nehmen. Das ist das einzige Beispiel einer geradlinigen Kontinuität. Und auch das einzige Beispiel einer Familie, die ihren Reichtum wirklich inmitten der Zeit des Nationalsozialismus gemacht haben. Die anderen, Quandt, Flick und so weiter, war bereits vorher sehr reich.
Nach Black Lives Matter gab es zahlreiche Diskussionen über koloniale Denkmäler, die fallen, sowie über Straßen, die umbenannt werden sollten. Was wäre in Ihren Augen ein guter Weg, um Nazi-Erbe sichtbar zu machen?
Ich halte Umbenennung für eine Form von Vertuschung. Man lernt das meiste über Geschichte, sobald man transparent mit ihren guten sowie ihren schlechten Seiten umgeht. Wenn man eine Straße oder einen Platz umbenennt, lernt man nichts mehr.
In Deutschland gab es im letzten Jahr eine breite Debatte über die Frage, ob man die Erinnerung an den Holocaust und deutsche Kolonialverbrechen vertiefen könne, indem man sie zusammendenkt. Was halten Sie von dieser Debatte?
Lothar von Trothas Krieg im heutigen Namibia – der erste Genozid im 20. Jahrhundert – ist in der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur noch immer absolut unterbelichtet. Das muss ein Teil der deutschen Erinnerungskultur werden. Auch wenn der Holocaust ein anderes Ausmaß hatte.
Seitens der deutschen Feuilletons hieß es oft, man würde das eine gegenüber dem anderen reduzieren, wenn man es zusammendenkt.
Nein, also ich sehe das nicht notwendigerweise als Relativierung.
Es gibt eine eindrückliche Szene am Ende Ihres Buchs. Sie betreten mit Ihrer Freundin das Museum of Modern Art in Tel Aviv. Am Eingang der Ausstellung steht auf Deutsch und Hebräisch eine Liste mit Namen der „Deutschen Freunde des Tel Aviv Museums“, darunter auch Gabriele Quandt und Ingrid Flick. Sie schreiben, beim Anblick dieser Namen wünschen Sie sich, dass die Kinder der Erben ihren Reichtum nutzen würden, um eine Welt zu schaffen, in der ihre Großeltern keinen Platz haben. Was meinen Sie?
Es geht nicht um Ideologie. Die meisten dieser Familien waren ja extrem opportunistisch. Es geht um die fehlende Transparenz. Sie herzustellen wäre das Beste, was man tun kann. Wie man auf Englisch sagt: „Sunlight is the best disinfectant“. Die BMW Foundation Herbert Quandt ist heute eine globale Stiftung. Diese Intransparenz ist insofern auch nicht mehr nur ein deutsches Problem, sondern ein globales.
Woran arbeiten Sie als nächstes?
Ich arbeite als Nahostkorrespondent für eine holländische Finanz-Tageszeitung. Gerade lebe ich mit meiner Freundin in Tel Aviv. Sie arbeitet als ARD-Fernsehkorrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete.