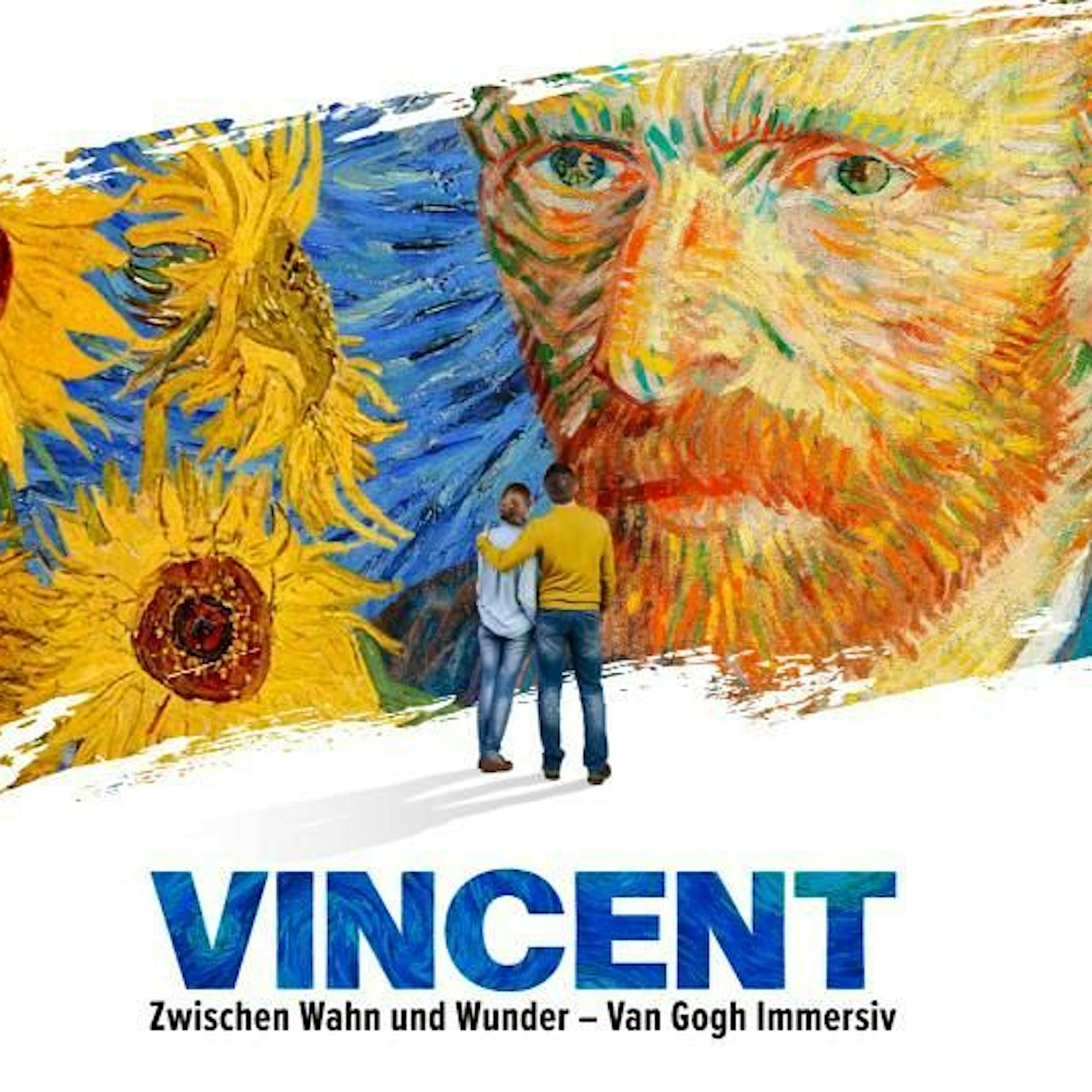„Westalgie ist total unterschätzt. Alle reden über Ostalgie. Aber jetzt erwischt es die Wessis.“ Dieser Satz von Jakob Augstein im Theater Ost in Adlershof traf mich wie ein Schlag, und deshalb schreibe ich diesen Text hier. Ich saß als gebürtiger Ost-Berliner im Publikum und hörte einen westdeutschen Verleger aussprechen, was ich seit Jahren fühle, aber nie so deutlich formuliert hörte. Neben ihm saß Holger Friedrich, ostdeutscher Verleger, und nickte nur. „Wir Ossis haben das schon durch. Die Normen brechen weg, das System kollabiert, die Gewissheiten erodieren. Das passiert ja gerade. Und ihr haltet uns auf.“
In diesem Moment realisierte ich, die Rollen sind endgültig vertauscht. Nach drei Jahrzehnten, in denen man Ostdeutschen erklärte, was mit uns nicht stimmt, erlebt der Westen jetzt seinen eigenen großen Bruch. Und plötzlich wird die ostdeutsche Erfahrung – wie man lebt, wenn eine eigene Welt zusammenbricht – zur wertvollsten Ressource dieses Landes.
Sehen Sie hier das Video zum Auftakt der Debattenreihe:
Wie der Westen 30 Jahre lang sich selbst betrachtete
Jahrzehntelang funktionierte für den „Westen“ ein einfaches, bequemes Narrativ. Es gab die „Ostalgie“, jene vermeintlich rückwärtsgewandte, unpolitische Sehnsucht der Ostdeutschen nach der untergegangenen DDR. Der westdeutsche Blick darauf war der des siegreichen Lehrmeisters. Man analysierte das vermeintliche Defizit, therapierte es weg, sah darin den Beweis für die Schwierigkeiten mit der Demokratie.
Dabei übersah man, dass man in diesem Spiegel immer nur sich selbst betrachtete. Das eigene unerschütterliche Erfolgsmodell. Die „BRD“ war nie einfach ein Staat. Sie war eine Heilsgewissheit, ein Endpunkt der Geschichte. Ulrich Machold und Hans Evert beschrieben diese Haltung schon 2012 treffend in der Welt als „bizarre Sehnsucht nach der BRD“. Schon damals, lange vor der Flüchtlingskrise oder Trump, begann der Rückzug in eine vermeintlich bessere Vergangenheit.
Die Wahrheit ist schmerzhaft. Die Westalgie existierte parallel zur Ostalgie, sie wurde nur nie benannt, weil sie das westliche Selbstbild zerstört hätte. Solange man über ostdeutsche Defizite sprechen konnte, musste man nicht über die eigenen Risse reden.

Das künstliche Paradies
Um die Tiefe dieser westdeutschen Sehnsucht zu begreifen, muss man das wahre West-Berlin verstehen. Nicht die Mythen von der „Insel der Freiheit“, sondern die Realität einer Stadt, die 39 Jahre lang künstlich am Leben gehalten wurde.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zwischen 1950 und 1989 pumpte Westdeutschland fast 245 Milliarden D-Mark in die eingemauerte Stadt, mehr, als sie selbst erwirtschaftete. Jede Lieferung, jedes Telefonat ging durch „feindliches“ Gebiet. 155 Kilometer Mauer und Stacheldraht umzingelten diese Insel. Es war, wie Sebastian Friedrich im Freitag analysierte, „eine Zeit, in der die Unwägbarkeiten des Kapitalismus noch verkraftbar erschienen“.
Doch dieses Paradies hatte ein Verfallsdatum. Es war eine Blase, die nur existieren konnte, weil der Kalte Krieg sie benötigte. Als die Mauer fiel, fiel nicht nur die DDR – auch West-Berlin als politisches Projekt war zu Ende. Genau wie diese künstliche Insel 1989, so geht jetzt das gesamte westdeutsche Erfolgsmodell unter.
Was der Osten schon immer wusste
Auf der Bühne in Adlershof im Theater Ost wird diese Erkenntnis zur schonungslosen Diagnose. Die Diskussion dreht sich anfangs um die Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney in Davos, der die „regelbasierte Weltordnung“ als „bequeme Lüge“ bezeichnete, die uns lange gepasst habe.
„Welcher deutsche Politiker könnte so eine Rede halten?“, fragt Friedrich in den Saal. Das Schweigen ist Antwort genug. Keiner weiß die Antwort.

Augstein präzisiert: „Der Westen wird gerade erschüttert, wie der Osten 1989/90.“ Die Symptome sind überall sichtbar. Der Glaube an ewigen Wirtschaftserfolg bröckelt mit jeder Massenentlassung bei VW in Wolfsburg, ausgerechnet im Herzland des westdeutschen Wohlstands. Die Sicherheit durch die USA? „Wer glaubt, dass Artikel 5 uns unter Trump schützt, ist verrückt“, sagt Augstein.
Friedrichs Reaktion ist die eines Menschen, der diesen Zusammenbruch schon durchlebte: „Als Ostgeborener zuckt man da mit den Schultern.“ Dieses ostdeutsche Schulterzucken ist kein Desinteresse, es ist die Anerkennung einer Wahrheit, die Ostdeutsche seit 1990 kennen. Alles kann sich über Nacht ändern. Jede Biografie kann brüchig werden. Nichts ist sicher.
Wie der Westen seine eigenen Probleme im Osten sucht
Die größte Blamage der westdeutschen Selbsttäuschung zeigt sich in der AfD-Debatte. Noch immer, wie Sabine Rennefanz im Spiegel anmerkt, inszeniert man den Rechtspopulismus als „ostdeutsches Problem“. Der Historiker Heinrich August Winkler behauptet in der FAZ: „Die Wahlerfolge der AfD im Osten haben offenkundig ansteckend gewirkt.“
Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Die AfD entstand 2013 in Oberursel bei Frankfurt am Main. Mitten im Westen. Ihr Bundesvorstand ist bis auf Tino Chrupalla westdeutsch dominiert, rund zwei Drittel ihrer Bundestagsabgeordneten kommen aus alten Bundesländern. Das Establishment, das Ostdeutschland jahrzehntelang Demokratiedefizite vorwarf, verschließt die Augen vor der eigenen Krise.
Kritiker sagen, die Politik der AfD ziele nicht auf die wirklichen, strukturellen Probleme des Ostens, sondern nutze die berechtigte Enttäuschung vieler Menschen als Wahlkampfmunition. Doch die hohen AfD-Ergebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sind in erster Linie ein Zeichen dafür, dass andere Parteien über Jahre hinweg die realen Sorgen und die Lebensrealität der Menschen in der Region nicht ausreichend erkannt haben. Die daraus entstandene Frustration und das Gefühl, politisch nicht gehört zu werden, haben ein Vakuum hinterlassen. In dieses Vakuum stößt eine Partei, die mit einfachen Botschaften punktet.
Was der Westen jetzt vom Osten lernen kann
In dieser Krise liegt eine historische Chance. Vielleicht können wir jetzt endlich aufhören, in den Kategorien von Siegern und Besiegten zu denken. Vielleicht kann der Westen endlich verstehen, dass die ostdeutsche Erfahrung kein Defizit ist, sondern ein Wissen.
Holger Friedrich sagt auf der Bühne den vielleicht wichtigsten Satz des Abends: „Ostdeutschland ist ein Asset.“ Keine Problemzone, sondern eine Ressource. Seine Diagnose, der Westen halte mit seiner eigenen Lethargie den Osten auf, trifft den Kern der Gegenwart. Denn gerade die Ostdeutschen wissen, wie man lebt, wenn die großen Erzählungen zerbrechen. Sie wissen, wie man neu anfängt, auch wenn einem niemand den Weg zeigt, und dass Heimat nichts Statisches ist, sondern etwas, das man sich täglich neu erarbeiten muss.
Damit ist der Osten heute zur unerwarteten Avantgarde geworden. Zur Speerspitze einer Erfahrung, die bald alle teilen werden. Nämlich dass Sicherheit eine Illusion war und dass wahre Resilienz aus der Fähigkeit zum Neuanfang erwächst.

Diese Kompetenz wird jetzt gebraucht. Nicht nur im Osten, sondern überall. Denn die Gewissheiten, an die der Westen mehr als 30 Jahre lang glaubte, kehren nicht zurück. Die Globalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Die geopolitischen Verschiebungen kann man nicht aufhalten, die wirtschaftlichen Umbrüche nicht ignorieren.
Vom Ende der Belehrungen
Als ich das Theater Ost verlasse, spüre ich eine seltsame Hoffnung. Nicht Triumphgefühl darüber, dass jetzt auch den Wessis der Boden unter den Füßen wackelt. Sondern die Hoffnung, dass wir endlich auf Augenhöhe reden können und gemeinsam verstehen, dass wir Brücken bauen müssen, anstatt noch mehr einzureißen.
Mehr als 30 Jahre lang lebten wir in parallelen Realitäten. Der Westen in seiner Siegererzählung, der Osten in Transformationserschöpfung. Jetzt teilen wir eine gemeinsame Erfahrung. Die Erfahrung der Fragilität. Die Erkenntnis, dass Sicherheit eine Illusion war. Dass Stabilität nichts Naturgegebenes ist.
Die „Westalgie“ ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist der Beginn einer notwendigen Ernüchterung. Und vielleicht der Anfang einer ehrlicheren, einer gleichberechtigteren deutschen Debatte. Einer Debatte, in der der Westen endlich zuhört und der Osten endlich gehört wird.
Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de
Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: