Nun ist der Deal zwischen den USA und der EU perfekt. Wobei das Adjektiv „perfekt“ wohl nur aus US-Sicht gilt. Denn für die Europäische Union dürfte das mit Washington ausgehandelte Abkommen deutlich negative Auswirkungen haben. Das zeigen nicht nur die gemischten Reaktionen aus Deutschland, dessen Regierung maßgeblich hinter dem Brüsseler Einknicken vor Trump steht, sondern vor allem die Stimmen aus stärker souveränistisch agierenden Staaten, etwa Frankreich. Ministerpräsident François Bayrou bezeichnete den Deal entsprechend als „schwarzen Tag“ für Europa. Denn, so Bayrou, „eine Allianz freier Menschen, die durch gemeinsame Werte verbunden sind, und gemeinsame Interessen verteidigen, entschied sich, nachzugeben“.
Mit dem Deal könnten auch die möglichen ökonomischen Impulse, die sich europäische Regierungen von den im Juni beim Nato-Gipfel in Brüssel beschlossenen kräftigen Steigerungen der Rüstungsausgaben versprechen, abermals abgeschwächt werden. Die Konjunkturimpulse werden zwar als begleitende Begründung für den massiven Aufrüstungskurs gerne vorgebracht – als antizyklische, faktisch keynesianische Wirtschaftspolitik. Im Februar dieses Jahres veröffentlichte etwa das von Bund und Ländern finanzierte Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) eine Studie, in der es hieß, eine Steigerung der Rüstungsausgaben von zwei auf 3,5 Prozent des BIP könnte zusätzliches Wachstum zwischen 0,9 bis 1,5 Prozent erzeugen. Bedingung sei, dass die Investitionen auf dem Kontinent verblieben und nicht in die USA gingen. Freilich argumentieren auch die Rüstungskonzerne, ihre Stärkung sei zugleich ein Booster für die Gesamtökonomie. „Rüstungsausgaben sind ein gigantisches Konjunkturprogramm“, sagte im März 2025 der Chef des deutschen Rüstungsunternehmens Hensoldt, Oliver Dörre, auf einer Veranstaltung in Frankfurt.
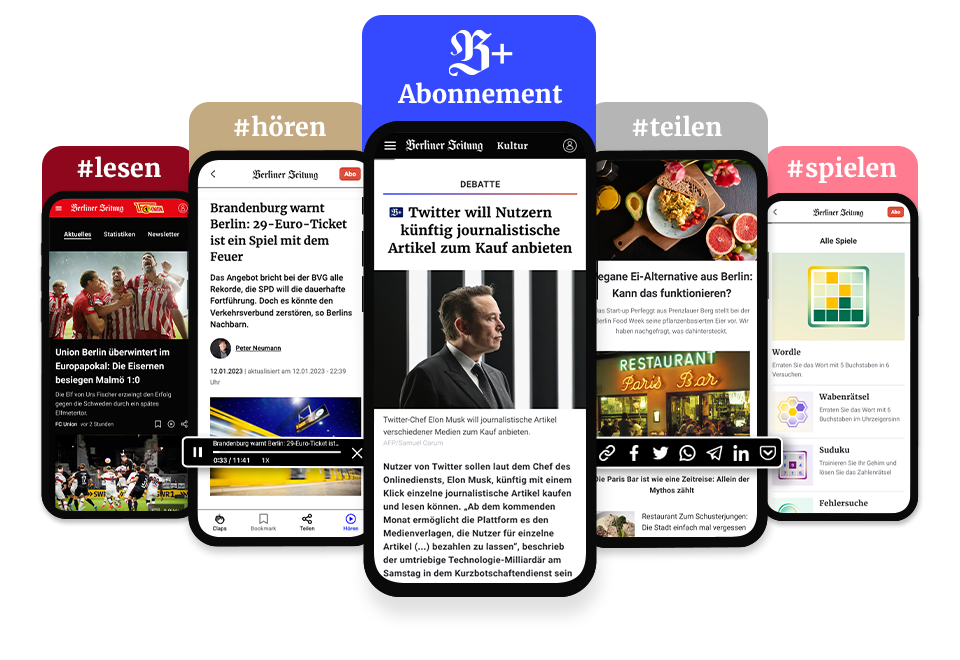
Mit einem Abo weiterlesen
- Zugriff auf alle B+ Inhalte
- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen
- Jederzeit kündbar
Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an
Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop
