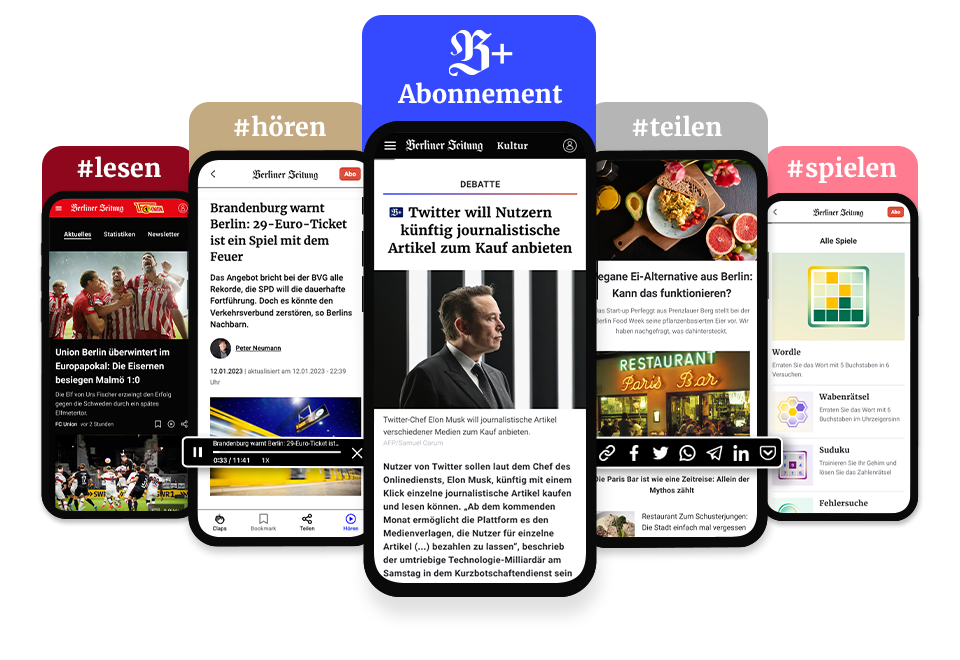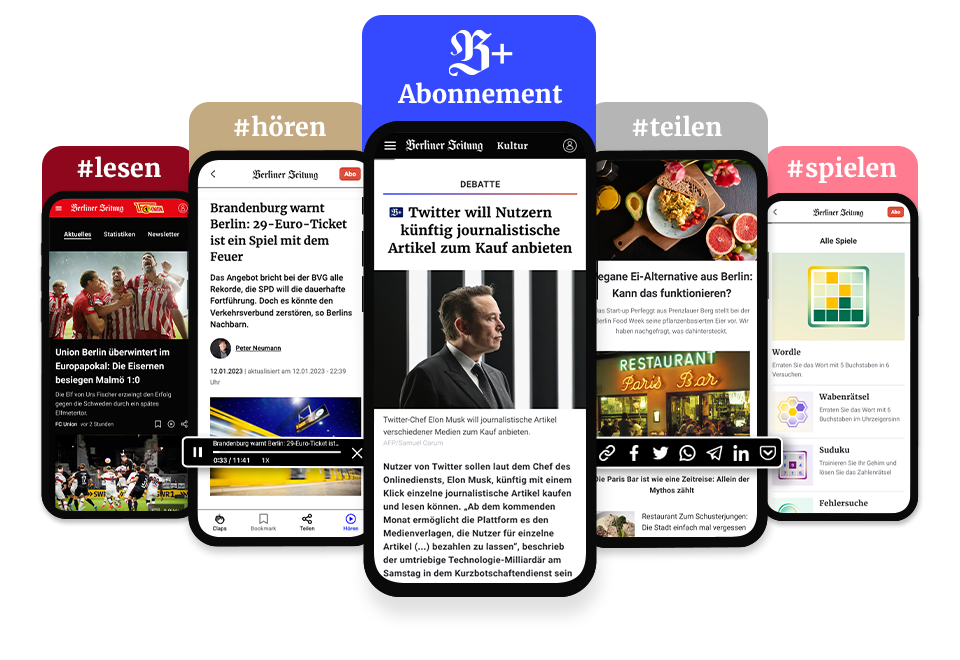
Mit einem Abo weiterlesen
- Zugriff auf alle B+ Inhalte
- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen
- Jederzeit kündbar
Schwein und Rind essen wir Deutschen ja gerne, dabei hat auch die Ziege geschmacklich sehr viel zu bieten. Hier unser Rezept für Zicklein geschmort in märkischem Cidre.