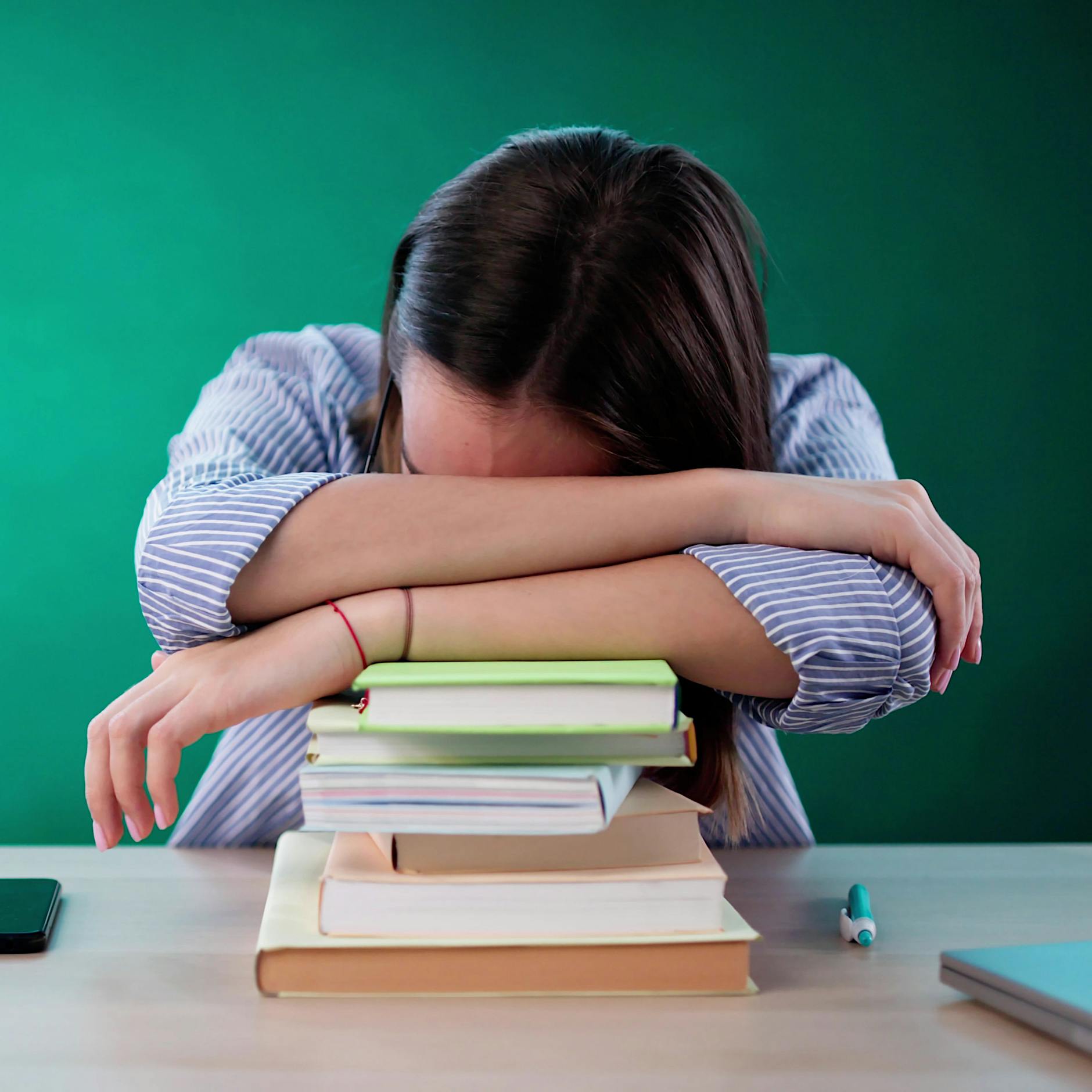Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Deutschlands Schulen wird ein Gewaltproblem attestiert. 27.470 Vorfälle wurden 2023 bundesweit gemeldet, das sind 27 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Diese Zahlen sind ein Alarmsignal, das nicht überhört werden darf. Und nicht nur Schülerinnen und Schüler werden Opfer von Gewalt, sondern in wachsendem Ausmaß auch Lehrkräfte.
Einer Umfrage des Philologenverbandes Nordrhein-Westfalen (PhV NRW) zufolge waren allein in NRW fast jede zweite Gymnasiallehrkraft und mehr als drei Viertel der Lehrkräfte an Gesamtschulen in den vergangenen Jahren persönlich von Gewalt betroffen. An über 65 Prozent der Schulen in Deutschland kam es in den letzten fünf Jahren zu psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte, an 35 Prozent sogar zu physischer Gewalt – die Tendenz steigt.
Lehrkräfte leiden unter den psychologischen Folgen
Diese Entwicklung ist kein Randphänomen, sondern oft schon Alltag an vielen deutschen Schulen: Cybermobbing, Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen – die Liste der Übergriffe ist lang und reicht bis zu körperlichen Angriffen. Allein in Niedersachsen berichten 70 Prozent der Lehrkräfte von verbaler Gewalt, jeder Fünfte hat körperliche Übergriffe erlebt, wie eine Umfrage des Niedersächsischen Landesverbandes (PhVN) aufzeigt. Besonders alarmierend: Ein Drittel der Betroffenen leidet „sehr stark“ unter den psychischen Folgen, bis hin zu Depressionen.
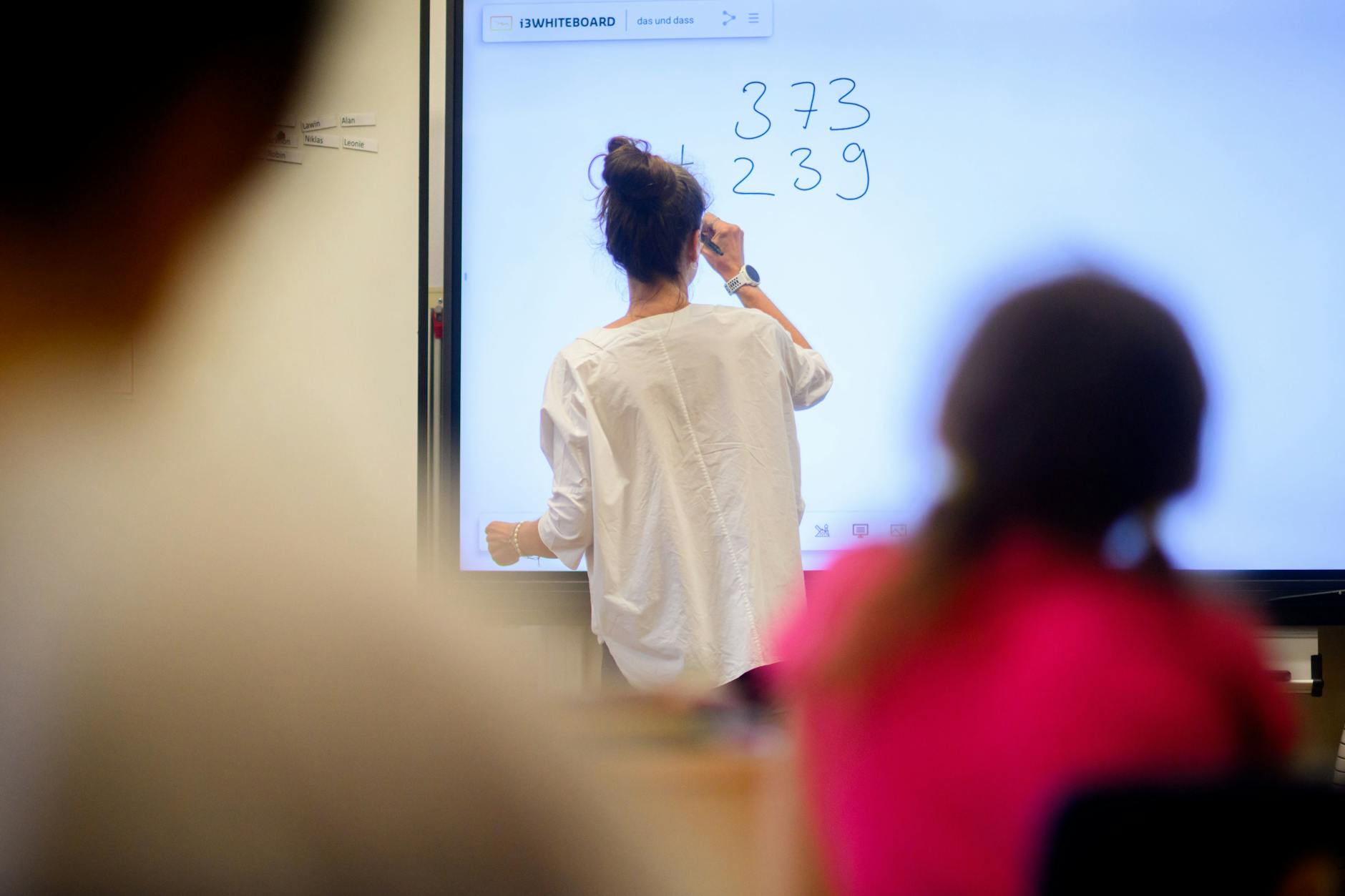
Immer mehr Lehrer denken ans Aufgeben
Was bedeutet das für den Beruf der Lehrkraft, vor allem in Zeiten des Lehrkräftemangels? Die Attraktivität des Berufs sinkt. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen denken ans Aufgeben oder verlassen den Schuldienst – nicht zuletzt wegen der mangelnden Unterstützung durch die Schulbehörden. Während Eltern häufig und umgehend rechtliche Schritte gegen Lehrkräfte einleiten, sobald der Verdacht auf Gewalt gegenüber ihren Kindern besteht, fehlt eine vergleichbare Konsequenz bei Gewalt gegen Lehrkräfte. Und während ein gewalttätiger Schüler oft nur verwarnt wird, erfährt eine Lehrkraft eine Versetzung aus Sicherheitsgründen. Das ist eine eklatante Schieflage, die dringend korrigiert werden muss.
Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat nun einen Leitfaden zu „Gewalterfahrungen an Schulen“ für Lehrkräfte und Schulpersonal herausgegeben. Das ist gut, aber die Handlungsanweisungen darin sind weder neu noch – aus unserer Sicht – erfolgversprechend genug. So wird empfohlen, in bedrohlichen Situationen „Halt! Stopp!“ zu rufen – eine Maßnahme, die schon Kindergartenkindern zur Schlichtung und Grenzensetzung beigebracht wird und bereits in diesem Kontext schnell an Wirkung verliert – oder die Flucht zu ergreifen. Vor allem aber bieten die veröffentlichten Handlungsanweisungen in der Praxis keine ausreichende Rückendeckung bei der Ahndung von Gewaltvorfällen.
Bei Übergriffen von Schülerinnen und Schülern auf Lehrkräfte agieren die zuständigen Behörden oft zögerlich. Auch der Meldeweg über die Schulleitung erweist sich als problematisch, da diese häufig ohne juristische Expertise und nach subjektivem Ermessen über die Schwere des Vorfalls und die Notwendigkeit einer Weitermeldung entscheidet. Zudem besteht die Befürchtung, dass manche Schulleitungen aus Sorge um den Ruf ihrer Einrichtung Vorfälle nicht adäquat weiterleiten.
In den seltenen Fällen, in denen eine Meldung an die übergeordnete Behörde erfolgt, findet eine erneute Bewertung des Vorfalls statt. Diese Praxis führt dazu, dass die Behörde nahezu nie eine Anzeige gegen die betroffenen Schülerinnen und Schüler unterstützt, in manchen Fällen auch aus Angst vor einer Klage der Eltern. Folglich sind Lehrkräfte gezwungen, private Anzeigen zu erstatten, die von der Staatsanwaltschaft häufig nicht weiterverfolgt werden. Das macht Schulen handlungsunfähig und verhindert – auch exemplarischen – Opferschutz.

Präventionsarbeit reicht nicht aus
Natürlich, es gibt Präventionsprogramme, Notfallordner, Beratungsangebote und Schulsozialarbeit. Viele Schulen engagieren sich vorbildlich, entwickeln Schutzkonzepte, setzen auf Streitschlichtung und soziale Kompetenzförderung. Man lernt, sich nicht zu schlagen und nicht zu schreien, um andere zu überzeugen, sondern zu argumentieren. Man lebt eine positive Streitkultur, als Baustein und Basis – zum einen für Demokratie, aber auch, für ein gewaltfreies Zusammenleben.
Doch das reicht nicht aus, solange die personellen Ressourcen fehlen und die Unterstützung durch die Schulbehörden lückenhaft bleibt. Es mangelt an schulpsychologischem und sozialarbeitendem Personal, an multiprofessionellen Teams, die Lehrkräfte in Krisensituationen entlasten könnten. Präventionsarbeit ist wichtig – aber sie darf nicht als Feigenblatt dienen, während die Betroffenen im Ernstfall allein gelassen werden.
Was braucht es also? Die Länder müssen endlich entschlossen handeln und den Schutz der Lehrkräfte zur Chefsache machen. Es braucht zentrale, unabhängige Anlaufstellen in jedem Bundesland, an die sich Lehrkräfte bei Gewaltvorfällen direkt und vertraulich wenden können. Bei körperlichen Übergriffen muss die zuständige Behörde umgehend Strafanzeige stellen – dieser Vorgang darf nicht auf die Lehrkraft abgewälzt werden.
Es braucht klare Leitlinien und Sensibilisierung der Schulleitungen, damit sie Vorfälle konsequent weiterleiten und Betroffene unterstützen. Und letztlich ist auch ein professionelles Betreuungssystem mit psychologisch geschultem Fachpersonal unerlässlich, um die Folgen von Gewalt aufzuarbeiten und Dienstunfähigkeit zu verhindern.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.