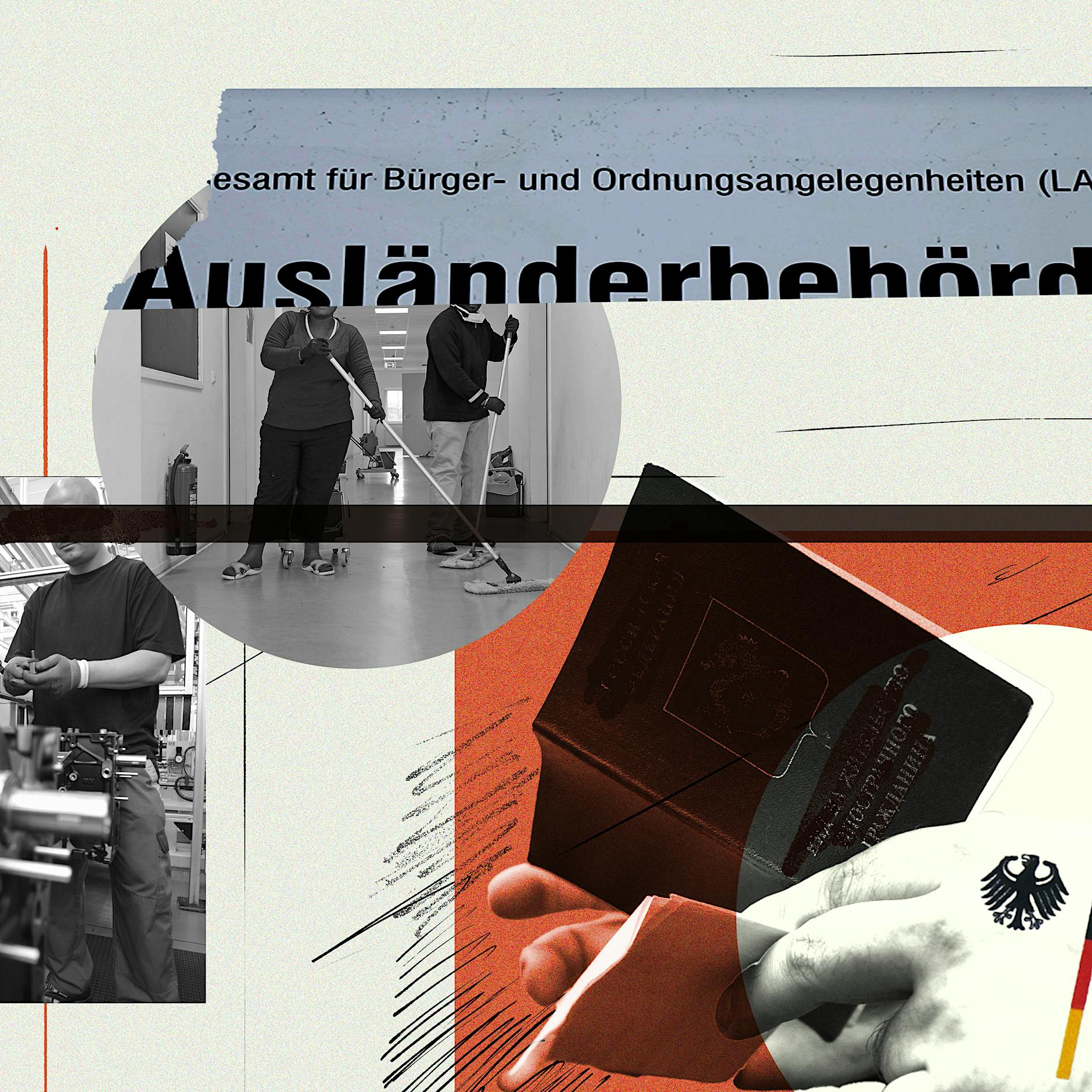Die Europäische Kommission wollte ursprünglich an diesem Mittwoch mitteilen, welche Mitgliedstaaten als „unter Migrationsdruck“ stehend eingestuft werden und somit Anspruch auf finanzielle oder personelle Unterstützung haben. Laut Politico wird diese Entscheidung nun zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest.
EU-Migrationskommissar Magnus Brunner begründete die Verzögerung mit der Komplexität des neuen Verfahrens. „Es ist das erste Mal, dass wir diese Übung machen – das ist nicht einfach“, sagte er am Dienstag in Luxemburg. Wichtig sei, „dass es funktioniert“, nicht, „ob es ein paar Tage früher oder später“ passiere.
Viele EU-Staaten wollen lieber zahlen als Migranten aufnehmen
Das neue EU-Asyl- und Migrationspaket, das 2023 beschlossen wurde und bis Juni 2026 umgesetzt werden soll, verpflichtet die Mitgliedstaaten, Länder mit besonders hoher Belastung zu unterstützen – entweder durch die Aufnahme von Asylsuchenden oder durch Geldzahlungen und Personalhilfe. Besonders Italien und Griechenland gelten als wahrscheinliche Empfängerländer.
Mehrere Regierungen machten in Luxemburg deutlich, dass sie eher bereit seien, Geld zu zahlen als zusätzliche Migranten aufzunehmen. Belgien erklärte, sein Aufnahmesystem sei „voll“, Finnland und die Niederlande wollen laut Politico ebenfalls keine weiteren Asylsuchenden übernehmen.
Beobachter warnen, dass eine ausbleibende Einigung die Glaubwürdigkeit des neuen Systems gefährden könnte. „Wenn die Mitgliedstaaten die vereinbarten Regeln nicht umsetzen, untergräbt dies das gemeinsame europäische Asylsystem“, sagte der Migrationsexperte Alberto-Horst Neidhardt vom European Policy Centre gegenüber Politico. In einem solchen Szenario drohten verstärkte Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums und ein weiterer Auftrieb für rechtspopulistische Parteien.