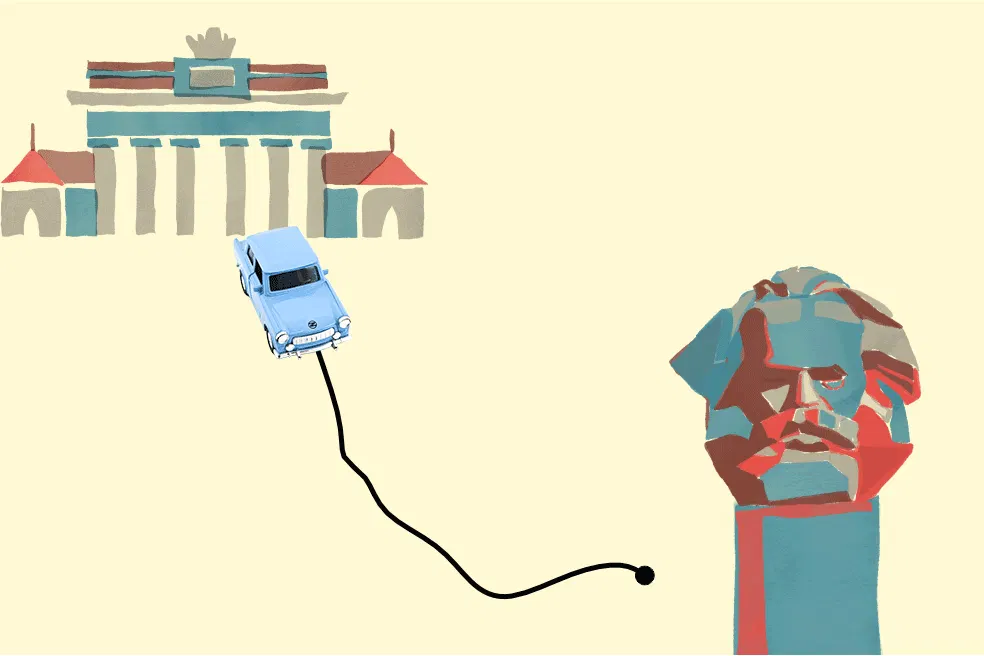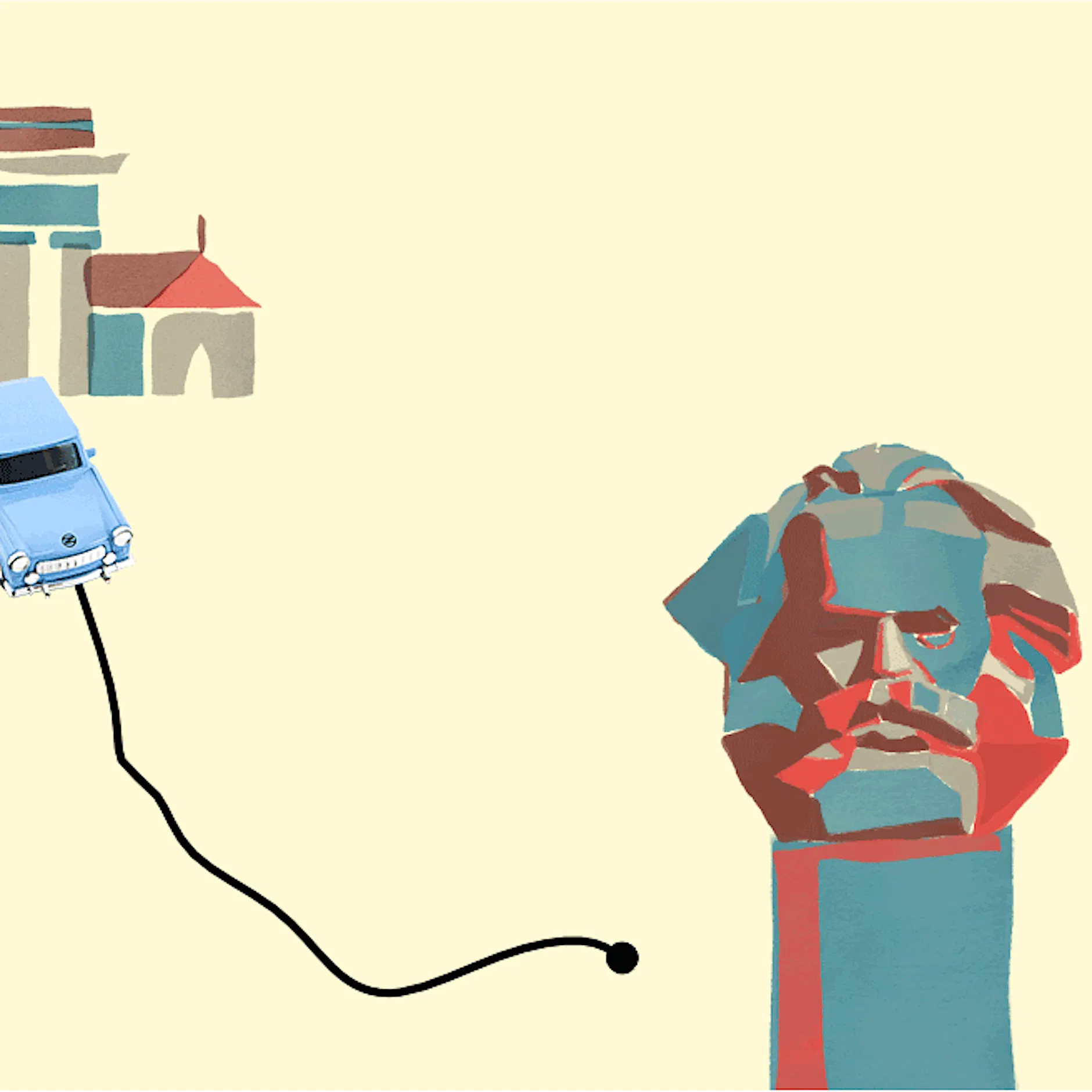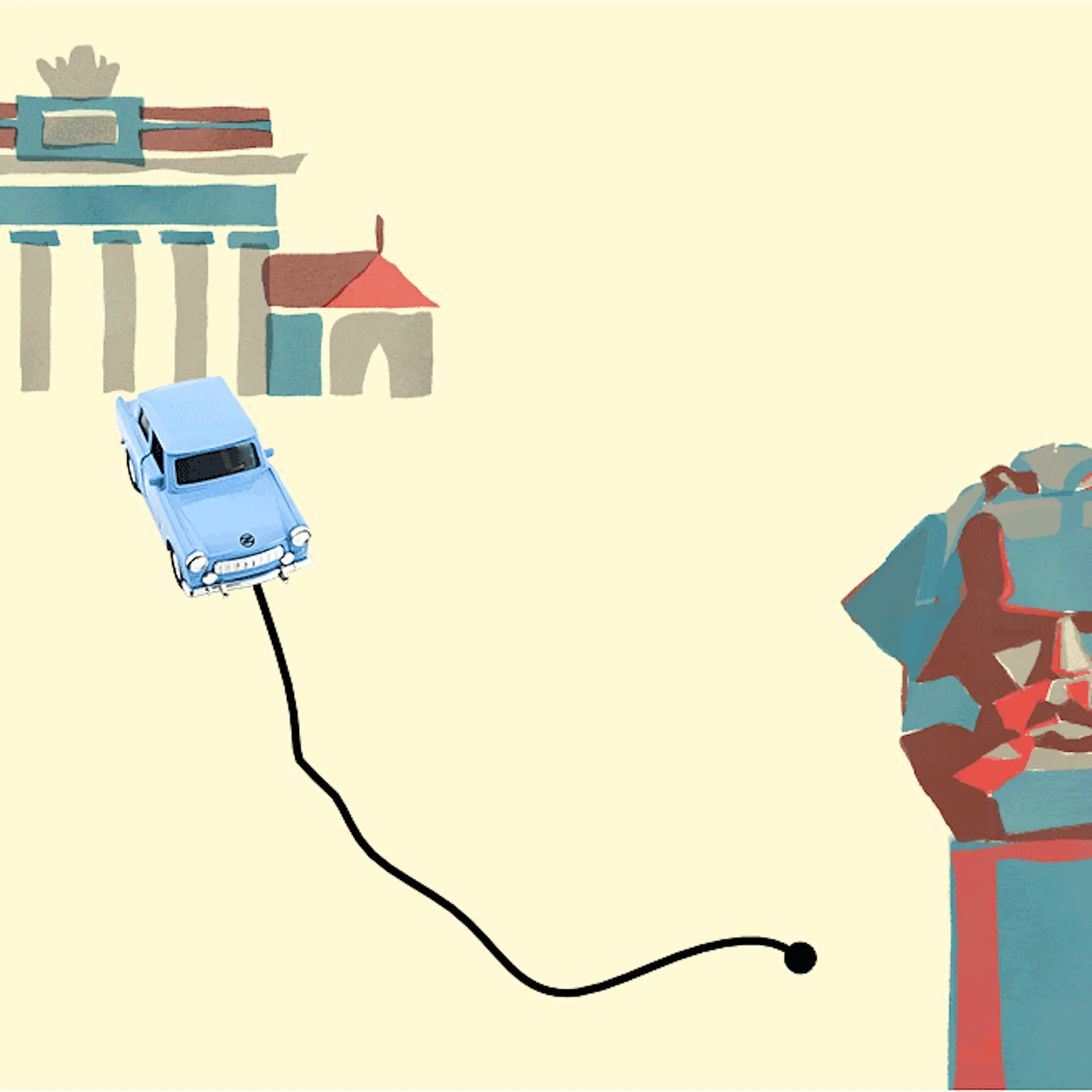Heimat ist ein seelisches Sicherheitsnetz. Oder so ein undefinierbar gutes Gefühl, das Halt gibt. Wer fällt, fällt nicht durch, verfängt sich, landet weich. Auf Heimat ist einfach Verlass. Man wird da hineingeboren, arglos hineingeworfen, wird geformt, wird geprägt, es entsteht eine schier unzertrennliche Beziehung zwischen Mensch und Raum. Und dann und wann öffnen sich immer mehr Zwischenräume, in die immer mehr Zwischenmenschliches passt.
Die Welt bleibt erst mal heil, die Bande sind fest geknüpft. Alles scheint einzigartig, vertrauensvoll und verständlich zu sein. Und nichts deutet darauf hin, dass sich daran etwas ändern könnte. Es gibt also Gründe dafür, warum der Duden beim Schlagwort „Heimat“ gleich den Hinweis mitliefert: „Plural nicht üblich.“ Unüblich ist Heimatverlust trotzdem nicht. Plötzlich Unsicherheit. Wo ist das Netz? Wo baumelt die Seele hin? Privilegien? Check.
Seit vier Monaten lebe ich nicht mehr in Berlin und neulich verspürte ich zum ersten Mal Heimweh, eine verspätete Verlustangst, gefolgt von der Erkenntnis, nicht mehr dazuzugehören, etwas aufgegeben zu haben, das mir wohlig und wohlstandmadig warm vertraut war, einen Sinn, eine Identität oder wenigstens eine Ahnung davon stiftete. Auf einmal vermisste ich den Berliner Straßenlärm, den Kiezdreck, meine Freunde, den Spätkaufverkäufer, den Schienenersatzverkehr, dieses Leben ohne Schließzeiten und immer volle Farbpalette voraus. Ich holte mir die schönsten Berlinbilder in den Kopf, an denen ich vor dem Einschlafen hätte weitermalen können.
Und das alles nur, weil ich die Kofferraumklappe geschlossen und dadurch das Kennzeichen sichtbar gemacht hatte für das hinter uns parkende Auto. Ein Mann stieg aus, zeigte auf das C und grüßte: „Hallo, Heimat.“ Auch er kam aus Chemnitz.
Das H-Wort ist kontaminiert, verbrannt, verbales Leergut
Wir waren im Urlaub, wir waren in Österreich, Kühe, Zäune, Hütten, zwei Autos aus derselben Stadt vor einem einsamen Berg – was für ein Zufall. „Das C ist eine Lüge! Ich bin ein Heimatschwindler! Ich komme aus Berlin! Dickes B!“, hätte ich am liebsten geschrien. Doch manchmal ist es bekanntlich besser, zweimal nachzudenken, bevor man nichts sagt.
Also lächelte ich nur und dachte trotzig: Heimat ist doch ein überholtes Konzept. Das H-Wort ist kontaminiert, verbrannt, verbales Leergut. Heimat ist was für die CSU und schlimmer, für diese Menschen, die unsere Zukunft mit einer Energie aus der Vergangenheit aufladen wollen. „Heimat“, fand ja auch schon Martin Walser, „das ist sicher der schönste Name für Zurückgebliebenheit.“ Und zurückgeblieben, das sind diejenigen, die sich nie bewegen, weder räumlich noch geistig. Ich doch nicht! Ich habe mich doch bewegt! Von B nach C mit allen Konsequenzen.
Ein paar Tage später, zurück in Chemnitz, wurde es mir wieder heimelig zumute. Wegen Jutta Müller, 93, der früheren Eiskunstlauftrainerin, die Katarina Witt groß und größer und zur zweifachen Olympiasiegerin gemacht hatte. Ich las, dass Müller aus gesundheitlichen Gründen ihre Geburtsstadt Chemnitz verlassen hat. Ihre in Berlin lebende Tochter sagte: „Chemnitz war ihre Heimat. Dort wollte sie nicht weg.“ Nun musste sie in ein Pflegeheim nach Bernau ziehen.
Ich stellte mir vor, wie Jutta Müller dort aus dem Fenster schaute und die Welt nicht mehr wiedererkannte. Wie sie Chemnitz vermisste. Und daran scheiterte, Heimat im Plural zu denken.