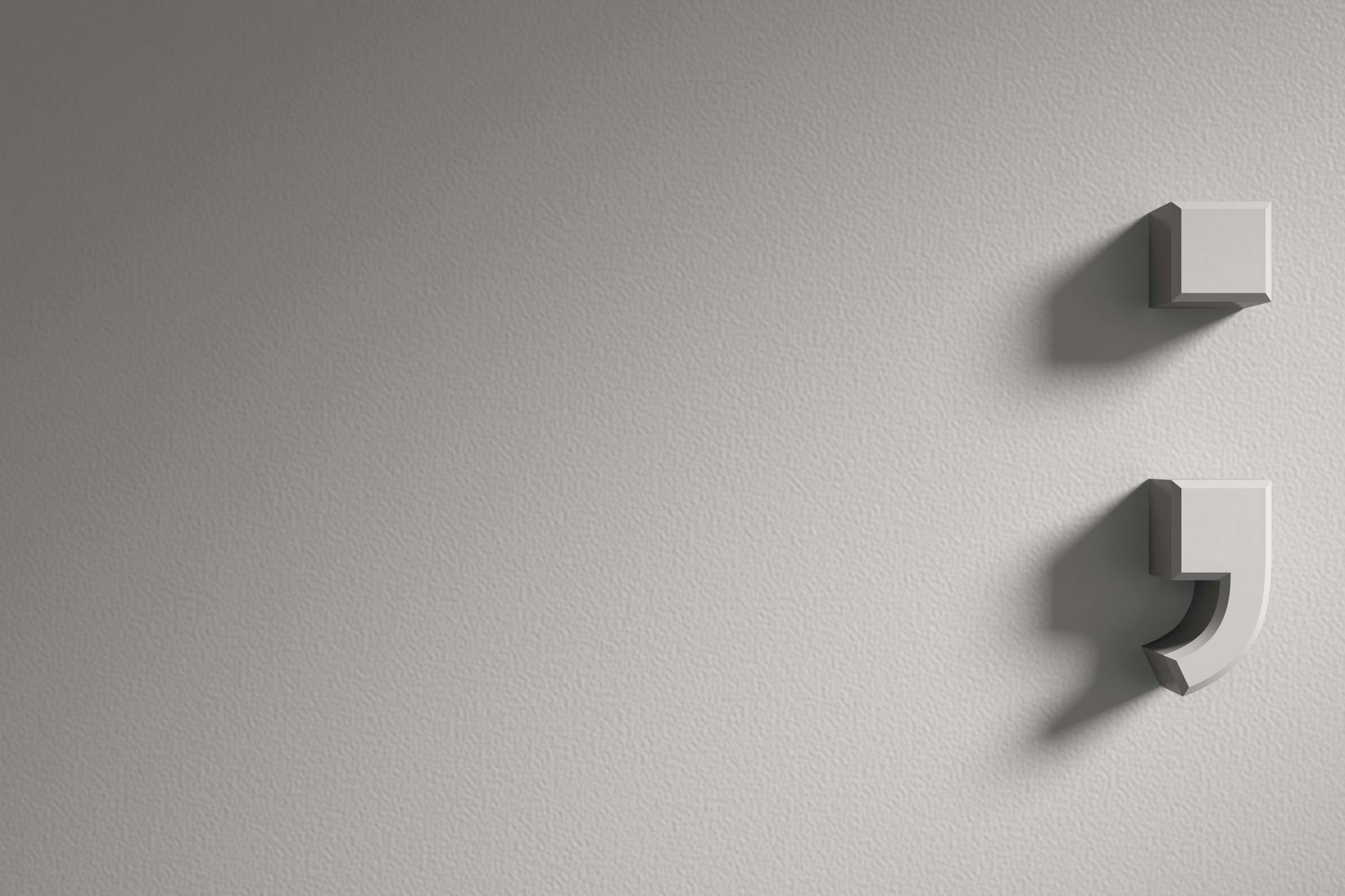Die Satzzeichen stehen gleichberechtigt nebeneinander; doch manche werden diskriminiert! Unschuldiges Opfer ist das Semikolon; lesen Sie das Drama vom tragischen Niedergang eines zarten, aber ausdrucksstarken, zweiteiligen und damit besonders instabilen angreifbaren Dings.
Über seine mögliche Rettung sprach ich mit Dr. Melanie Kunkel von der Dudenredaktion; sie war äußerst angetan, als ich das Thema an sie herantrug. Sei das 1494 von dem venezianischen Drucker Aldus Manutius erfundene Satzzeichen heute doch zu Unrecht vernachlässigt; es gebe Texten Abwechslung, Vielfalt, eine gewisse Nuance, eine persönliche Note; schön wäre es, es ein wenig zu befreien aus der Vergessenheit.
In einem Konferenzraum der Dudenredaktion (im Vorraum viele sonnengelbe Hinweise auf das unsere Gesellschaft regierende Markenprodukt) legte mir Melanie Kunkel Beweise vom Niedergang des Semikolons vor.
Die Germanisten Kristian Berg und Jonas Romstadt, Universität Bonn, untersuchten für ihren Aufsatz „Reifeprüfung – Das Komma in Abituraufsätzen von 1948 bis heute“ (Erich-Schmidt-Verlag, Berlin) 1398 Arbeiten; sie wurden an einem niedersächsischen Gymnasium geschrieben. Schockierendes Ergebnis: Heute kommen Semikolons nur noch durchschnittlich einmal alle 4000 Wörter vor. Ihr Gebrauch ist gegenüber den 1950er-Jahren um knapp 75 Prozent zurückgegangen.
Was sind die Ursachen? Sind zu wenige dieser Satzzeichen vorhanden? Gilt es das Semikolon zu Recht als schwierig? Die erste Frage beantwortet Melanie Kunkel beschwichtigend. Es seien genügend Semikolons vorhanden; sie wüchsen ständig – auch trotz weltweiter Klimaerhitzung – nach; das Gerücht, der Dichter Thomas Mann habe alle aufgebraucht, sei üble Nachrede.
Die zweite Frage hingegen scheint in die richtige Richtung zu weisen; Melanie Kunkel bestätigt die Eigenwilligkeit des Semikolons; heikel und kitzlig sei die Entscheidung dafür; es gehe um Ästhetik beim „Komma der Feuilletonistinnen und Feuilletonisten“.
In der Wiederansiedlung des Semikolons solle man vorbereitet vorgehen, schlägt Melanie Kunkel vor; Hilfestellung könne vielleicht das Ratgeberbuch „Komma, Punkt und alle anderen Satzzeichen“ (erschienen im Dudenverlag) geben.
Komma oder Semikolon – es ist kompliziert
Einleitend heißt es dort über das Semikolon: „Es steht anstelle eines Kommas, wenn dieses in seiner trennenden Funktion innerhalb eines Satzes zu schwach trennt; es steht anstelle eines Punktes, wenn dieser zu stark trennt. Wann das der Fall ist, lässt sich nicht eindeutig festlegen.“ Es ist also kompliziert.
Möglich jedenfalls ist das Semikolon sowohl zwischen gleichrangigen Sätzen als auch bei Aufzählungen, deren innere Gliederung verdeutlicht wird.