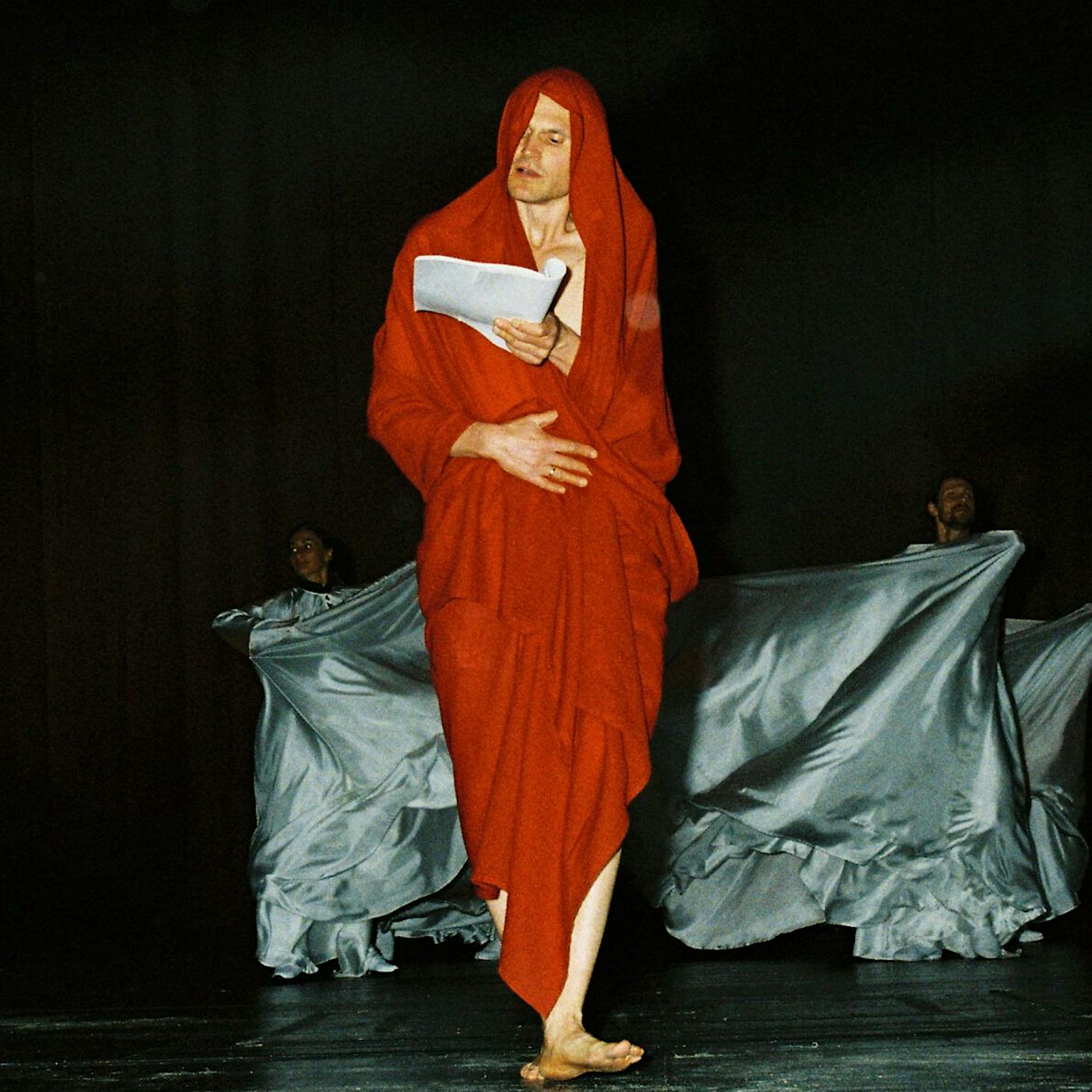Auf den ersten Blick hatten die Werke des von Ingo Metzmacher dirigierten Konzerts des Deutschen Symphonie-Orchesters am Sonntag in der Philharmonie nichts miteinander zu tun: Einer Uraufführung des ehemaligen Hannoveraner Kompositionsprofessors Anton Plate folgte das Klavierkonzert von Max Reger, „Harmonielehre“ von John Adams stand am Schluss.
Schnell hört man jedoch, dass alle drei Komponisten einer Ästhetik des Überflusses und Überbordens huldigen. Bei Max Reger ist das hinter einer unauffälligen Orchesterbesetzung wie bei Brahms versteckt – aber umso exzessiver ist die Komposition selbst in ihrem unausgesetzten Modulieren und polyphonen Verdichten eines kaum erinnerbaren Themenmaterials. Als Peter Serkin das Werk in den späten Neunzigern mit den Philharmonikern aufführte, musste man danach Blut von der Tastatur wischen.
Markus Becker, seit seiner Gesamtaufnahme von Regers Klavierwerk einer der hidden champions unter den Pianisten, übersteht die Akkordtürme und Oktavpassagen unverletzt trotz zuweilen dramatischen Krafteinsatzes. Diese 1910 entstandene und lange völlig vermauerte Musik wird allmählich zugänglicher. Metzmacher und Becker zeigen, dass der harmonisch-kontrapunktische Vermittlungseifer in Wirklichkeit kaschiert, wie fragmentiert Regers Espressivo ist – im kargen Largo wird das deutlich. Mithilfe einiger Choralzitate soll konkret werden, was die Gesten spätromantischer Idyllik unter der Hand des so ungeschlachten wie hochsensiblen Komponisten schon nicht mehr vermitteln können. Dass Becker nach dem Gedonner noch die Leichtigkeit für ein Haydn-Rondo aufbringen kann, zeigt seine pianistische Sonderklasse.
Regers Üppigkeit wurzelt in seiner seelischen Disposition
Wurzelt Regers Üppigkeit in seiner seelischen Disposition, so fällt es schwer, die von John Adams nicht mit den weiten Landschaften und dem Kapitalismus seiner Heimat USA zu verbinden: Es herrscht ein Flächen- und Mittelverbrauch, der jedes Konzentrations-Ideal verabschiedet – wo Reger die Harmonie mit jedem Achtel wechselt, bleibt sie bei Adams über zig Takte liegen. Bis heute hat das 1980 geschriebene Stück nichts von seiner Kraft, Originalität und Ausdrucksgewalt verloren. Metzmacher und das DSO beschwören sie mit elementarer Gewalt.