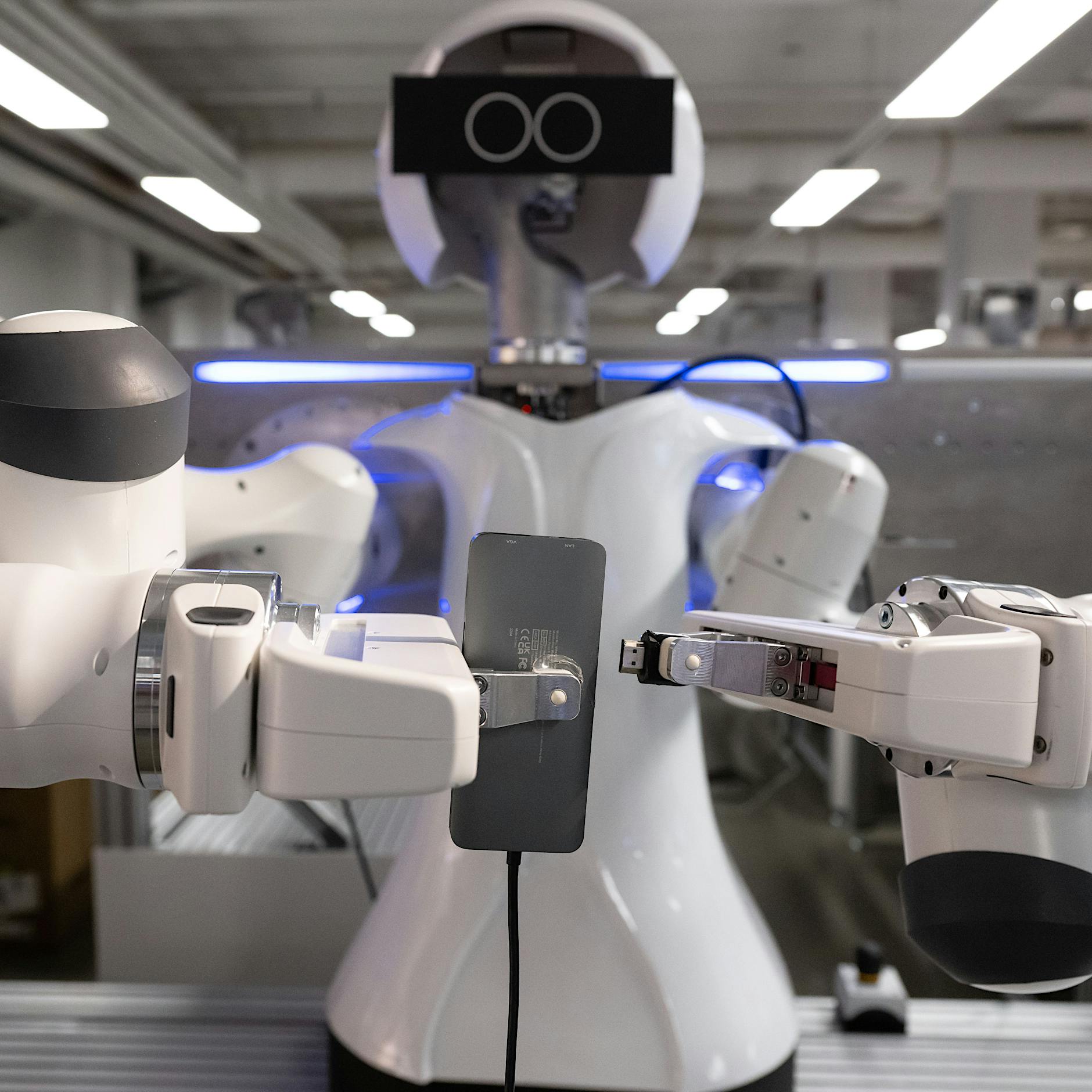Man kann es als eine gewiefte Antwort auf die derzeit wie elektrisiert geführte Debatte über Künstliche Intelligenz betrachten. Gegen die vielfältig beschworene Ohnmacht gegenüber den diabolischen Hervorbringungen technologischer Entwicklungen, die vor allem in der Sorge besteht, menschliche und künstliche Kreativität nicht voneinander unterscheiden zu können, hat der Berliner Fotograf Boris Eldagsen einen Fälschungscoup gelandet. Er hat einen begehrten Preis für Fotokunst, den Sony World Photography Award, für sein Werk „Pseudomnesia: The Electrician“ abgelehnt, weil die Jury eine teilweise mit KI erzeugte Arbeit prämiert hat. Ein Hoax also, eine bewusste Irreführung, um eine Debatte über die Rolle der KI in der Fotografie anzustoßen.
Natürlich läuft die schon, und nicht erst, seit wir bildliche Darstellungen von Papst Franziskus in einer coolen Daunenjacke und einen rauflustigen Donald Trump gesehen haben, wie er sich gegen die polizeiliche Verhaftung zur Wehr setzt. Die Fragen nach Differenz, Ähnlichkeit und technischer Reproduzierbarkeit bestimmen seit jeher die moderne Ikonografie. Die TV-Zeitschrift Hörzu hat sich diese bereits in den 1960er-Jahren für das unterhaltsame Bilderrätsel „Original und Fälschung“ zunutze gemacht.
Ein Hoax gegen die künstliche Kreativität
Zweifellos hat Boris Eldagsen, der in der Fotokunst als Solitär gilt, weil er sich keine Schule zurechnen lasse, wie es in einem Biopic auf der Seite einer Kunstgalerie heißt, einen Nerv getroffen. Seine fotografischen Inszenierungen beziehen ihre bildliche Kraft aus der zwischen Authentizität und Suggestion changierenden Rätselhaftigkeit. Was sich Künstler schon immer herausgenommen haben, droht nun zu einem Massenmedium zu werden. Manipulation als soziales Gift und Herrschaftsinstrument. Aber so reflektiert die Handreichungen des Ethikrats zur KI auch sein mögen, werden sie deren Anwendungsdynamik ebenso wenig entgegenzusetzen haben wie der Hoax eines Künstlers wie Boris Eldagsen.