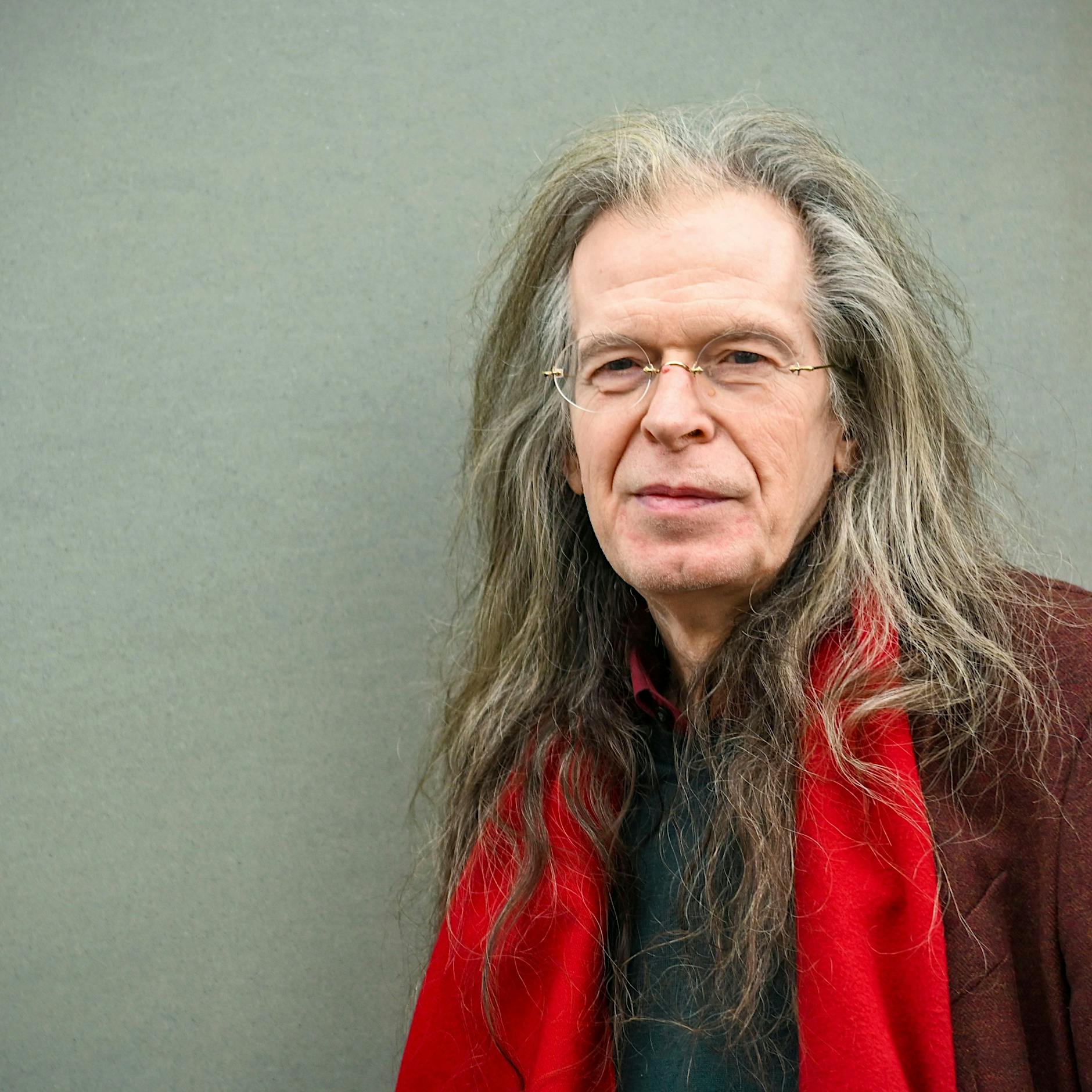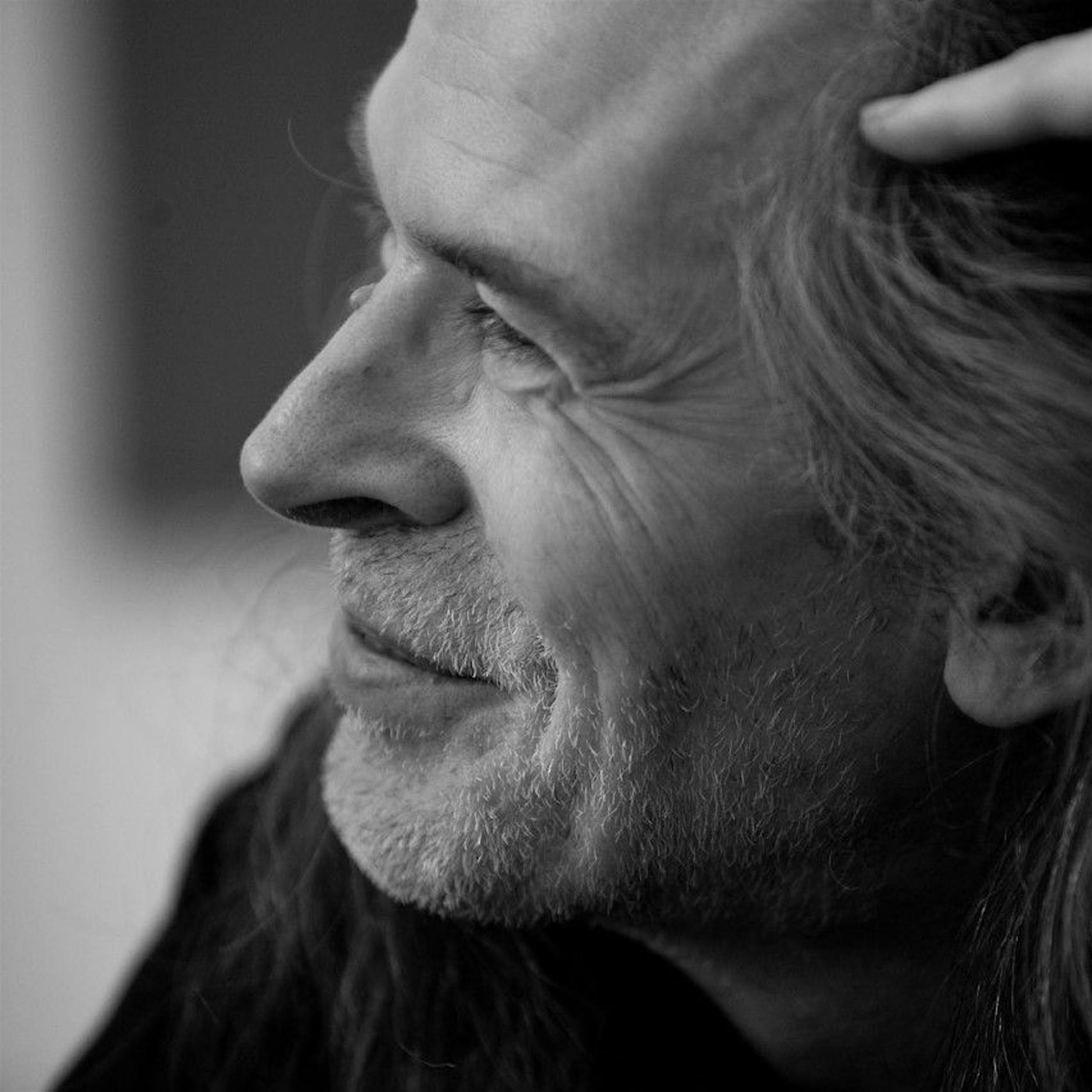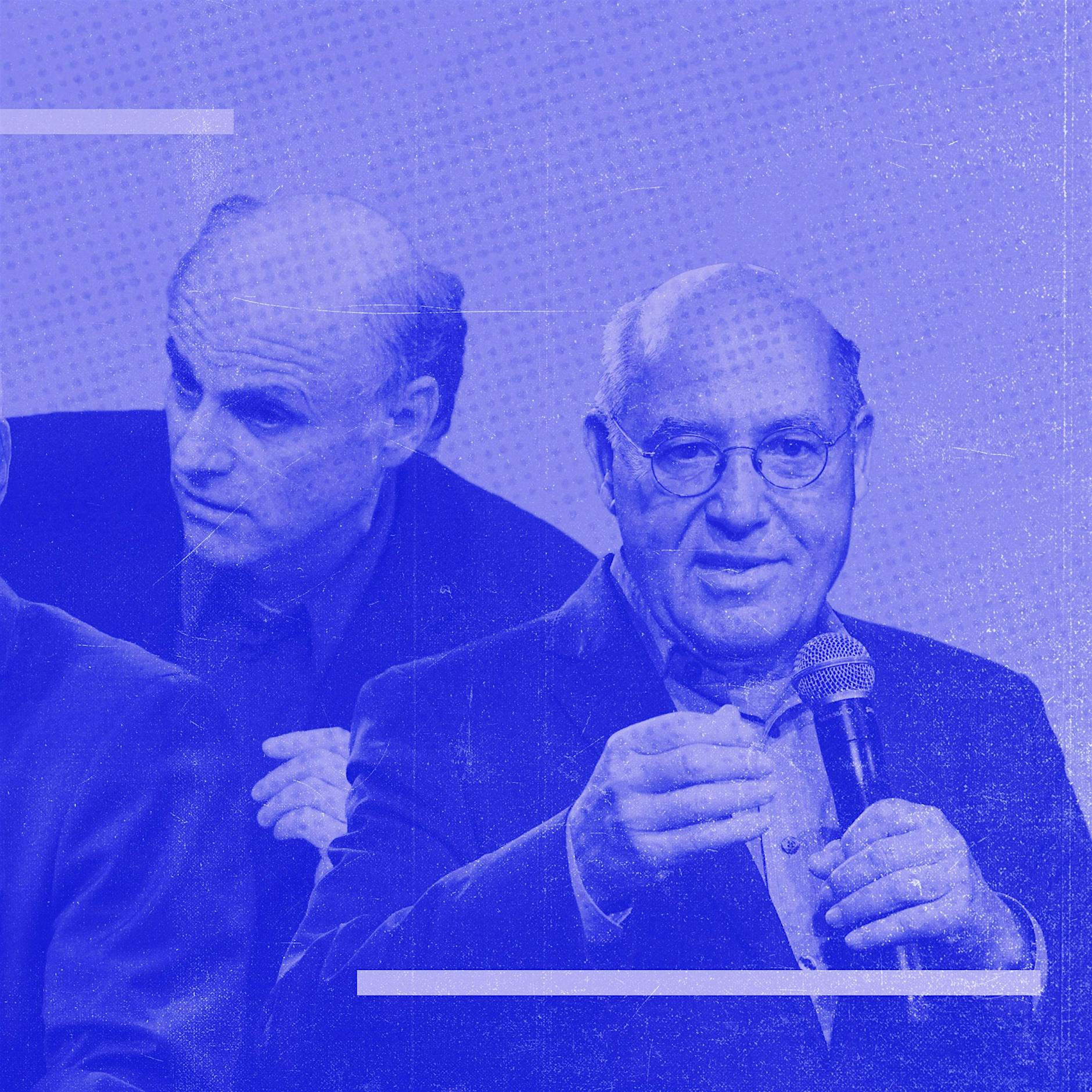Das Kostbarste, das der Mensch besitzt, ist das Leben.
So Nikolai Alexejewitsch Ostrowski, der Autor des Buches „Wie der Stahl gehärtet wurde“, und es klingt ganz vertraut und von früher her. Aber auch ein bisschen peinlich, und der Gedanke, der Herr über die kitschigen Gefühle werden will, sagt sich und mir: Es ließe sich vielleicht doch etwas weniger pathetisch ausdrücken, besonders das Kostbarste, das als Wort so aus der Mode gekommen ist. Lassen wir es, wir sind doch werteorientiert, wertebasiert, das Wertvollste sein.
Doch der intellektuellen Zumutung ist auch damit nicht zu entkommen, denn wie soll der Mensch denn das Leben besitzen, er lebt einfach, so er denn am Leben ist. Aber Sie und ich, wir wissen doch, was damit gemeint ist. Und wir wissen auch, dass das so nicht stimmt. Schon allein der Umstand, dass es uns gesagt werden muss und so erhebende Gefühle auszulösen vermag, wird es uns gesagt, spricht dagegen, dass es wahr ist.
Der Staat verlangt von seinen Untertanen, dass sie seine Existenz für wertvoller halten als ihr eigenes Leben. Der Staat hat auch Gründe dafür, Begründungen, und aktuell wird sie uns die derzeitige ukrainische Staatsführung sicher darlegen können. Die Wehrpflicht gilt auch auf der ukrainischen Seite des Krieges. Kein Mann soll ihr entkommen. Kampf bis zum Sieg oder der heroische Untergang, der Heldentod, der aus einem Feigling, der sich immer nur gedrückt und geduckt hat, wenn die Kugeln flogen, einen Helden macht.
Man kann es so ausdrücken oder auch anders, je nach den Umständen, im Kern geht es immer um einen ganz einfachen Gedanken: Der Einzelne ist Teil einer Gemeinschaft, er kann nur als Teil dieser Gemeinschaft leben und überleben. Was dann eben auch heißt: Die Weiterexistenz der Gemeinschaft besitzt einen höheren Wert als das Leben ihrer einzelnen Mitglieder.
Bandenkrieg und Hooligans: Die Horde lebt auch heute noch fort
Man kann das so oder so formulieren; die Gemeinschaft, um die es jeweils dabei geht, kann die einer Familie sein, eines Clans, eines Stammes, eines Volkes, einer Nation, einer Rasse, einer Klasse, einer Religionsgemeinschaft, einer Sekte, des freien Westens – wäre ich ein akademisch ausgebildeter Anthropologe, ich würde es vielleicht nicht wagen, mit einer so großspurigen Vermutung um die Ecke meines immerwährenden Dilettantismus zu kommen, indem ich sage: Das kommt alles von der Urhorde her. Die es natürlich nicht als die eine ursprüngliche Urhorde gegeben haben wird, von der alle anderen Menschenhorden abstammen – aber was weiß ich das so genau.
Zu Urzeiten, damals, lange ist es her, die Welt war relativ menschenleer, das Leben und Überleben schwer, die Menschheit in kleinen Gruppen unterwegs, aber die Horde lebt auch heute noch fort, in uns, und wir erkennen sie im Bandenkrieg wieder, in den Hooligans, die nach einem Fußballspiel durch die Straßen ziehen.
Die Horde eine Urkonstante menschlichen Zusammenlebens, oder was auch immer – und was als fröhliche, frohgemutete Wissenschaft beginnt, endet bald im Gestrüpp der Begriffe, das Nicht-Wissen der bloßen Vermutung ist größer als das gesicherte Wissen, und wahrscheinlich würden dem sogar die ordentlich akademischen Wissenschaftler zustimmen. Weiter, nur schnell weiter: Was einmal stimmte, dass der Einzelne nur als Teil der Gemeinschaft überleben konnte, stimmt so heute und schon seit einiger Zeit nicht mehr, man kann auch abhauen und sich einer anderen Gemeinschaft anschließen – nicht, dass das immer leicht ist, aber es kann klappen.
Und deshalb braucht der Staat, der seine vielen Einzelnen dazu bringen, dazu auch zwingen will, solche höheren Ideen, denen wir uns dann unterordnen sollen, und auch können, das Volk, die Nation, für die wir unser kleines Menschenleben opfern, weil es eben doch nicht das Wertvollste ist, was dem Menschen gegeben ist. Das Kostbarste. Die Fahne hoch, die Fahne, und ohne Fahne keine Fahnenflucht.
Das Kostbarste, das der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur einmal gegeben, und leben soll er so, dass er im Sterben sagen kann: Mein ganzes Leben und all meine Kräfte habe ich hingegeben für das Schönste der Welt – den Kampf um die Befreiung der Menschheit.
So das vollständige, in meiner Jugend so berühmte Zitat von Nikolai Alexejewitsch Ostrowski, dem sowjetischen Autor, der im Bürgerkrieg Rot gegen Weiß, die Weißen gegen die Roten, gekämpft hat, in Budjonnys Roter Reiterarmee, verwundet wurde, schwer verwundet, auf einem Auge erblindete.
Bei dem ersten, dem humanistisch geprägten Satz, blieb Ostrowski nicht stehen. Das noch Folgende beinhaltet die Aufforderung, für die gute Sache, die schönste der Welt, für die Befreiung der Menschheit zu kämpfen, sich dabei auch totschießen zu lassen. Oder dass man dann wenigstens schwer verwundet vom Schlachtfeld geschleppt wird.
Das Leben, die ganze Kraft hingegeben. Das Kostbarste. Das Wertvollste. Für das Schönste der Welt. Für einen Staat, der sich die humanistischen Werte auf seine Fahne geschrieben hat, ist das ein Problem. In einem Staat, dessen Verfassung vom Einzelnen ausgeht, vom Leben als dem Wertvollsten, das einem Menschen gegeben ist, und zum Leben gehört dann das Wohlleben, die Freiheit und was es sonst noch Schönes im Leben gibt, wird es zu einem unauflösbaren Widerspruch, sollen wir für ihn unser Leben riskieren. Freiwillige vor, aber es gibt eben doch nicht genug davon. Propaganda, damit es ein paar mehr werden, die mit dem freien Willen ihrer Überzeugungen in die Abwehrschlacht gegen den Angriff auf unsere Werte ziehen. Notfalls Zwang. Und der Notfall ist in der Ukraine zum Beispiel sofort erklärt worden. Gewalt. Und der Staat gründet auf Gewalt.
Weltpolitik: Kann der Westen eine multipolare Weltordnung akzeptieren?
Die Frage muss gestellt werden, die Frage muss auch sehr bald beantwortet werden, die Frage danach, ob der Westen eine multipolare Weltordnung akzeptieren kann. Wobei natürlich eine Weltordnung auch immer wieder in Unordnung geraten kann, eine multipolare sicher noch einmal mehr. Es wäre auch, die historische Erfahrung spricht dafür, möglich zu sagen, eine multipolare könne gar keine Weltordnung sein, es wäre dies nur eine Phase der Unordnung, des Übergangs, das heißt: eine der Krisen und Kriege, in der sich ein neuer Hegemon etabliert.
Eine multipolare Weltordnung wäre damit etwas weltgeschichtlich Neues, von dem niemand mit Gewissheit sagen kann, ob es überhaupt zu erreichen ist. Ob es deshalb auch anzustreben wäre. Das stimmt aber, wiederum historisch gesehen, so nicht. Es ist nur sehr lange her, dass es eine multipolare Weltordnung gegeben hat. Hat geben können. China und das Römische Reich konnten als Supermächte ihrer Zeit problemlos miteinander koexistieren. Auch der 1648 in Münster vereinbarte Vertrag, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, der Westfälische Friede, etablierte eine multipolare europäische Ordnung, zu der jedoch gehörte, dass immer weiter Kriege geführt wurden, wenn auch lange auf einem niederen, weil nicht religiös befeuerten Niveau.
Und auch eine bipolare Welt war möglich, im Kalten Krieg zwischen Ost und West, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Alliierten auf der einen Seite, und dem von der Sowjetunion dominierten Ostblock. Basierend auf einem Gleichgewicht des Schreckens. Für ungefähr vierzig Jahre. Die Bipolarität wurde von den USA aufgelöst, als Kissinger und Nixon Beziehungen zur Volksrepublik China aufnahmen, die Volksrepublik China diplomatisch anerkannten, in die UNO holten, in den Sicherheitsrat, und dort den Platz von Taiwan, von Peking als abtrünnige Provinz gesehen, bisher als Republik China als rechtmäßiger Vertreter Chinas vom Westen angesehen, einnahm.
Kissinger und Nixon, und mit den beiden die Vereinigten Staaten von Amerika, haben mit diesem Schritt die entstandenen Realitäten nachvollzogen, dieser Schritt und all das, was aus ihm folgte, hat aber auch die weltpolitische Realität verändert. Heute sieht sich die USA von China bedroht. Wie früher von der Sowjetunion. Steht ein neuer Kalter Krieg bevor? Nun zwischen den USA und China. Ein kalter Krieg, bei dem wir nur froh sein können, wenn aus ihm kein heißer, kein Weltkrieg wird. Wenn es nur zu einem Wirtschaftskrieg kommt.
Die USA fühlen sich von China bedroht, der Westen von Russland
Es stellt sich also die Frage nach der multipolaren Weltordnung vor diesem Hintergrund, als ein eventuell möglicher Ausweg, um der neuen Bipolarität mit ihren Gefahren für die ganze Welt zu entkommen. Und es stellt sich eben diese Frage, ob der Westen eine solche Multipolarität akzeptieren könnte. Was dann zum Beispiel auch heißen könnte, dass sich die Europäische Union als eine Weltmacht etablieren müsste, deren Interessen sich von denen der USA unterscheiden. Die USA fühlen sich von China bedroht. Der Westen sieht sich von Russland bedroht. Russland vom Westen.
Gibt es aus dieser Welt der gegenseitigen Bedrohung kein Entkommen? Überall auf der Welt ist sehr vielen Menschen, auch Politikern, klar, dass die eigentliche Bedrohung vom Klimawandel ausgeht, der in eine Klimakatastrophe führen kann. Es wäre eine weltweite Kraftanstrengung nötig, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden, um mit den Folgen des Klimawandels irgendwie fertig zu werden. Kooperation ist das Gebot der historischen Stunde, die Zusammenarbeit von Staaten. Nicht Streit, Krieg und Wirtschaftskrieg.

Die Amis wollen einfach nicht ihren American Way of Life aufgeben. Die Russen halten sich mit dem Verkauf von fossiler Energie wirtschaftlich über Wasser, für die es keine Zukunft mehr gibt. Geben darf. Zwei Weltmächte, die dem Niedergang, dem Untergang geweiht sind, ändern sie sich nicht ganz grundlegend. Die Chinesen beteiligen sich sehr erfolgreich mit billigem Konsumschrott am Welthandel. Brasilien zündet seinen Regenwald an, um Sojabohnen für den Weltmarkt zu produzieren. Der Engländer glaubt, mit Geld Geld machen zu können, und damit wieder zu einem Global Player aufzusteigen. Und so weiter. Die schrecklichen Saudis benutzen das viele Geld, das sie mit Erdöl verdient haben, dazu, um auf die Erzeugung von Solarenergie umzustellen. Deutschland hofft darauf, weiterhin weltweit seine Autos verkaufen zu können, demnächst mit Elektroantrieb. Und vielleicht nutzt ja die diktatorische chinesische Regierung ihre Macht, um die Umweltprobleme des Landes anzugehen – könnte sein, dass der Systemvergleich zugunsten des chinesischen Modells ausgeht. Das wissen wir alle nicht, niemand kann die Entwicklung wirklich abschätzen.
Für einen Feuilletonisten, und mehr bin ich ja nicht, stellt sich die Frage, ob der Westen eine multipolare Weltordnung akzeptieren kann, auf eine andere Weise, eine eher ideologische: Inwieweit ist der Westen von seinen Einstellungen her, seinem Blick auf den Staat und die Beziehungen zwischen Staaten darauf vorbereitet und eingestellt, eine solche multipolare Weltordnung zu akzeptieren, sie anzustreben? Oder anders gefragt: Müsste sich der Westen geistig aufgeben, in einem solchen Maß umdenken lernen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dies könnte ihm gelingen?
Der Krieg in der Ukraine putscht uns im Westen doch gerade noch einmal dazu auf, bei unserer Denkweise bleiben zu wollen, auf ihr zu beharren, was dem auch immer entgegensteht. Nichts anderes als die sich derzeit so sehr verändernde Realität. Was wir uns gedacht hatten, wie die Welt sein sollte, passt nicht mehr, und wir reagieren darauf mit einem mehr davon. Die Zeitenwende bedeutet bisher: Weiter so, nun aber mit Gewalt.
Wir wollten eine regelbasierte europäische Friedensordnung, nun hat eine Macht die Regeln gebrochen, und also muss sie wieder dazu gebracht werden, die Regeln einzuhalten. Wir wollen uns nicht die Frage stellen, ob unsere Vorstellungen vielleicht naiv waren, wir wollen auch die Regeln nicht infrage stellen, und wir versuchen schon gar nicht zu überlegen, ob wir nicht vielleicht ganz andere, neue Regeln bräuchten.
Regeln, die dann zu einer multipolaren Weltordnung passen, aus ihr erst eine Ordnung machen würden. Wir müssten hinnehmen, dass Staaten in unterschiedlichem Maße souverän sind, abhängig von ihrem jeweiligen Machtpotential. Wir müssten uns damit abfinden, dass die Menschenrechte, von denen wir behaupten, sie seien universell, für die ganze Welt gültig, von mächtigen Staaten nicht eingehalten, auf eine Weise interpretiert werden, die uns nicht passt.
Wir müssten uns eingestehen, dass die westlichen Werte, die wir nun verteidigen wollen, nur westliche Werte sind, unsere, nicht unbedingt die anderer Menschen. Wir sähen uns mit unseren eigenen Widersprüchen konfrontiert, damit, wie wenig universell wir in unserer Vergangenheit waren, wenn es um die Menschenrechte in den Ländern ging, die von uns erobert, kolonisiert und beherrscht wurden. Wir würden darauf gestoßen werden, dass wir bei der Wahl unserer Verbündeten nie zimperlich waren, dass wir immer noch mit zweierlei Maß messen. Dass es uns noch nicht einmal gelingt, in der Europäischen Union die Menschenrechte in einem überall gleichen Maß durchzusetzen. Und so weiter. Wir müssten unser gesamtes Weltbild infrage stellen. Unser Menschenbild. Den Humanismus.
Einflusssphären: Das Völkerrecht ist großartig, aber auch nur Papier
Das Palais am Festungsgraben, hinter der Neuen Wache, das Haus für die Vereinten Nationen, vorübergehend geschlossen, die Wenigsten werden es vermissen, wenige überhaupt jemals von diesem Veranstaltungsort gehört haben – früher zu DDR-Zeiten das Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, Sitz des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, eine Massenorganisation mit immerhin 6,4 Millionen Mitgliedern.
Und dort in diesen Räumen gab es, immer am Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere, eine Veranstaltungsreihe, in der die Auslandskorrespondenten der großen Zeitungen, auch der Berliner Zeitung, über näher und ferne liegende Länder berichteten, von Ländern in der Dritten Welt, von Entwicklungen im kapitalistischen Ausland – der einzige Ort in der ganzen DDR, an dem mehr über die Hintergründe, die Probleme der Welt zu erfahren war, über die dann auch diskutiert werden konnte, recht frei sogar, mit Leuten, die sich etwas mehr in der Welt auskannten als der doofe Rest in der eingemauerten DDR.
Und bei jeder dieser Veranstaltungen saß da eine ältere Dame mit im Publikum, sicher eine gute Genossin, und irgendwann, man brauchte nur darauf warten, stellte sie die Frage, ob denn da die Uno nichts machen könnte – schön, dass daraus nun das Haus für die Vereinten Nationen geworden ist, wie passend. Jedes Mal musste die Frage nach der Uno abschlägig beantwortet werden: Nein, die Uno kann da gar nichts machen. Die Uno ist keine Weltregierung, es gibt keine übergeordnete Instanz, die für alle Staaten gültige Regeln und Normen setzt, sie jedenfalls nicht durchsetzen kann, der Sicherheitsrat wird von ein paar wenigen Großmächten dominiert, die sich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen einig sind, die jede Entscheidung mit ihrem Veto blockieren können.
Weshalb alle Staaten stets auf den schlimmsten Konfliktfall, den Krieg also, vorbereitet sein müssen. Trotz der UN-Charta, zu der auch das Bekenntnis aller Staaten zu den Menschenrechten gehört. Das Völkerrecht ist großartig, aber auch nur Papier, in das jeder hineinlesen kann, was ihm gerade passt, solange das Weltgericht, das wir im Ansatz haben, im Internationalen Gerichtshof in Den Haag, seine Entscheidungen nicht gegen die davon betroffenen Staaten durchsetzen kann, da ihr der Weltpolizist fehlt, der dies könnte. Und es sieht nicht danach aus, dass sich daran in absehbarer Zukunft etwas ändern dürfte.
Da Moskau die regelbasierte Ordnung angreife, sei es „jetzt noch wichtiger, die vereinbarten Normen und Grundsätze einzuhalten und Verstöße anzuprangern“, sagte Baerbock. „Jetzt ist es an der Zeit, stark zu sein.“
Die Werte einer werteorientierten Außenpolitik, so es sie denn gibt und die Werte nicht bloß die schnöden Machtinteressen bemänteln sollen, schön und gut, die Regeln einer internationalen Friedendordnung, auch gut, wobei diese Regeln schon ein Wert sind, nicht nur dann, wenn sie von Werten geleitet werden. Um des lieben Friedens willen.
Aber die Frage muss doch gestellt werden: Wer da mit wem die Normen dieser regelbasierten Ordnung vereinbart hat? Und dann auch die Frage: Warum es jetzt plötzlich noch wichtiger geworden sein soll, sich an diese Vereinbarungen zu halten, an die wir und unsere Freunde sich nicht immer gehalten haben? Ich will diese Verstöße jetzt nicht anprangern, nur an sie erinnern. Ohne sie alle noch einmal aufzuzählen, es würde Seiten füllen. Ganze Bücher.
Es könnte doch sein, dass wir deshalb so sehr auf die Einhaltung der Regeln pochen, weil sich unsere Gesellschaft so sehr fragmentiert, segmentiert und individualisiert hat, dass nur ein paar wenige Abenteurer und Fanatiker zu finden wären, die bereit sind, für das große Ganze, irgendeines, in die Schlacht zu ziehen. Eine postheroische Epoche, so nennt man unsere Zeit, und daran wird auch die Zeitenwende wenig ändern, die Olaf Scholz verkündet hat. Der nie gedient, nie sein Leben für unsere Werte riskiert hat. Der, sehr vernünftig, in den Zivildienst ausgewichen ist, in einem Pflegeheim gearbeitet hat. Wie auch Robert Habeck, der Vizekanzler. Und unsere werteorientierte Außenministerin als Frau dann noch einmal weniger, obwohl Frauen sich freiwillig zur Bundeswehr hätten melden können. Aber dafür kommt sie vom Völkerrecht her. Und deshalb müssen wir jetzt stark sein. Weil wir schwach sind.
Unser Imperialismus schreitet im humanistischen Gewand umher
Wir haben die gottgegebenen zehn Gebote in einen nach menschlichem Maß recht ordentlich funktionierenden Rechtstaat läutern können. Wir haben auch unseren früher alttestamentarisch polternden und strafenden Gott zu einem lieben Wegbegleiter für die umwandeln können, die immer noch gerne ein bisschen glauben wollen, wir lassen den Schöpfer als Natur begrifflich weiterleben. Und wir haben den sündigen Erdenwurm, uns selber zum Menschen gemacht, vom bloß deskriptiven zum normativen, zu dem Menschen, der nicht nur Mensch ist, sondern erst MENSCH (und das muss hier einfach groß und in Versalien geschrieben werden) werden soll.
Ein Mensch, wie stolz uns das nun klingt, wie kostbar, wie wertvoll, und es ist bei dieser Vergöttlichung des Menschen etwas von dem alten Polterer auf uns übergegangen, der da eifersüchtig keine anderen Götter neben sich dulden wollte. Wir waren monotheistisch in unserem Glauben, wir sind monohumanistisch in unseren Überzeugungen geworden.
Wir lassen nur die Menschen gelten, die solche Menschen wie wir selber sind. Alle die, die religiös im Mittelalter hängen geblieben, denen die intellektuellen Segnungen der Aufklärung nicht zuteilgeworden sind, alle, die immer noch feudalistischen Ansichten wie denen einer Ehre, die verteidigt werden muss, anhängen, alle, die da immer noch die Macht anbeten, anstatt sich dem Recht zu beugen, alle, die sich immer noch damit abfinden, Untertanen zu sein, anstatt als freie Bürger auf ihre Rechte zu pochen, werden von uns verachtet. Wir stehen über ihnen, unsere Werte sind mehr wert als ihre. Ihre Werte sind doch gar keine, das sind Hirngespinste. Wie sollten wir uns da mit ihnen arrangieren können. Wenn sie sich artig verhalten, belehren wir sie. Wenn sie aufmucken, bestrafen wir sie. Stellt sich uns jemand entgegen, dann werden wir böse, dann holen wir unsere schweren Waffen aus dem Depot. Unser Imperialismus schreitet im humanistischen Gewand umher. Eine multipolare Weltordnung ist mit uns nur zu machen, wenn überall in der Welt unsere Werte gelten. Also kann es sie, wenn’s nach uns geht, nicht geben.