In seinem neuen Buch „Die Ethik der Appropriation“ beschäftigt sich Jens Balzer mit dem Reizthema kulturelle Aneignung. Ihn nervt die Polarisierung, er geht das Thema in all seiner Komplexität an und rät vor allem den jungen Linken, sich doch mal etwas intensiver mit Kulturgeschichte zu beschäftigen.
Herr Balzer, der Titel Ihres Buchs „Ethik der Appropriation“ impliziert, dass es Voraussetzungen gibt, unter denen Appropriation okay ist, oder?
Es ist die These dieses Buchs, dass kulturelle Aneignung nicht nur okay ist, sondern dass es überhaupt keine Kultur ohne Aneignung gibt. Ich habe es auch deshalb geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass über Aneignung nur noch im Modus des Verbots und der schlechten Laune gesprochen wird. Dagegen wollte ich darauf hinweisen, dass Aneignung grundsätzlich erst mal eine kulturstiftende Kraft ist und dass vieles von dem, wenn nicht alles, was uns an Kunst und Musik umgibt, ohne Aneignung gar nicht denkbar wäre.
Aber Sie bestreiten nicht, dass es auch schlechte Formen der kulturellen Aneignung gibt.
Natürlich beruht kulturelle Aneignung auch auf asymmetrischen Machtverhältnissen, und es gibt Formen der Aneignung, durch die die wahren Urheberinnen und Urheber verschwinden, oder man könnte auch sagen: enteignet werden. Das kann und muss man offenlegen und kritisieren. Die Debatte kommt ja ursprünglich aus den USA. Dort haben HipHop-Crews wie Public Enemy in den 80er-Jahren dagegen protestiert, dass die US-amerikanische Kulturgeschichte als Geschichte weißer Könige erzählt wird: Elvis Presley, der King of Rock ’n’ Roll, und Benny Goodman, der King of Swing, während es tatsächlich so war, dass Weiße sich afroamerikanische Kultur angeeignet haben und sich als deren Erfinder, als deren Könige hingestellt haben. Die Debatte wurzelt in dem Wunsch, die gefälschte Geschichtsschreibung zu korrigieren.
In dem Zusammenhang schreiben Sie von Counter-Appropriation. Was ist das?
Im HipHop sind die schwarzen Pionierinnen und Pioniere per Sample in die Musik eingefügt worden, um so etwas wie ein Gedächtnis schwarzer Kultur herzustellen, sich diese Kultur überhaupt erst wieder anzueignen. Man betreibt eine Gegen-Aneignung, um eine falsche Aneignung zu korrigieren.
Wenn es dieser Tage Protest gegen kulturelle Aneignung gibt, dann treten immer auch sofort Leute auf den Plan, die das verteidigen. Für die haben Sie das Buch aber nicht geschrieben?
Sie meinen so Leute wie Friedrich Merz, Boris Palmer und wie die alle heißen … Ja, bei denen denkt man, sie haben nur darauf gewartet, dass eine kleine Antifa-Gruppe auf dem Dorf irgendwem was untersagen will, und springen dann drauf, um die Linke zu verspotten. Das ist natürlich auch leicht zu durchschauen und Quatsch. Ich will mit meinem Essay versuchen, aus dieser Polarisierung herauszukommen und die Fragen so zu sortieren, dass es möglich ist, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Sie kritisieren die Polarisierung und plädieren für ein Einerseits–Andererseits? Das ist doch ziemlich aus der Mode gekommen?
Das liegt daran, dass diese Debatten über Twitter, Instagram und anderen soziale Netzwerke über möglichst knackige Kurzkommentare geführt werden. Und ja, das finde ich unterkomplex und doof. Aber in dieser Hinsicht waren die bisherigen Reaktionen auf meinen Essay eher ermutigend, es gab viele Leserinnen und Leser, die schrieben: Wie schön, dass jemand das Thema mal differenziert anzugehen versucht. Es gibt offenkundig zumindest bei ein paar Menschen ein Bedürfnis, über das Thema nachzudenken, ohne gleich dieses Raster im Kopf zu haben.

Sie bezeichnen Appropriation als Lebenselixier für die Kultur. Was für eine Vorstellung von Kultur steht denn hinter der Extremkritik von Appropriation?
Hm, was heißt Extremkritik? Es gibt eine entschiedene Kritik an der kulturellen Aneignung, die sich gegen die Ausbeutung der Kultur von Minderheiten durch die Mehrheitskultur wendet. Und das finde ich erst mal völlig legitim. Wenn man diese spezifische Kritik aber auf das Verhältnis zwischen Kulturen im Allgemeinen zu übertragen versucht, dann läuft man Gefahr, einen identitären Kulturbegriff zu formulieren. Wer kann denn schon genau sagen, wo die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturen verlaufen, und wer kann mit Sicherheit behaupten, genau zu einer bestimmten Kultur zu gehören und darum ein Eigentumsrecht an ihr zu besitzen. Da stehen zwei emanzipatorische Begriffe von Freiheit im Widerstreit: Einerseits will man sich von der Unterdrückung durch andere befreien; andererseits ist man ja aber auch nur wirklich frei, wenn man das Korsett der Identitäten generell abzustreifen vermag. Wie man diesen Widerstreit auflöst – das ist der wahre, und wie ich finde: extrem interessante Kern dieser Debatte.
Bei dem abgebrochenen Konzert der Band Lauwarm in Bern wurde kritisiert, dass Weiße jamaikanischen Reggae spielen. Wie ist es damit?
Das Argument war, da werde der Reggae als Musik einer indigenen jamaikanischen Kultur von Weißen ausgebeutet. Über Ausbeutung nachzudenken, ist – noch mal – immer richtig; aber man muss auch überlegen, ob und in welcher Weise die spezifisch US-amerikanische Debatte auf andere kulturelle Verhältnisse anwendbar ist. Und die Linke könnte sich gelegentlich mal darauf überprüfen, ob nicht in der Verwendung des Begriffs des Indigenen selbst ein kolonialistischer Blick liegt. Reggae ist nun alles Mögliche, aber nicht indigen. Da kamen in den 50er- und 60er-Jahren afrikanische, karibische und US-amerikanische Einflüsse zusammen, Reggae ist in Wahrheit total eklektisch und modern. Wenn man das übersieht oder leugnet, blickt man gewissermaßen als „white savior“ auf eine Kultur, der man einen archaischen Naturzustand zuschreibt und ihr damit aber überhaupt nicht gerecht wird.
Zwei weiße Musiker von Lauwarm tragen Dreadlocks, was ebenfalls als unzulässige kulturelle Aneignung kritisiert wurde. Was kommt dabei heraus, wenn Sie Ihre Ethik der Appropriation auf diese Haartracht anlegen?
Erst mal finde ich es problematisch, wenn die Kritik so vorgetragen wird, wie es in Bern der Fall war: Da hieß es bloß, anonym bleibende Teile des Publikums hätten sich beim Anblick der Band unwohl gefühlt. Unwohlsein ist kein Argument. Man kann nach dem Konzert zu der Band gehen oder zu den Veranstaltern und eine Podiumsdiskussion zu dem Thema anregen. Man kann kritisieren, ohne zu verbieten. Einerseits. Andererseits finde ich aber auch, dass man als weißer Dreadlocks-Träger im Jahr 2022 nicht sagen kann, das ist ja nur eine Frisur, ich trage die Haare so, wie ich das will. Dreadlocks trägt man als politisches Symbol. Und dann muss man sich auch der Debatte stellen, ob diese Aneignung eines politischen Symbols angemessen ist oder nicht, und ob sich diese Debatte im Jahr 2022 vielleicht anders darstellt als – sagen wir mal – 1979.
Halten Sie es nicht für möglich, dass manche Dreadlocks allein aus modischen Gründen tragen? Viele aus unserer Generation haben doch in den 70ern auch Palästinensertücher getragen, ohne dass ihnen der politische Zusammenhang so klar war.
Klar, war der Palästinenserfeudel, wie wir Popper früher sagten, ein modisches Accessoire. Aber die Appropriation des Palästinensertuchs wurzelt in der Über-Identifikation der westdeutschen Linken mit den Palästinensern, die letztlich auch aus antisemitischen Motiven heraus passiert ist. Da kann man jetzt vielleicht sagen, das haben wir als Schüler nicht gewusst. Aber 40 Jahre später kann man ja mal darüber nachdenken.
Sehen Sie in der aktuellen Diskussion um das Thema BDS und in manchen linken Positionen zum Antisemitismus etwa bei der Documenta eine Verbindung zum linken Antisemitismus der 70er?
Ja klar, der deutsche Antisemitismus hat eine lange Geschichte. Für die antiimperialistische Linke war Israel als Kolonialmacht immer auch ein Hauptfeind. Im Grunde war Arafat in den 70ern der Winnetou der linken Gegenkultur. Man imaginierte ein einfaches Wüstenvolk, das gegen die technisch modernen, imperialistischen Besatzer kämpft, genau wie das die Indianer gegen die weißen Kolonisatoren getan haben. Die heutige postkoloniale Linke – jedenfalls die in Deutschland – steht ganz klar in dieser Tradition. Da gibt es überhaupt keinen historischen Bruch.
In Ihrem Buch denken Sie ja auch darüber nach, warum Sie als Kind so gern Winnetou gespielt haben. Das knüpft an die derzeitige Debatte an. Der Ravensburger Verlag hat gerade zwei Winnetou-Bücher und ein Puzzle zurückgezogen.
Ach, das Puzzle auch?
Ja! Und der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer sagt, Rassismus und Kolonialismus machten die DNA von Winnetou und Old Shatterhand aus und es sei kein Wunder, dass Hitler und Himmler Karl-May-Fans gewesen seien. Waren Sie auch Karl-May-Fan?
Bin ich bis heute, ein kritischer Fan, aber ein Fan. Und ja, das mit Hitler und Himmler ist immer so die erste Binse, die dann kommt. Dem entgegen steht das pazifistische Spätwerk Karl Mays, die „Ardistan und Dschinnistan“-Romane und das Theaterstück „Babel und Bibel“. Karl May war eine weitaus komplexere Figur, als das in der Debatte jetzt gerade erscheint. Und sagen wir mal, gerade von einem Historiker wie Jürgen Zimmerer würde ich etwas mehr historisches Wissen und Differenzierungsvermögen erwarten.
Wie ich von seinem Bruder erfahren habe, war auch Rio Reiser Karl-May-Fan.
Und der marxistische Philosoph Ernst Bloch. „Ich kenne nur Karl May und Hegel; alles, was es sonst gibt, ist aus beiden eine unreinliche Mischung“, heißt es bei ihm. Eine der tiefsten Karl-May-Analysen findet man bei Bloch. Ich finde es auch gut, darüber nachzudenken, was sich in Karl May an deutscher Gesellschafts- und Politikgeschichte spiegelt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ich glaube nur, man kommt da mit den Halbweisheiten von Jürgen Zimmerer nicht weiter. Man muss vor allem auch zwischen den Büchern von Karl May und den Winnetou-Bildern unterscheiden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Winnetou-Filmen und bei den Karl-May-Festspielen produziert worden sind. Auf jeden Fall ist es nicht richtig zu sagen, Karl May habe den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern verschwiegen.
Sondern?
Old Shatterhand kommt zwar mit einer Eisenbahngesellschaft nach Nordamerika, distanziert sich dann aber von den Kolonialmächten und kämpft auf der Seite der Ureinwohner gegen sie. Im Nachkriegsdeutschland beruht die Identifikation mit den edlen Wilden einerseits darauf, dass man mit der eigenen technischen Moderne nicht klarkommt. Man will was Authentisches, Spirituelles. Doch andererseits entspringt diese Identifikation auch dem Wunsch nach einer Täter-Opfer-Umkehrung – die möglich wird, gerade weil Karl May den Genozid nicht verschwiegen hat. Man identifiziert sich mit den Indianern, die einem Genozid zum Opfer gefallen sind, nachdem man selbst gerade einen Genozid an den europäischen Juden veranstaltet hat. Endlich kann man wieder auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ähnlich wie die Linke sich mit den Palästinensern überidentifiziert, um jetzt mal die Juden auf der schlechten Seite der Geschichte einordnen zu können. Das sind meiner Meinung nach durchaus verwandte Phänomene.
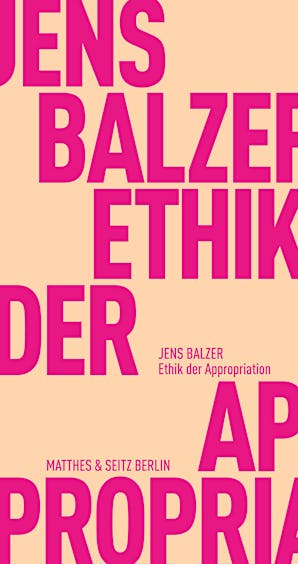
Steckt noch mehr in der deutschen Faszination mit den Indianern?
Es gibt noch eine ganz andere Komponente, und das ist die sexuelle. Für einen kleinen Jungen in der norddeutschen Provinz in den 70ern war die Verkleidung als Winnetou die einzige Möglichkeit, lange Haare zu tragen, sich zu schminken, weich zu sein, ohne gleich als schwul hingestellt zu werden. Das ist ein ganz starkes Identifikationsangebot für das Andere, um als Kind aus den engen Verhältnissen herauszukommen und sich in die weiten Welten Prairie hineinzuträumen und in nicht repressive sexuelle Verhältnisse. Die Identifikation mit Winnetou – dessen gewissermaßen queere Eigenschaften bei Karl May übrigens schon explizit angelegt sind – ist ein emanzipatorischer Aspekt, aber dieser wird andererseits erkauft durch die Aneignung kolonialistischer Stereotypen. Ich finde, wenn man darüber diskutiert, muss man beides sehen.
Da ist wieder das Einerseits–Andererseits.




