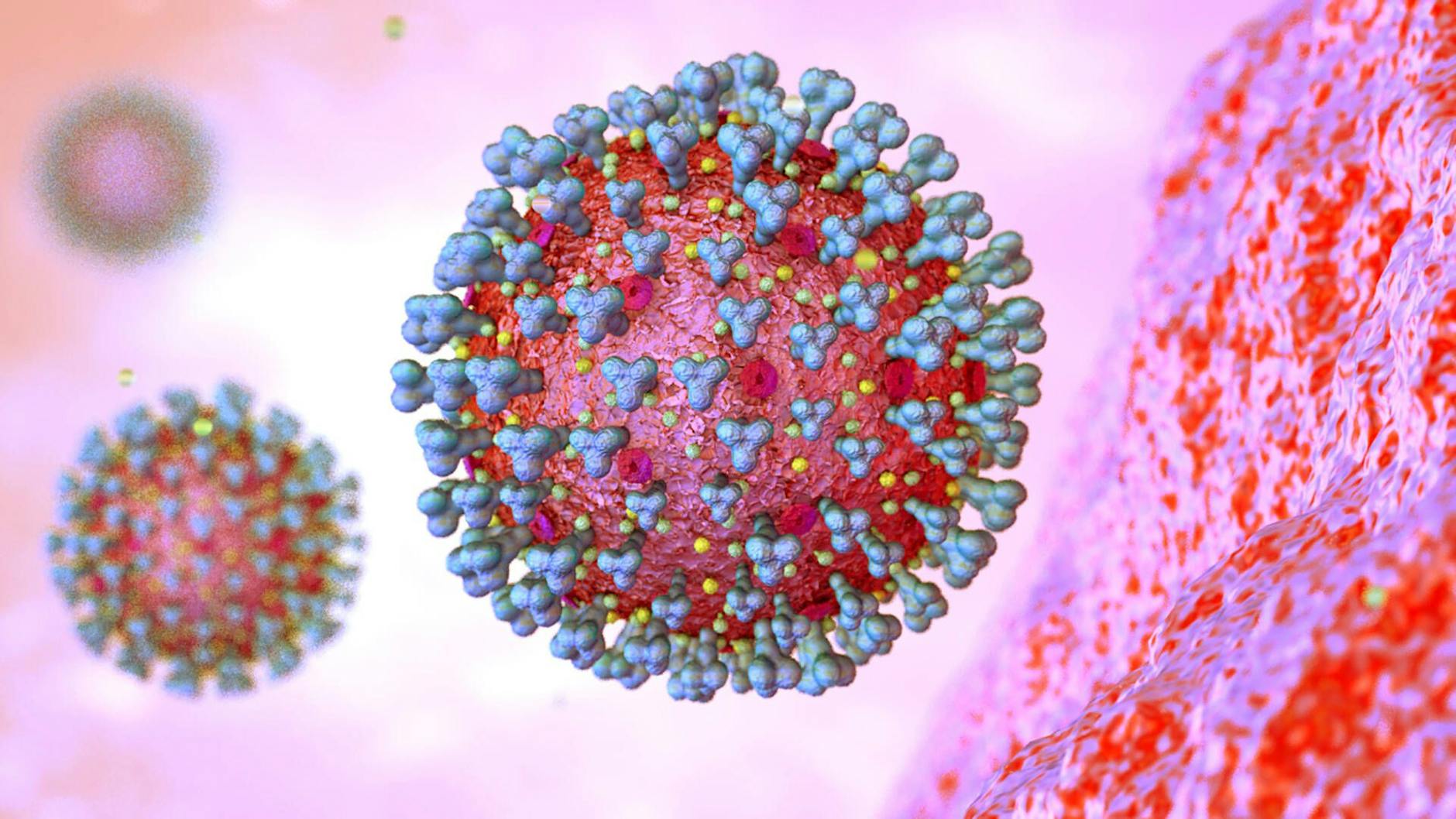Es klingt nach Ringkampf, wenn Andreas Radbruch über Sars-CoV-2 spricht, wenn er aus der Perspektive des Immunologen die Corona-Lage analysiert. „Das Virus kommt aus der Umklammerung unseres Immunsystems nicht hinaus“, sagt Radbruch, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin.
Es geht in dem Gespräch gerade um die Frage, die derzeit im Zusammenhang mit eben jenem Kampf gegen Corona viel diskutiert wird: Sind bald schon wieder Impfungen nötig, um den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen sicherzustellen? Ein zweiter Booster, irgendwann vielleicht sogar ein dritter, vierter, fünfter? Experten sind skeptisch, zumindest was jüngere Menschen mit einem intakten Immunsystem angeht. „Diese Pandemie hat gezeigt“, sagt Radbruch, „dass wir mit diesem Virus ganz gut fertig werden.“
Falls sich daran etwas ändern sollte, dann wahrscheinlich nicht durch eine Mutation von Sars-CoV-2, sondern durch ein gänzlich neues Virus. Davon geht nicht nur Radbruch aus. Die Fachwelt beurteilt die Entwicklung der Pandemie somit anders als etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der unlängst vor „Killer-Varianten“ warnte und eine umfangreiche Order von Impfstoff für diesen Herbst in Aussicht stellte.
„Es ist eine gewisse Konfusion in der Diskussion festzustellen“, sagt Radbruch. Und dann beschreibt der Berliner Professor einen interessanten Mechanismus: „Dass der Antikörper-Spiegel nach einer Infektion oder einer Impfung abfällt, ist ein ganz normaler Vorgang.“ Das Immunsystem beseitigt mehr und mehr den Fremdstoff, es werden daher immer weniger Antikörper benötigt. Die Folge: „Die Zellen konkurrieren um die Bekämpfung des Erregers, nur die besten kommen zum Zug.“ Affinitätsreifung lautet der Fachbegriff. Wettbewerb führt zu Qualität: „Das Immunsystem nimmt sogar künftige Varianten vorweg.“
Vierte Corona-Impfung: Mehr Antikörper, aber schlechtere
Am Ende wandern die Zellen, die für die Immunantwort zuständig sind, ins Knochenmark, wo sie in ihren Nischen ein Leben lang überdauern. „Dieser Prozess beansprucht mindestens ein halbes Jahr“, erläutert Radbruch. Solange sollte mit einer Auffrischung der Schutzimpfung mindestens gewartet werden, um den Reifeprozess nicht zu unterbrechen, anderenfalls: „Hat man zwar mehr Antikörper, aber schlechtere.“
Dass sich eine Infektion mit Sars-CoV-2 per Booster nicht ausschließen lässt, ist ohnehin unter Fachleuten Konsens und inzwischen auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt. „Wenn man ehrlich ist“, sagt Christoph Neumann-Haefelin, „ist es kein realistisches Ziel, durch ständiges Aufboostern einen kompletten Schutz erreichen zu wollen.“ Der Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Virusimmunologie am Universitätsklinikum Freiburg empfiehlt stattdessen, sich auf den Schutz vor schwerer Erkrankung zu konzentrieren. „Wenn ein Mensch infiziert ist, können die T-Zellen für einen milden Verlauf sorgen.“ Eben jene Zellen im Knochenmark.
Eine „robuste T-Zell-Antwort“ bestehe bereits nach zwei Dosen der mRNA-Vakzine von Biontech oder Moderna, sagt Neumann-Haefelin, und sie halte ein knappes Jahr lang an. Nach dieser Frist „ist zu erwarten, dass die Booster-Impfung zu einem dauerhaften Schutz beiträgt“, sagt der Freiburger. Bei sogenannten Highrespondern sollte das jedenfalls so sein: bei Menschen mit einer guten Immunantwort.
Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (Stiko) rät lediglich über 70-Jährigen zu einer vierten Dosis. Unterhalb dieser Altersgrenze „macht sie aus immunologischer Sicht keinen Sinn“, sagt auch Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie in Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Allerdings gibt es Ausnahmen: Patienten mit transplantierten Organen zum Beispiel.
„Wir haben 400 Lungentransplantierte und 100 Herztransplantierte nach der zweiten Impfung genauer angeschaut und festgestellt, dass bei 60 Prozent gar keine Antikörper nachweisbar waren“, sagt Falk. „Durch die Medikamente, die verhindern, dass die Organe vom Körper abgestoßen werden, gibt es keine Immunantwort.“ Bestimmte Therapien gegen Krebs führen zu einem ähnlichen Effekt. Den Spiegel an Antikörpern regelmäßig aufzufrischen, sei deshalb bei diesen Gruppen von Patienten sinnvoll, sagt Falk.