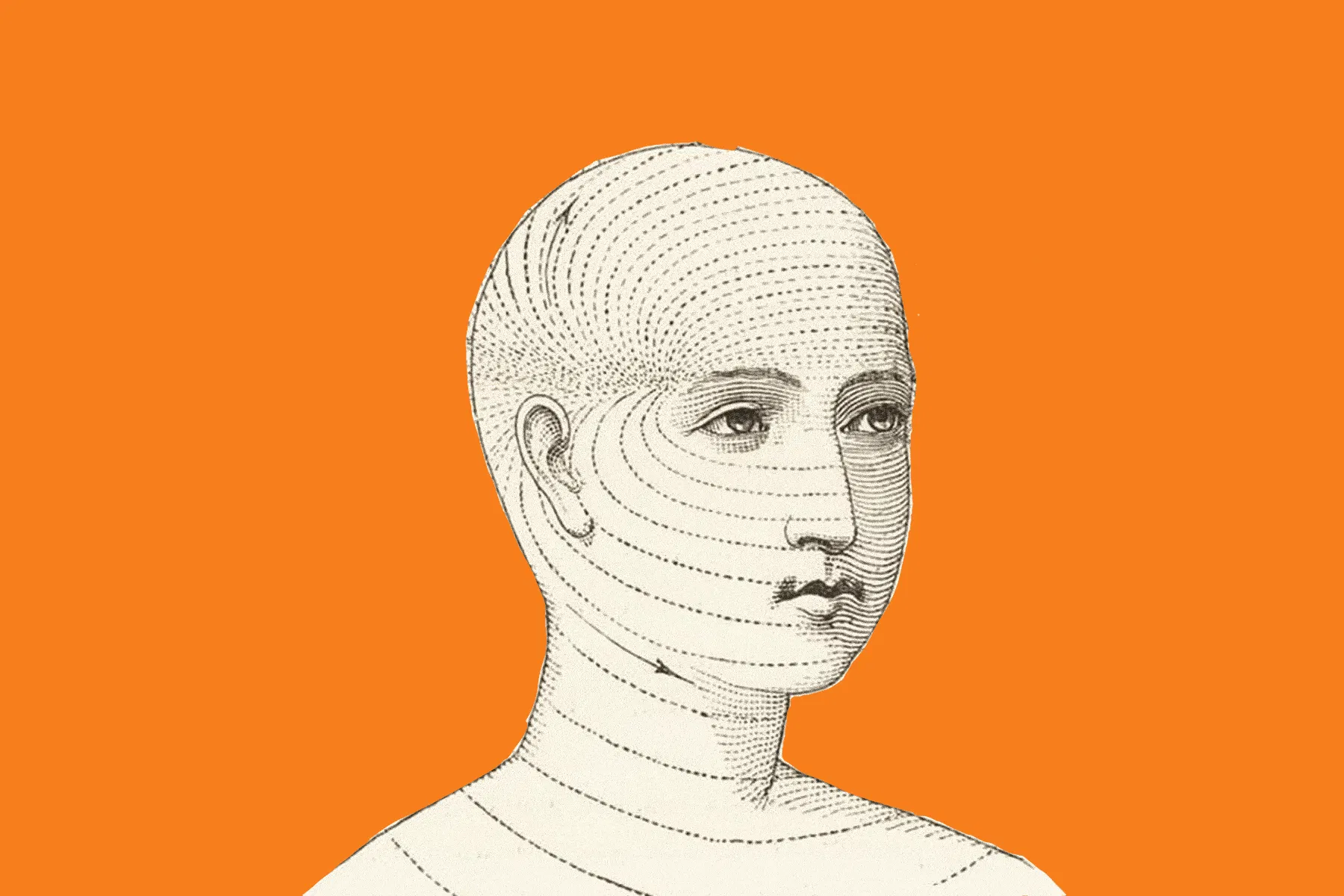So ziemlich jeder Mensch weiß, wie sich Kopfschmerzen anfühlen. Es kann ein Pochen oder Hämmern sein, ein Druckgefühl, als würde der Schädel platzen – in jedem Fall möchte man, dass das schnell wieder vorbei ist.
„Menschen, die oft unter Kopfschmerzen leiden, sollten diese Beschwerden nicht einfach ertragen, sondern mithilfe einer fachärztlichen Behandlung gegensteuern“, heißt es auf neurologen-im-netz.de, der Website der Berufsverbände für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie aus Deutschland.
Was als „oft“ gilt, ist nicht ganz klar definiert. Fachleute sagen aber, dass Kopfschmerzen, wenn sie häufiger als 15 Mal pro Monat auftreten, abgeklärt werden sollten. Als chronisch gelten Kopfschmerzen, wenn sie mehr als sechs Monate andauern.
Das ist belastend, weil ein normales Leben kaum mehr möglich ist. Viele Menschen googeln, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Doch die richtigen Antworten findet man nur selten, denn tatsächlich kann in der Regel nur ein Arzt oder eine Ärztin beurteilen, was man hat und woher das kommt. Klar ist jedoch: Ein bösartiger Hirntumor, dessen häufigste und aggressivste Form das Glioblastom ist, zeigt sich deutlich und auf verschiedene Weisen.
„Wichtig ist es, schnellstmöglich eine Diagnostik einzuleiten, die neurologische Untersuchungen, bildgebende Verfahren wie MRT oder CT-Scans und die Entnahme einer Gewebeprobe umfasst“, schreiben die Fachleute von Sprechzeit, die regelmäßig Telefonaktionen zu verschiedenen medizinischen Themen organisieren.
Woran erkenne ich, dass ich einen Hirntumor habe?
„Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwierigkeiten bei Konzentration und Koordination, Übelkeit und Erbrechen – mögliche erste Anzeichen für einen Hirntumor können sehr unterschiedlich sein und zunächst eher unbedeutend erscheinen. Krampfanfälle, Lähmungen oder Sprachstörungen sprechen eine deutlichere Sprache und werden meist schnell neurologisch untersucht“, teilt Sprechzeit mit. „Die Bandbreite der frühen Symptome ist so groß, weil Glioblastome in unterschiedlichen Regionen des Gehirns auftreten können.“
Glioblastome wachsen schnell und wuchern auch in gesundes Gewebe hinein. Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig das Tumorgewebe zu entfernen, ihn dann am weiteren Wachstum zu hindern und zugleich die Symptome abzumildern. Wie und warum Hirntumoren entstehen, weiß man noch nicht genau.
„Jährlich erkranken in Deutschland rund 8000 Menschen an einem primären Hirntumor. Primäre Hirntumoren sind Tumoren, die direkt im Gehirn entstehen: Sie können sich aus verschiedenen Zellen im Gehirn entwickeln, am häufigsten aus den Stützzellen, den sogenannten Gliazellen“, erklärt das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ein Glioblastom gilt als unheilbar, aber dank moderner Medizin kann man im besten Fall noch einige Jahre leben. Das wiederum hängt nicht nur vom Erfolg der Therapie ab, sondern auch davon, ob man einen Rückfall erleidet.
„Bei der Entwicklung neuer Therapien spielen Studien für die wissenschaftliche Forschung eine zentrale Rolle – fast alle Tumorzentren betreiben eigene Studien oder nehmen an Studien teil. Für Patientinnen und Patienten bietet sich so die Möglichkeit, Zugang zu Behandlungsverfahren zu erhalten, die zwar bereits teilweise erforscht, aber meist noch nicht zugelassen sind“, so Sprechzeit weiter. Betroffene haben viele Fragen. Die wichtigsten haben die Fachleute von Sprechzeit gesammelt und von Expertinnen und Experten beantworten lassen.
Das sind sie: Dr. Marie-Thérèse Forster, Fachärztin für Neurochirurgie, Spezielle Neurochirurgische Onkologie, Leitende Oberärztin der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, und Dr. Anna-Luisa Luger, Fachärztin für Neurologie, Oberärztin am Dr. Senckenbergischen Institut für Neuroonkologie, beide vom Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie am Universitätsklinikum Frankfurt der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Außerdem Dr. Tobias Martens, Facharzt für Neurochirurgie, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg; Dr. Julia Gerhardt, Fachärztin für Neurochirurgie, Oberärztin Fachbereich Neurochirurgie vom Helios-Klinikum in Berlin-Buch sowie Jörg Illert, Facharzt für Neurochirurgie, Funktionsoberarzt und Prof. Dr. Julian Prell, Facharzt für Neurochirurgie, Stellvertretender Direktor, beide von der Universitätsklinik und Poliklinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Halle an der Saale.
Gibt es eine Möglichkeit der Früherkennung oder bestimmte Risikofaktoren für ein Glioblastom?
Dr. Marie-Thérèse Forster: Da es sich bei Glioblastomen um sehr rasch wachsende Tumore handelt, gibt es keine Möglichkeit der Früherkennung. Selbst jährliche Screening-MRTs könnten diese in vielen Fällen nicht erfassen. Viele Betroffene fragen nach Risikofaktoren, um zu verstehen, weshalb sie an einem Glioblastom erkrankt sind.
Allerdings gibt es für die bislang untersuchten Risikofaktoren keinen Hinweis, dass sie an der Entstehung von Glioblastomen maßgeblich beteiligt wären. Wir wissen lediglich, dass die Häufung von Glioblastomen mit zunehmendem Lebensalter steigt.
Wie kann eine möglichst schnelle Diagnose sichergestellt werden?
Dr. Tobias Martens: Der erste Schritt besteht immer in einer Bildgebung, wenn möglich eine Magnetresonanztomografie (MRT) unter Verwendung eines Kontrastmittels. Wenn sich hierbei der Verdacht auf das Vorliegen eines Glioblastoms oder eines Tumors allgemein ergibt, sollte zeitnah eine weitestmögliche mikrochirurgische Entfernung des Tumors oder zumindest eine Gewebesicherung in Form einer Biopsie erfolgen.
Wie lange dauert es von der Diagnose bis zum Beginn der Behandlung?
Jörg Illert: Oft macht sich der Tumor durch neurologische Ausfallserscheinungen oder einen epileptischen Anfall bemerkbar. Nach dem Auftreten solch gravierender Symptome wird meistens rasch ein MRT durchgeführt. Sobald die Diagnose eines Hirntumors gestellt wurde, vergehen für gewöhnlich nur wenige Tage bis zum ersten Schritt der Behandlung – der chirurgischen Entfernung des Tumors oder der Entnahme einer Gewebeprobe.
Wie riskant ist die operative Entfernung des Tumors?
Prof. Dr. Julian Prell: Wir verfügen heute in der Neurochirurgie nicht nur über sehr viel Erfahrung mit solchen Operationen, sondern auch über technische Hilfsmittel, von denen frühere Generationen von Operateuren nicht einmal zu träumen wagten.
Spezielle OP-Mikroskope mit Fluoreszenzdarstellung, Ultraschall, Neuronavigation und vor allem die intraoperative Funktionsüberwachung mit neurophysiologischem Monitoring bis hin zur Wachoperation machen es heute möglich, solche Tumoren in den meisten Fällen radikal zu entfernen, ohne den Patienten oder die Patientin hohen Risiken auszusetzen.
Welchen Einfluss hat die Untersuchung des Tumorgewebes auf die Therapie?
Dr. Tobias Martens: Wir wissen mittlerweile, dass sich hinter der Diagnose Glioblastom Tumore mit unterschiedlichen genetischen Merkmalen verbergen, was für die Prognose wichtig sein kann.
Aber auch die Therapie kann dadurch beeinflusst werden. So profitieren zum Beispiel Patienten mit einem bestimmten Merkmal, der sogenannten MGMT Methylierung, besser von einer Chemotherapie als andere. Ebenso gibt es Mutationen, die mit bestimmten Antikörpern behandelt werden können. Diese Therapien befinden sich beim Glioblastom jedoch noch in der klinischen Erprobung und sollten nur im Rahmen von Studien angewendet werden.
Erhalten alle Patientinnen und Patienten eine Strahlen- und Chemotherapie?
Dr. Anna-Luisa Luger: Nach der Entfernung des Tumorgewebes beziehungsweise der Biopsie erfolgt zunächst eine Strahlentherapie, die in der Regel mit einer Chemotherapie mit dem Wirkstoff Temozolomid kombiniert wird. In Einzelfällen kann auch eine Kombinationstherapie mit einem zusätzlichen Chemotherapeutikum erfolgen. Nach Abschluss der Strahlentherapie wird die Chemotherapie als Erhaltungs-Chemotherapie weitergeführt. Grundsätzlich gilt jedoch: Die Behandlung des Glioblastoms folgt keinem festen Schema – wichtig ist die individuelle Ausrichtung der Therapie.
Findet die gesamte Behandlung in der Klinik statt?
Dr. Julia Gerhardt: Der erste Behandlungsschritt, also die operative Therapie oder die Biopsie, findet im stationären Rahmen statt. Strahlen- und Chemotherapie sowie die Therapie mit TTFields können bei gutem klinischen Zustand regulär ambulant erfolgen.
Wann beginnt die Behandlung mit TTFields – und wie funktioniert sie?
Dr. Anna-Luisa Luger: Die Behandlung mit TTFields kann ab vier Wochen nach Beendigung der Strahlentherapie gestartet werden und – wie die Erhaltungs-Chemotherapie – zu Hause durchgeführt werden. TTFields nutzt schwache elektrische Wechselfelder, die das Wachstum von Tumorzellen stören können.
Dazu werden Elektroden in Form von Klebepads auf der Kopfhaut platziert, die an ein tragbares Gerät angeschlossen sind. Sowohl bei der Erhaltungs-Chemotherapie wie beim Einsatz von TTFields werden die Patientinnen und Patienten von ihren ambulant behandelnden Ärztinnen und Ärzten unterstützt.
Wie kann ich TTFields im Alltag einsetzen? Bin ich trotzdem mobil?
Dr. Tobias Martens: TTFields werden durch einen Generator erzeugt, den man in einem kleinen Rucksack oder einer Umhängetasche mitführen kann. Damit ist man mobil und kann ohne wesentliche Einschränkungen durch die Therapie am Alltagsleben teilnehmen.
Was geschieht, wenn es zu einem Rezidiv kommt?
Dr. Julia Gerhardt: Für den Fall, dass der Krebs wiederkehrt, ist keine Standardtherapie definiert. Zunächst sollte eine eventuell laufende Therapie abgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der individuellen Umstände kann eine erneute Operation, Chemo- oder Strahlentherapie erwogen werden.
Geprüft werden sollte auch, ob die Teilnahme an einer Studie möglich ist. Dazu kann eine erneute molekulare Diagnostik durchgeführt werden. Und nicht zuletzt können auch freie Therapieversuche diskutiert werden, zum Beispiel mit molekular zielgerichteten Medikamenten, die in anderen Tumorbereichen zugelassen sind.
Habe ich die Möglichkeit, an einer Studie teilzunehmen?
Dr. Marie-Thérèse Forster: Zwar empfiehlt die Deutsche Krebsgesellschaft die Teilnahme an Therapiestudien, sofern sie verfügbar sind, doch bei einem erstmalig diagnostizierten Glioblastom ist dies nicht für alle Patientinnen und Patienten gleich sinnvoll. Denn einerseits stellen Strahlen- und Chemotherapie weiterhin den Goldstandard der primären Behandlung dar, andererseits gelten für jede Studie bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien, die auf diese Patientengruppe nicht immer zutreffen.
Eine wesentlich größere Anzahl an Studien steht im Falle eines erneuten Tumorwachstums zur Verfügung. Grundsätzlich gibt es Hinweise darauf, dass eine Therapie im Rahmen klinischer Studien die Behandlungsergebnisse verbessern kann, unter anderem aufgrund der besonders sorgfältigen Kontrollen und der intensiven Betreuung. Generell werden Studien fast ausschließlich an neuroonkologischen Zentren oder assoziierten Kliniken angeboten, weshalb die Behandlung nach Möglichkeit in diesen Kliniken und Zentren erfolgen sollte.
Was hilft den Betroffenen beim Umgang mit den seelischen Belastungen durch die Erkrankung?
Dr. Tobias Martens: Tumorerkrankungen stellen für die Betroffenen eine große seelische Belastung dar. Deshalb spielt vor allem die psychoonkologische Betreuung eine wichtige Rolle, um die Betroffenen im Umgang mit der Krankheit und der veränderten Lebensperspektive zu unterstützen.
Das Angebot einer psychoonkologischen Betreuung richtet sich ausdrücklich auch an die Angehörigen. Sie sind zum einen selbst durch die oftmals schnellen Entwicklungen betroffen und brauchen entsprechende Hilfe. Zum anderen können sie die Patientinnen/Patienten sehr wirksam bei der Krankheitsbewältigung unterstützen.