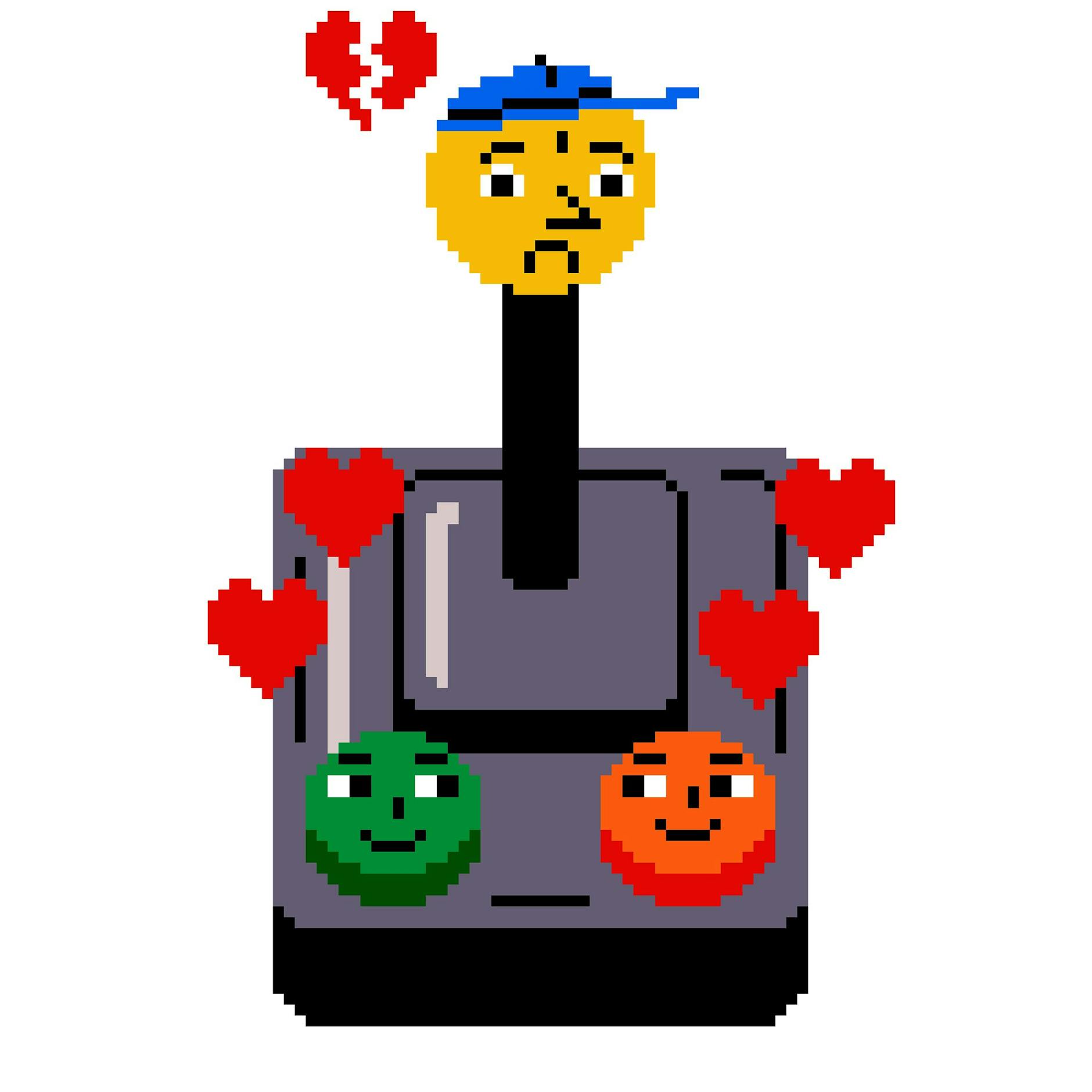Queerer Homo zu sein, heißt für mich, widerständig zu sein. Also nicht nur Sex mit anderen queeren Menschen zu haben. Sex und Widerstand setze ich nicht gleich, dafür haben meine queeren Vorfahren bereits gekämpft. Letztens hatte ich etwa ein Date mit einer Person, die mir von einer vergangenen Erfahrung erzählte, und da wurde ich hellhörig. Die Person beschrieb, wie sie ihren Crush in einer Bar knutschte. Ich wusste, dass die Person damals in einer Beziehung war, also fragte ich nach: Oh, deine letzte Beziehung war also eine offene Beziehung? An der Stelle können wir jetzt kurz auf Pause drücken: Ich weiß, so eine Nachfrage kann übergriffig klingen. Es geht mir ja nicht darum, die vergangene Beziehung dieser Person zu überwachen. Aber als jetziges Date hat es mich schon interessiert, wie der Beziehungsstil der Person eben aussieht. Gerade, wenn wir gerade zusammen auf einer Brücke sitzen und bei romantischem Ausblick über die S-Bahn-Gleise gemeinsam Weinschorle süffeln.
Genormtes Leben? Nein, danke!
In queeren Kontexten gibt es einen unausgesprochenen Diskurs zu Beziehungen, und vereinfacht klingt der in etwa so: Sei so wenig heteronormativ wie es nur geht. Eine dieser Hetero-Normen ist bekanntlich die Monogamie. Queere Menschen, heißt es, brauchen das nicht. Sie sind geradezu verpflichtet, nicht-monogam zu leben, weil das der einzige Weg sein soll in eine bessere Zukunft.
Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass queere Menschen, die sich nicht in offenen Beziehungen sehen, abgewertet werden. Was aber, wenn mein Begehren sich nicht auf mehrere Menschen verteilt? Was, wenn ich in einer Beziehung und zu großen Teilen mit einem Sexualpartner zufrieden bin? Was, wenn ich mir eine Partnerschaft wünsche, die genau das widerspiegelt? Dann habe ich zwar keinen Zugang zum Glamour einer offenen Beziehung, bin dafür aber mit meinem Beziehungsstil glücklich. Oder?
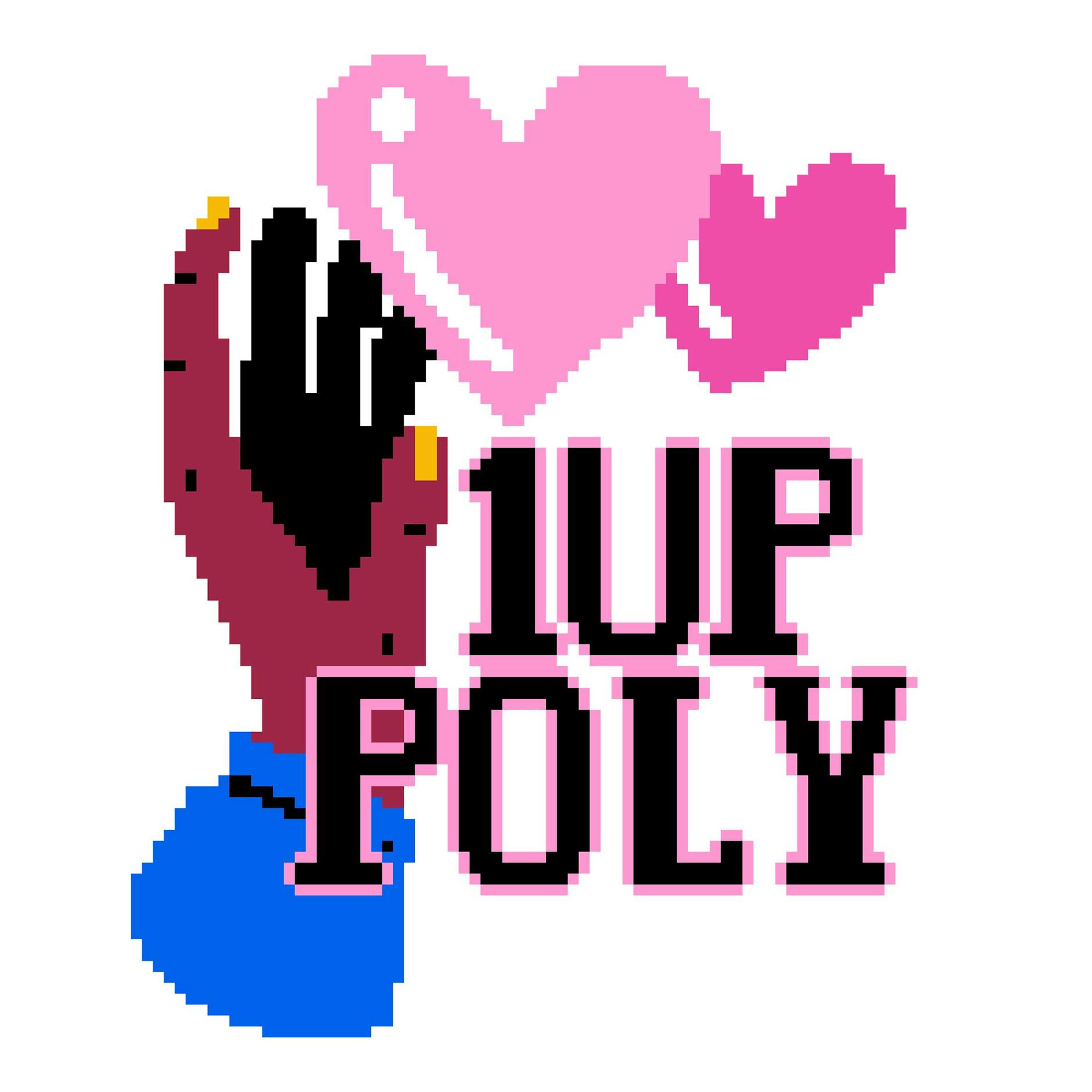
Mein Date jedenfalls sah das anders. Ich sei dogmatisch, drückte er mich. Mein Begehren, das in der Partnerschaft oft nur auf eine Person beschränkt bleibt, sei Ausdruck hetero-patriarchaler Unterdrückung. Und – jetzt kommt’s – ich solle mich doch mal frei machen. Ich fühle mich eigentlich ziemlich frei. Meine Sexualität würde vom queeren Tüv sicherlich abgenommen. Hier nun meine (steile) These: Vielleicht ist es gerade diese pseudo-kritische Haltung, die die queere Normierung von Sexualität vornimmt, was die hetero-patriarchale Ordnung letztlich wieder stützt. Was aber, wenn die Gegennorm der queeren Verpflichtung zu Offenheit die eigentliche Norm heteronormativer Monogamie letztlich stärkt? Nach dem Motto: Dort, die promiskuitiven, queeren Rammelhäschen. Und hier, die gesitteten Heteros.
Wie radikal wäre es, wenn queeres Begehren in jeder Form valide wäre? Vom Poly-Chaos zur monogamen Beziehung? Wenn also das ganze Spektrum von hypersexualisiert bis asexuell einfach okay wäre? Ich verstand das Gespräch über mein vermeintlich unterdrücktes Begehren nicht. Mein Begehren wurde als minderwertig, als nicht queer oder befreit genug eingeordnet. Und das nur, weil ich ausdrückte, dass eine offene Beziehung für mich nicht wirklich infrage kommt, vor allem nicht am Anfang des Datings.
Queer genug sein dürfen
Solche Art Befreiungsrhetorik gab es übrigens bereits in den 1970er- und 80er-Jahren, sie ist ein fester Teil anhaltender Debatten um zwei verschiedene Lager innerhalb der queeren Bewegung geblieben. Wollen wir uns an Hetero-Normen anpassen und heiraten dürfen? Oder bleiben wir queer, widerständig, promiskuitiv? Historisch kann ich diese Debatte nachvollziehen. Aber in der Gegenwart können wir sowohl heiraten, als auch in offenen Beziehungen leben. In der Gegenwart gibt es andere Kämpfe auszutragen als früher – und gleichzeitig gibt es auch gleichbleibende Kämpfe: denn keine:r von uns ist frei, bis alle frei sind.
Der Vorwurf, ich sei nicht befreit genug, hat mich dennoch beschäftigt. Er greift mein Selbstbild an. Bin ich in eine hetero-normative Falle getappt? Oder in eine queer-normative Falle? Immerhin hat die Angst, nicht queer genug zu sein, diesen Vorwurf erst Raum geschaffen. Gefühle wie Eifersucht oder die Angst, verlassen zu werden – reale Gefühle – können nicht allein durch eine Beziehungsform gebändigt werden, die sie durch Konfrontation überdeckt. Meine Eifersucht, meine Ängste und meine Verletzlichkeit sind Teil von mir, unabhängig von der Beziehungsform. Wenn ich mit einer Person zusammen bin, müssen diese Gefühle Raum bekommen. Genauso wie ich selbst bereit bin, die Gefühle der anderen Person als Zeichen ihrer Unsicherheit und ihres Menschseins zu verstehen.
Mit Männlichkeiten Gefühle fischen gehen
Als eine sich maskulin präsentierende, non-binäre Person fische ich stets im Teich der Männlichkeiten. Männlichkeitsbilder sind noch immer mit einem kommunikativen Handicap verbunden, was Gefühle und Kommunikation angeht. Die Art, wie ich auf dem Date angegangen wurde, hat mich an eine von bell hooks‘ Beobachtungen erinnert. Sie sagt, Männlichkeiten würden oftmals über Rituale der Scham und Beschämung verhandelt. Es fühlte sich tatsächlich so an, als wollte mein Gegenüber mich in eine vermeintlich offenere Sexualität sprichwörtlich hinein schämen. Wenn ich nur offen genug, nur befreit genug wäre, dann würde ich es genießen, in einer festen Beziehung nebenbei noch andere Schwänze zu lutschen – so lautete offenbar die Logik dahinter.